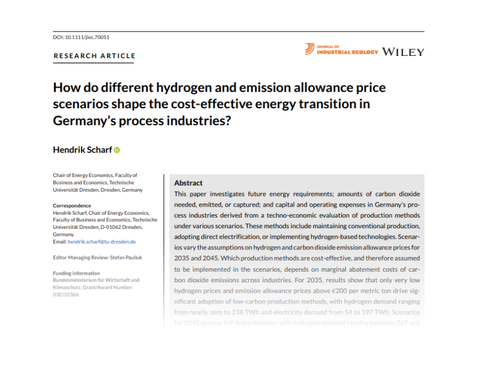Jul 04, 2025
Neue Veröffentlichung: „How do different hydrogen and emission allowance price scenarios shape the cost-effective energy transition in Germany's process industries?“
Am 1. Juli 2025 wurde ein neues Papier mit dem Titel „How do different hydrogen and emission allowance price scenarios shape the cost-effective energy transition in Germany’s process industries?“ veröffentlicht. Das Papier ermittelt künftige Energiebedarfe des deutschen Industriesektors für unterschiedliche Szenarien zu Wasserstoff- und Emissionshandelspreien in den Jahren 2035 und 2045. Dafür identifiziert ein Modell auf Basis techno-ökonomischer Parameter für 22 Industrieprodukte der Branchen Grundstoffchemie, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, nichtmetallische Mineralien sowie Papier das jeweilige Produktionsverfahren, welches sich bei den Preisannahmen des jeweiligen Szenarios als kosteneffektiv erweist. Dabei stehen für die Herstellung der 22 Produkte jeweils ein geeignetes oder mehrere geeignete innovative Verfahren, die mit einer vollständigen Defossilisierung des konventionellen Verfahrens einhergehen, sowie für das Szenariojahr 2035 die Beibehaltung des konventionellen Verfahrens zur Auswahl. Für das Jahr 2045 ist das Modell so konfiguriert, dass es immer das in dem jeweiligen Szenario kostengünstigste innovative Verfahren wählt, um dem Ziel einer vollständigen Defossilisierung zu entsprechen. Anschließend werden pro Szenario die sich aus der Implementierung der identifizierten Verfahren ergebenden Strom- und Wasserstoffbedarfe sowie CO₂-Emissionen und Bedarfe zunächst auf die nationale Ebene aggregiert und für ausgewählte Szenarien auf bestehende Standorte regionalisiert.
Für 2035 zeigen die Ergebnisse, dass es nur bei sehr niedrigen Wasserstoff- und Emissionszertifikatspreisen zu einer nennenswerten Umstellung auf innovative Verfahren kommt. Die Spannweite der Wasserstoffbedarfe der Szenarien liegt zwischen nahezu null und 238 TWh, die der Strombedarfe zwischen 54 und 197 TWh. Für das Jahr 2045 liegen je nach Szenario die Wasserstoffbedarfe zwischen 267 und 419 TWh, die Strombedarfe zwischen 163 und 301 TWh. In allen Szenarien für 2045 werden 262 TWh Wasserstoff als Reaktions- oder Reduktionsmittel genutzt. Angesichts fehlender alternativer CO₂-Vermeidungsoptionen wäre dieser Bedarf im Falle einer vollständigen Defossilisierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der heimischen Fertigung mit den angenommenen Produktionsmengen unvermeidbar. Die Regionalisierung der Energiebedarfe für das Jahr 2045 ergibt für chemische Anlagen und die Herstellung von Primärstahl punktuell enorme Bedarfe an Strom und Wasserstoff von zusammen oftmals über 20 TWh je Standort. Die zusammen bereits auf nationaler Ebene geringeren Energiebedarfe für die Herstellung von Sekundärstahl, Nichteisenmetallen, nichtmetallischen Mineralien sowie Papier verteilen sich dagegen deutlich gleichmäßiger auf eine größere Anzahl an Standorten.
Insgesamt unterstreichen die Ergbenisse, dass eine vollständige Defossilisierung der Industrie einen massiven Ausbau der Kapazitäten für die Erzeugung, den Import und die Verteilung erneuerbarer Energien erfordert, sofern eine teilweise oder vollständige Verlagerung von Wertschöpfungsketten in das Ausland nicht stattfindet. Gerade eine Verlagerung von Produktionsschritten in der Chemie- und Stahlbranche könnte jedoch zu erheblichen Energie- und Investitionseinsparungen in Deutschland führen.
Das Papier ist Open Access in dem Journal of Industrial Ecology unter https://doi.org/10.1111/jiec.70051 verfügbar.