Jan 18, 2023
Episode 01: How it all begins - A debate about life, pregnancy (abortions) and artificial insemination
Our podcast series you ask we explain - Fear of contact in medicine started in January with the topic: How it all begins - A debate about life, pregnancy (abortions) and artificial insemination.
We wanted to discuss with you and answer your questions. Didn't have time to be there? No problem: just listen to our podcast on the go - on Spotify, Apple Music, Deezer, Google or here.
Stephan Wiegand: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem COSMO Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden.
Konstantin Willkommen: (...) Wow. Also ich finde von der ganzen Neugierde, die hier versammelt ist, kriegt man schon auch ein bisschen Gänsehaut. You ask we explain? Der Titel birgt schon das Geheimnis, es geht heute Abend um Fragen. Ich bin jetzt mal so mutig und werfe die ersten Fragen in den Raum, und zwar Was machen wir hier? Wir wollen hier eine Kontaktstelle für die Diskussion aufbauen, einen Austausch für Interessierte und Expertinnen bieten. Und warum? Wissenschaft und Forschung ist ein elementarer Teil unserer Kultur und Neugierde ist die Triebfeder dafür. Wie machen wir das Ganze? Sie haben es vielleicht im Netz gesehen, vielleicht auf den Plakaten. Wir haben von Ihnen die Fragen gesammelt und wollen sie nun heute beantworten. Als letzte Frage dann Wer macht das Ganze? Nun, das sind meine Gäste heute hier vor Ort, Herr Bernd Kreissig, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Edingen. Er kommt zu uns mit dem Zitat Leid und Unglück in der Welt sind oft die Folge von falschen Ängsten, Ideologien, Aberglaube und solchen Dingen. Aber dagegen kann man etwas tun, nämlich miteinander sprechen, offen, vorurteilsfrei, respektvoll und ehrlich interessiert an anderen Meinungen als nur der eigenen. Weiterhin neben mir Katharina Langton. Sie ist Hebamme und hat es ermöglicht, dass seit 2021 in Dresden der schönste Beruf der Welt studiert werden kann, nämlich die Hebammenkunde an der TU Dresden. Unsere dritte Gästin werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt noch vorstellen, Frau Professorin Minarlie Kirsch. Ich denke, sie wird dann noch später hinzustoßen. Das Thema für den heutigen Abend ist Leben und wie alles beginnt. Und so fangen wir an mit der ersten Frage Was ist das Leben? Herr Kreissig, möchten Sie antworten? Bernd sage ich jetzt einfach mal.
Bernd Kreissig: Genau, wir haben uns gerade kennengelernt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, eine wirklich allgemeingültige Definition, die auch allgemein anerkannt ist, fürs Leben zu finden. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Das würde ja irgendwie in die Richtung gehen - Leben, das ist ein System, was in Bezug auf die eigene Existenz mit seiner Umwelt irgendwie im Austausch steht, in Prozessen. Ich finde, man kann sagen eine Idee lebt zu Recht. Also es ist nicht nur das biologische Leben. Als Theologe würde ich sagen: Leben ist das, was Gott als Sein, ja als Sein Gegenüber, als sein bewegtes, lebendiges Gegenüber geschaffen hat.
Konstantin Willkommen: Die Idee lebt also heute auch. Haben wir hier auch etwas geboren mit unserem neuen Podcast, den wir hier starten? Frau Langton was ist für Sie Leben?
Frau Langton: Ja, das ist eine Definition, die jeder sicherlich anders stellt, jeder einen anderen Sinn im Leben sieht. Das umgibt uns alle, Das umfängt uns. Wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Staubkorn im Weltall und manchmal das Allergrößte. Ich denke, es ist ganz schwer, da einen Anfang und ein Ende zu finden.
Konstantin Willkommen: Und woran würde man es erkennen? Wo würden wir einen Anfang suchen?
Frau Langton: Ich denke, das definiert jeder anders. Wo ist der Anfang für jeden selbst? Wo definiert man sein eigenes Sein, seinen eigenen Beginn, den Beginn der anderen. Ich denke, es ist leichter, es zu beobachten an uns selbst.
Konstantin Willkommen: Also Leben ist dann immer das, was wir beobachten.
Frau Langton: Ich denke schon, denn manchmal ist man sich dessen nicht bewusst, welchen Teil man in diesem System spielt.
Bernd Kreissig: Auch eine Amöbe lebt. Wahrscheinlich hat sie nicht die gleiche Art von Selbstbewusstsein, wie wir sie haben. Und ich glaube auch nicht, dass in allen Fällen es ganz genau möglich ist zu sagen hier beginnt Leben, hier endet Leben. Also heute reden wir viel über menschliches Leben, oder werden wir auch über menschliches Leben sprechen. Nehmen wir mal ein beginnendes Leben Ein Spermium entsteht durch eine Folge von Mitosen und Meiosen, also verschiedene Formen von Zellteilungen und Vervielfältigungen. Und es ist glaube ich, wirklich nicht ganz leicht zu sagen ab wann ist es nicht mehr das Leben des Mannes, von dem diese Spermien stammen, sondern das ist ein Stück weit Definitionssache. Und es ist auch okay so, dass man da, wo man eine Definition von Leben braucht, schaut, für welche Frage brauche ich sie? Was will ich entscheiden? Und danach eine sachgerechte Definition von Leben für diesen, für diese Fragestellung erzeugt. Das bringt einen, glaube ich weiter, als zu versuchen, in einem Rundumschlag eine allgemeingültige Lebensdefinition herzustellen.
Konstantin Willkommen: Da haben Sie jetzt das Spermium als Lebensquelle gesehen. Wir haben auch noch die andere Seite, die Eizelle dazu. Wenn die beiden sich verbinden, entsteht auch Leben. Wann ist das der Moment für Sie?
Frau Langton: Die Entstehung des Lebens? Ja, genau in diesem Moment glaube ich. Im Werden und Wachsen aus der Sicht der Hebamme natürlich - jede Frau wird Mutter, sobald sie schwanger ist. Ab diesem Moment, wo genau dieser Vorgang passiert ist, entsteht neues Leben in ihr. Auch wenn es von außen noch lange nicht zu sehen ist, auch wenn das Bewusstsein von anderen vielleicht dafür noch lange nicht da ist. Aber für sie selbst hat diese Veränderung ja schon begonnen.
Konstantin Willkommen: Die werdenden Mütter, die auf sie zukommen, was sagen die über das Leben? Welche Rückmeldungen haben sie von denen erhalten? Wann das Leben für sie begonnen hat in ihnen?
Frau Langton: Ja. Mit diesem Bewusstsein, dass quasi die Befruchtung stattgefunden hat, dass Sie wirklich die Schwangerschaft bestätigt haben, auch manchmal schon mit diesem Gefühl, es könnte so sein. Speziell ist es natürlich noch mal für Frauen, die nach künstlicher Befruchtung schwanger sind, die von diesen Vorgängen noch viel, viel näher dran sind. Auch in der Planung natürlich schon ganz anders an der Stelle sind, die das wirklich bewusst auch miterlebt haben.
Konstantin Willkommen: Haben die Väter an der Stelle auch ein Bewusstsein dafür, wann das Leben begonnen hat?
Frau Langton: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich denke, es gibt einige, bei denen das so ist. Bei anderen wird es nicht so sein. Ich denke, für Mütter, für Frauen ist das sicherlich ein stärkeres Moment, an der Stelle. Dieses Bewusstsein, was da passiert und diese wahnsinnige Veränderung. Diesen Umsturz, den es im eigenen Leben mit sich bringt, das neue Leben, der ist sicherlich für Frauen erst mal in dem Moment noch ein größerer.
Konstantin Willkommen: Birgt das auch Konflikte?
Frau Langton: Auf jeden Fall. Ich erlebe einfach Frauen, die natürlich sehr, sehr verbunden sind zu diesem neuen Leben. Das ist oft sehr positiv, aber nicht immer. Und die Konsequenzen fürs eigene Leben sind natürlich andere, für die Frauen in diesem Moment als für die Partner, für die Männer. Das muss man schon so sagen. Und deswegen ist natürlich der Umgang ein ganz anderer damit. Deswegen ist natürlich da Konfliktpotenzial, stehen ja nicht beide auf der gleichen Ebene nicht an dem gleichen Standpunkt unbedingt. Auch wenn die Schwangerschaft jetzt geplant und gewünscht war und vielleicht auch lang ersehnt, ist es trotzdem immer so der Moment, wenn es dann doch so weit ist, so eine ganz weit reichende Entscheidung getroffen wurde und auch ein Moment passiert ist, der wirklich das weitere Leben für immer beeinflussen wird, egal wie diese Schwangerschaft ausgehen wird. Das ist sicherlich mit Konflikten behaftet, wie man das betrachtet. Ja.
Konstantin Willkommen: Es gibt dementsprechend auch eine gewisse Gesetzgebung, ab wann wir von Leben sprechen, geht die immer mit der Meinung konform, von den werdenden Müttern?
Frau Langton: Nein, auf keinen Fall. Also rein rechtlich gesehen ist der Mensch ja quasi mit Rechten ausgestattet, sobald er das Licht der Welt erblickt, also den Mutterleib verlassen hat. Und das birgt natürlich schon ein gewisses Konfliktpotenzial in der Sichtweise, dass die Frauen natürlich ihre Kinder vielleicht anders betrachten, wenn sie noch im Bauch sind, als es der Gesetzgeber, für den das eigene Leben erst beginnt, wenn das Kind im Mutterleib verlassen hat.
Konstantin Willkommen: (...) Das war gerade das Thema mit den Rechten und dem Leben, das ist eng miteinander verbunden. Wir haben gesagt Leben ist dann da, wenn wir es beobachten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Leben zu beobachten. Es gibt, wie Sie das gesagt haben: Die Frauen nehmen eine Veränderung wahr, beobachten das dann an sich selber, spüren, dass da jetzt Leben ist. Gleichzeitig der Gesetzgebung entsprechend brauchen wir einen Nachweis auch für das Leben. Also haben wir gewisse medizinische Diagnostik. Mit welchen Fragen ist das verbunden für die werdenden Mütter? Wie kommen die da auf sie zu in der Diagnostik?
Frau Langton: Man muss wirklich sagen, aus meinem Standpunkt Pränataldiagnostik, also alle vorgeburtliche Diagnostik, die man betreiben kann, ob das in Schwangerschaftstests, ob das eine Ultraschalluntersuchung ist, eine Nabelschnurfunktion. Gentests sind natürlich Segen und Fluch zugleich. Ja, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 25/30/35 Jahren, in der Hinsicht, dass auf der einen Seite natürlich auch den Frauen frühe Gewissheit gegeben werden kann, in Bezug auf die Schwangerschaftsfeststellung. Fehlbildungsdiagnostik ist möglich, die es früher einfach noch nicht gab. Auf der anderen Seite sind solche Möglichkeiten auch mit Entscheidungsprozessen, denen man ausgesetzt ist, verbunden. Ich habe es manchmal beobachtet, dass Frauen sich trotz aller Möglichkeiten nicht besser informiert fühlen. Wie gesagt, sie erfahren zeitig von ihrer Schwangerschaft und müssen sich schon zeitig mit dem Gedanken auseinandersetzen, die sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten. #00:09:58‑8#
Bernd Kreissig: Ich würde gerne ergänzen. Es ist sehr gut, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die wir haben und die sich immer weiterentwickeln. Festzustellen, wo ist beginnendes Leben oder wo auch nicht. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass Leben dort ist, wo vielleicht eine Person nichts fühlt oder wo eine Maschine nichts oder noch nichts entdecken kann. Insofern sind diese Hilfsweisen Instrumente sicher richtig, aber ich würde davon nicht die Definition und die Existenz von Leben abhängig machen, wann wer etwas fühlt oder beobachtet. Wir kriegen Verstärkung. Sagen wir es gleich zu, die kann das auch noch mal beleuchten. Deshalb würde ich noch mal darauf abheben: Leben wäre aus meiner Sicht., das hilft, wenn man sich das vorstellt, auch als ein Geschenk und als eine Gabe. Als christlicher Theologe sage ich Es ist eine Gabe Gottes. Das kann aber jeder auch für sich anders sehen. Und da gilt tatsächlich, dass dieses Geschenk da ist, sogar noch bevor irgendwelche chemischen, biologischen oder sonst welche Prozesse begonnen haben. Es gibt dieses wunderbare poetische Buch im Alten Testament, das Buch der Psalmen. Da heißt es an einer Stelle, dass Gott den Menschen, dass er schon geschaffen ist, bevor er überhaupt den Mutterleib gebildet, also tatsächlich angefangen hat zu existieren, sondern schon allein in diesem Wissen, dass Gott weiß, da entsteht ein neues Leben. Und das habe ich so geschaffen und die Welt gegeben. Und das wird sein. Und in dem Moment ist es tatsächlich auch schon da, bevor wir es messen können. Und ich glaube, es hilft auch für ethische Fragen sehr, sich nicht darauf zu verlassen, dass ich irgendetwas fühlen oder beobachten kann oder mit gewissen Eigenschaften ausgestattet sehe, weil man da in sehr gefährliche Dinge kommen kann, wem ich dann das Leben aberkennen müsste. Und ich glaube, diese ergänzende Betrachtungsweise kann helfen, den Respekt vor dem Leben weiter zu schützen und auszubauen.
Konstantin Willkommen: Das ist natürlich genau wie Sie sagen. Dann ist immer der nachgeschaltete Punkt, wenn ich prüfe, ist Leben da, entscheide ich ja auch darüber, wo Leben nicht da ist. Und dieses Aberkennen muss man dann abwägen und vielleicht auch sich überlegen, ob ein bisschen Gottvertrauen da vielleicht helfen kann. Aber an der Stelle erst noch mal eine herzliche Begrüßung an unsere dritte Gästin heute Abend. Frau Professorin Mina Ae Lee-Kirsch, die als Forscherin am Universitätsklinikum in der molekularen Pädiatrie der Kinderklinik arbeitet. Sie ist außerdem stellvertretende Sprecherin des Unizentrums für Seltene Erkrankungen und beschäftigt sich insbesondere mit genetisch bedingten Erkrankungen des Immunsystems, mit chronischen Entzündungen. Und sie sucht dabei nach den Krankheitsmechanismen und wie dieses Wissen uns dann letztendlich helfen kann, bessere Therapien zu finden. Schön, dass Sie heute da sind.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Vielen Dank. Und ich möchte mich noch entschuldigen. Ich hatte mit einer Straßensperrung zu kämpfen.
Konstantin Willkommen: Wir waren gerade bei dem Thema Schwangerschaft. Also wir beschäftigen uns heute ja mit dem Leben und haben gerade auch ein bisschen über Für und Wider von verschiedenen Diagnostiken gesprochen. Jetzt nicht Diagnostiken im Einzelnen, aber dem Vor und Nachteilen, die uns dadurch geben, wenn wir nach dem Leben schauen, um zu schauen ist Leben da und was hat das für Implikationen? Wie sehen Sie das denn, als sowohl am Patienten klinisch tätige Forscherin oder dann eben auch im theoretischen Forschungswesen?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Meinen Sie jetzt die vorgeburtliche Diagnostik? Es ist heute technisch sehr viel besser möglich, auch schon vorgeburtlich nach Erkrankungen, vor allen Dingen vererbten Erkrankungen zu schauen. Und daher ist es auch total verständlich, dass Familien bzw. Eltern mit Kinderwunsch, die schon ein Kind haben, das eine schwere, vererbte Erkrankung hat, den Wunsch haben, nach einer vorgeburtlichen Diagnostik. Wichtig ist, dass man solche Familien eben begleitet und sie bestmöglich informiert über die Möglichkeiten und aber auch die Grenzen einer solchen Diagnostik und die damit verbundenen Eingriffe. Denn in Deutschland ist es so, dass das eben nur möglich ist, wenn im Rahmen zum Beispiel einer Chorionzottenbiopsie oder einer Amniozentese, das heißt eine Schwangerschaft besteht schon und für das Paar und für die Frau ist es dann natürlich wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Befund habe, der darauf hindeutet, dass das werdende Kind auch betroffen ist von einer schweren Erkrankung.
Konstantin Willkommen: Dann liegen diese Fakten alle auf dem Tisch. Und wer bietet dann eine Entscheidungshilfe?
Frau Langton: Eine schwere Frage. Natürlich treten die Frauen mit dieser konkreten Problematik dann an ihre Gynäkologen bzw. Geburtshelfer heran, aber auch an uns Hebammen. Tatsächlich sind dann Fragestellungen, wo viel Beratungsbedarf ist. Die kommen aus der Klinik, hatten da vielleicht ihr Gespräch. Und trotzdem Wie geht es jetzt weiter? Die technischen Fakten? Ja, die liegen auf dem Tisch. Aber was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meine Familie, für mich selbst? Für meine Zukunft? Für meinen Partner, für meine anderen Kinder, für mein Konstrukt Familie, in dem ich mich befinde? Das ist ein ganz großer Teil. Und oft erleben wir Frauen, die quasi schon mit dieser Problematik schon mal konfrontiert waren, was sie gerade sagte, die diese Erkrankung schon kennen und sich überlegen müssen Können wir es schaffen, noch mal damit umzugehen? Das ist das eine. Aber die Mehrzahl der Frauen betrifft es natürlich, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und diese Möglichkeiten, die auch wunderbar sind, nutzen, aber sich vorher wirklich nicht bewusst sein können, was das bedeutet. Nachher dann. Eine Vorsorge in dem Sinne gibt es ja nicht. Es ist ja im Prinzip wenn dann eine Früherkennung. Ja, und dann muss ich mir natürlich vorher Gedanken machen, was mache ich auch mit dem Ergebnis? Spielt das für mich überhaupt eine Rolle? Und wenn dann welche?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ich glaube, es ist vollkommen natürlich. Man hat ja immer den Wunsch, ein gesundes Kind zu bekommen. Und gerade in der Situation, die Sie gerade ansprechen, dass eigentlich überhaupt kein Hinweis darauf besteht, dass eine genetisch bedingte Erkrankung in der Familie vorliegt. Auch dann kann es mal vorkommen, dass ein doch krankes Kind zur Welt kommt. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, im Rahmen der Vorsorge einer Schwangeren bestimmte genetisch bedingte Erkrankungen wie zum Beispiel eine Trisomie 21 auszuschließen oder danach zu gucken. Und auch das ist etwas, was jede Familie, jedes Paar für sich selber entscheiden muss. Will ich das überhaupt wissen? Will ich das untersuchen, Ja oder nein? Und das sind sehr, sehr persönliche, sehr individuelle Entscheidungen. Wir können als Ärzte, als Humangenetiker nur aufklären über die Risiken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas auftritt und über die Möglichkeiten einer vorgeburtlichen Untersuchung, um dieses Risiko näher einzugrenzen. Und die Entscheidung muss dann aber natürlich das Paar oder die Schwangere selber treffen.
Konstantin Willkommen: (...) Um Entscheidungen geht es auch an anderer Stelle. und zwar den Schwangerschaftsabbruch. Wir wollen hier auch ein bisschen mit Berührungsängsten vielleicht arbeiten und deswegen auch dieses Thema beleuchten. Es ist ja mitunter mit einer gewissen Stigmatisierung in der Gesellschaft verbunden. Und das, obwohl wir keine hundert Prozentige Verhütungsmethode haben. Müsste man sich eigentlich vorstellen, dass eine ungewollte Schwangerschaft auch unser Alltag sein kann? Welche Beratungsangebote gibt es in Ihrer Kirchgemeinde dazu?
Bernd Kreissig: Also es gibt erst mal ganz direkt das Beratungsangebot, die Menschen anzusprechen, mich zum Beispiel als einen ersten Schritt. Und ich glaube, ich bin ja kein Fachmann auf diesem Gebiet. Und trotzdem glaube ich, dass in vielen Situationen das Gespräch und der Austausch über eine Situation mit verschiedenen Menschen, mit den Partnern, mit guten Freundinnen und Freunden wie auch immer sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist das Erste, Menschen in einer solchen Situation nicht alleine zu lassen. Dann ist es aber auch so, dass sie eine Fülle von rechtlichen, von medizinischen, von durchaus auch sozialen und materiellen Fragen daran hängt und da ist es gut, dass man Spezialisten hat, die auch entsprechenden Zugriff auf Ressourcen haben, um auch in diesen konkreten Teilaspekten zu beraten. Da haben wir in der Kirche tatsächlich diakonische Beratungsstellen, wo dann wirklich auch Menschen sitzen, die nichts anderes machen als das. Und da würde man dann dort das gemeinsame Gespräch fortsetzen, um eben auch die bestmögliche Information auf der sachlichen Ebene zu bekommen.
Konstantin Willkommen: Findet dieser Austausch auf Augenhöhe statt?
Frau Langton: Mit Frauen untereinander sicherlich ja. Denn es ist nicht ganz so unalltäglich, wie es vielleicht klingt. Ich meine, im letzten Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 750.000 Geburten in Deutschland, um die 100.000 Schwangerschaftsabbrüche, davon auch nur 4 %, also der kleinere Teil aus medizinischer Indikation, also die meisten wirklich aus sozialer Indikation, wo sich die Frauen nicht in der Lage gesehen haben, die Schwangerschaft auszutragen. Also deshalb denke ich, ist es gar nicht so ein Randproblem, wie man es vielleicht meint. Deswegen ist es wichtig, das in den Fokus zu rücken. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen entstigmatisiert worden. Also so erlebe ich das zumindest, dass die Diskussion dann doch ein bisschen offener geführt werden kann.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Deutschland ist ja der Schwangerschaftsabbruch gesetzlich geregelt. Und diese gesetzliche Regelung, insbesondere bei einem Schwangerschaftsabbruch vor der zwölften Woche beinhaltet ja auch eine Beratung, eine Schwangerenkonfliktberatung beispielsweise in einer kirchlichen Beratungsstelle, aber auch nicht kirchliche Beratungsstellen, die völlig unabhängig erfolgt von dem Arzt, der möglicherweise den Schwangerschaftsabbruch dann vornimmt, wenn denn eine Frau sich dafür entscheidet. Vorgegeben ist auch, dass eine Frau mindestens drei Tage Bedenkzeit hat nach einer solchen Beratung ihre Entscheidung, wie auch immer sie dann ausfallen mag, zu überdenken.
Frau Langton: Schwierig finde ich persönlich, dass es eigentlich nur straffrei ist unter bestimmten Bedingungen. Denn das impliziert ja schon ein bisschen, dass es nicht in Ordnung ist. Und was mir sonst noch ein bisschen bei der Diskussion fehlt, ist tatsächlich - Es geht immer nur um die Frauen. Ja, aber wir hatten es gerade vorhin Spermium und Eizelle. Also es braucht schon zwei Beteiligte und es betrifft und es geht immer nur um die Frauen. Die Frauen werden gezählt, sie werden vielleicht irgendwo stigmatisiert. In anderen Ländern müssen sie mit harten Konsequenzen rechnen. Das ist hier ja Gott sei Dank nicht so, aber wo sind denn die Partner? Wo sind denn die Männer, die Beteiligten? Wer drückt die denn mal in den Fokus?
Bernd Kreissig: Ich hoffe unter anderem eine Beratungsstelle, dass sie darauf hinweist. Ich hoffe, eine Beratungsstelle versteht sich nicht nur so, dass sie die entsprechenden Auswirkungen von Paragraf 218 und 219 nicht mehr in den Vordergrund stellt, sondern auch solche Fragen klärt. Und wenn der Partner nicht schon dabei ist, spätestens dann aber sagt ‚Passen Sie auf, Sie tun sich und allen Beteiligten einen Gefallen, wenn Sie dieses Gespräch gemeinsam führen.‘ Und dass eben nicht eine einsame Entscheidung einer Mutter sein lassen. Das wäre mir wichtig, dass es eben nicht so ist, dass eine Frau ihre Entscheidung trifft und dann zur Beratungsstelle geht. Also sie kann natürlich eine Meinung haben, aber ich würde hoffen, dass die Beratung so gut ist, dass die eigentliche Entscheidung nach und nicht vor diesem Gespräch fällt und dass die Beratung eine möglichst gute ist und dass die Beratung idealerweise auch die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Gesellschaft, durch den Partner herausstellt, weil es einfach ein Jammer ist, irgendwie. Also ich würde sagen, aus sozialen und materiellen Gründen heraus. Das sind die Fälle, um die ich kämpfen würde. Ich verstehe diese Situation, soweit ich sie kenne. Und trotzdem würde ich sagen, die Entscheidung dafür, ein Leben, ein Werdendes nicht fortzusetzen, die sollte man sich nicht zu leicht machen. Man sollte sie ernst nehmen. Es ist gut, dass es das Recht gibt, aber es sollten die Möglichkeiten verfügbar sein, das nicht ohne Not tun zu müssen.
Frau Langton: Ja, das sehe ich ähnlich.
Stephan Wiegand: Kleinen Moment, wenn ich da einhake. Wir wollen ja nicht nur einen Frontalunterricht machen, sondern wir haben ja aufgerufen und aufgefordert, dass jeder unsere, der unseren Podcast verfolgt und unsere Diskussion verfolgen möchte, uns auch Fragen zukommen lässt. Und das haben wir mit der Sächsischen Zeitung gemeinsam gemacht, dass wir aufgerufen haben. Wir haben auf unserer Homepage ein Tool, wo man ganz schnell den Kontakt zu uns findet und ich habe so Karten ausgeteilt. Da kann man Fragen draufschreiben, wenn man die Karte nicht hat, Hier vorne liegen die aus oder es geht dann gleich noch mal durch. Kurzum was ich noch erklären wollte, ist das Prinzip mit der Musik. Damit es nicht zu langatmig wird, spielt alle zehn Minuten die Band ein kleines Stück zwischendrin und ich hoffe, ich provoziere das jetzt nicht gerade in dem Moment ich eine dieser Zuschriften mal kurz skizziere. Die sind immer anonym bei uns, denn wir wollen halt mit euch ins Gespräch kommen und über Wissenschaft diskutieren, wie man das vielleicht ansonsten nicht ganz so einfach über die Bühne kriegt. Die Frage, die da reinpasst, ist zugesandt worden von uns. Darf Mann, muss Mann, kann Mann oder sollte Mann als werdender Vater ein Mitspracherecht beim Schwangerschaftsabbruch haben oder gar auch bei der Fortführung der Schwangerschaft? Also ganz klar die Frage Mann und Frau? Gemeinsame Entscheidung Kann man das organisieren? Kann man das in der Beratung gewährleisten? Kann man das vielleicht auch in der Medizin gewährleisten? Kann man da suchen, die Anregungen geben? Wie auch immer. Aber die Frage ins Podium.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Es ist ganz sicher so unzweifelhaft, dass zwei dazu gehören, ein Kind zu zeugen und wo immer möglich und im Idealfall sind auch beide involviert in solche Entscheidungen, solche elementaren Entscheidungen. Aber oft oder nicht selten ist es so, dass eine Frau mit einer solchen Situation auch alleine dasteht. Und das Zweite ist - Es betrifft ihren Körper. Und insofern würde ich einer Frau da ein besonderes Recht einräumen. Nichtsdestotrotz halte ich es für ungemein wichtig und für wünschenswert, dass der Partner sich genauso involviert. Und wo das immer gegeben ist, sollte er auch natürlich mit beteiligt sein am Entscheidungsprozess. Ob das aber immer der Fall ist, ist wieder eine andere Sache. Vielleicht haben Sie da andere Erfahrungen gemacht.
Konstantin Willkommen: Das wäre jetzt direkt meine Rückfrage aus der Praxis. Wie ist da Ihre gelebte Erfahrung?
Frau Langton: Also in der Mehrzahl sehe ich natürlich schon. Ich habe es einfach erlebt, dass die Frauen natürlich die Entscheidungen treffen, oft auch alleine treffen für sich, denn sie wird es am meisten betreffen. Ich denke, es ist öfter so, dass die Frauen, dass die Partnerschaften ein bisschen problematisch wären im Vorfeld. Das ist also schon eher der Schwangerschaftsabbruch. Ein Thema ist bei nicht fortbestehenden oder unstabiler Beziehung. Es ist tatsächlich sicherlich etwas weniger der Fall, wenn die Frauen in intakten Beziehungen wohnen, wo man sagt, man hat das Modell Kind zusammen haben auch schon ausprobiert. Man weiß, woran man ist und worauf man sich einlässt. Das ist dann sicherlich leichter, eine Entscheidung pro zu treffen, wenn ich weiß, es funktioniert.
Konstantin Willkommen: (...) Daran angeschlossen noch eine Frage. Trotz allem gibt es auch Beratungsmöglichkeiten für die Zeit danach? Also welche Unterstützung können Paare dann ja nicht mehr werdende Mütter oder auch die Männer in einer solchen Beziehung, bei der es zu einem Abbruch kam, einer Schwangerschaft werden die auch in der Zeit danach begleitet?
Bernd Kreissig: Also es gibt eine Fülle von auch materiellen unterstützt. Das ist eine der Fragen. Und dann gibt es ganz praktisch organisierte Unterstützung. Das ist was, was ich in Kirchengemeinden auch jetzt erfreulicherweise gerade in unserer Zeit wieder erlebt habe, dass da wirklich andere Menschen da sind, die sagen Ja, wir helfen dir. Wir sind dann da, was weiß ich, Kinder zu beaufsichtigen, wenn das eine Mutter alleine, wenn sie alleinerziehend ist, nicht kann. Mir ist nicht bekannt, ob es jetzt tatsächlich für diesen speziellen Fall exklusive Beratungsstellen gibt, die genau für solche Situationen da sind. Aber ich glaube schon, dass wir in unserem sozialen Netz eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten haben, die man nutzen kann, auch erst mal kennen muss. Und auch darin besteht schon die erste, die erste Unterstützungsschritt, das bekannt zu machen, darüber zu informieren.
Konstantin Willkommen: Dazu noch eine Publikumsfrage.
Stephan Wiegand: Regelrecht eine Publikumsfrage, vielleicht sogar eine Publikumsantwort darauf. Denn gerade hat sich ein Mann zu Wort gemeldet.
Publikumsfrage: Schilling ist mein Name. Ich mache Pränataldiagnostik. Deswegen habe ich ein kleines bisschen Ahnung. Also es gibt in Sachsen zu dieser Frage drei Beratungsstellen, die speziell dafür ausgebildet sind. Eines dafür, eines in Dresden. Die ist von der AWO. Und die begleiten Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, bis zum Abbruch. Auch unter dem Abbruch zum Teil. Und die begleiten die Frauen auch nach einer Schwangerschaftsbeendigung. Und die begleiten die Frauen auch bei der Entstehung einer neuen Schwangerschaft. Also wer dieses Angebot annehmen will von den Frauen, die sind in Sachsen eigentlich gut versorgt. Das ist ein Pilotprojekt in Deutschland gewesen, und der Freistaat Sachsen hat das Projekt dankenderweise fortgeführt. Also die sind eigentlich, wer das annehmen will, sehr gut aufgehoben.
Konstantin Willkommen: Vielen Dank für den Kommentar auch hier an der Stelle. Bevor wir weitergehen, auch noch die Information. Wir werden das sicherlich auch noch mal in die Shownotes packen. Wer sich auch immer als Mensch in einer solchen Situation befindet, soll wissen, dass er/sie dafür Hilfe finden kann. Und wir werden entsprechende Informationen dazu dann auch noch hinterlegen. Wir gehen zu einem weiteren Thema und zwar Wie entsteht Leben? Sind wir eingestiegen und haben begonnen? Nun ist das aber mitunter vielleicht gar nicht so leicht. Das Leben entsteht und manche Menschen treffen dabei auch auf Hürden. Welche Optionen können wir denn Menschen bieten, die jetzt nicht auf dem herkömmlichen Weg zu neuem Leben kommen können?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Es ist vielleicht eine Frage an die Ärztin. Also Sie sprechen jetzt von Möglichkeiten einer unterstützten Reproduktion, wie wir so fachtechnisch sagen, oder einer künstlichen Befruchtung. Und dort gibt es auch mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Letztlich auch davon abhängig, was denn die Ursache einer ungewollten Kinderlosigkeit ist. Und unter anderem gibt es die Möglichkeit Mit einer künstlichen Insemination oder einer künstlichen Befruchtung außerhalb des Mutterleibes nach einer Hormonbehandlung der Frau, um eben Eizellen zu gewinnen. Das sind alles Verfahren, die natürlich mit einer besonderen Belastung auch des Paares und insbesondere der Frau verbunden sind. Eine weitere Möglichkeit ist die intrazytoplasmatische Injektion von Samen. Wenn zum Beispiel die Spermien grundsätzlich intakt sind, aber nicht sich ausreichend bewegen. Und damit verbunden ist aber immer auch, dass der Erfolg einer Schwangerschaft, die so entsteht, nicht immer gewährleistet ist. Also das ist ein langer und harter Weg für die betroffenen Paare, aber es ist möglich.
Konstantin Willkommen: Wie wertet man das? Dass wir uns offensichtlich da über eine scheinbar gottgegebene Grenze hinwegsetzen.
Bernd Kreissig: Also ich würde diese Grenze nicht als gottgegeben sehen, sondern es gibt alle möglichen Einschränkungen medizinischer, gesundheitlicher Natur im Leben. Niemand würde, was weiß ich, einen Rollstuhl als behelfsweise Bewegungsmöglichkeit, als eine Überschreitung der gottgegebenen Immobilität bezeichnen. Und ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit zunehmend auch haben. Paaren, die diesen Kinderwunsch haben und wo es genau an der Stelle scheitern würde, sonst weiter zu helfen. Da wäre ich froh und dankbar und würde sagen ‚Das ist ein Gottesgeschenk.‘
Konstantin Willkommen: Das ist ja eine schöne Möglichkeit, auch einer diverseren Elternschaft die Elternschaft zu ermöglichen, in dem Sinne. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit der Adoption. Und hier stehen wir vor dem Konflikt, dass letztendlich als Zeuger darf ich mich mehr oder weniger freiwillig dazu entscheiden, das zu tun. Wenn ich adoptieren möchte, dann gibt es da Stellen, die darüber richten, ob ich dafür geeignet bin, mich nicht unbedingt fortzupflanzen, aber eine Familie zu gründen. Wie erleben Sie dieses Spannungsfeld?
Frau Langton: Ja, das finde ich tatsächlich problematisch, dass es wirklich, dass die Hürden hoch sind. Da gibt es eine Altersgrenze, da wird das Lebensmodell quasi mit betrachtet der Eltern. Man kann so salopp sagen Wir müssen wirklich weit die Hosen runterlassen, um quasi bescheinigt zu bekommen, dass sie in der Lage sind, ein Kind großzuziehen, was bei der Bevölkerung, der die Reproduktion auf natürlichem Wege gelingt, nicht der Fall ist. Das ist schon ein großes Spannungsfeld, finde ich. Und es ist natürlich auch mit einer gewissen, für mich gefühlten Unfairness verbunden.
Konstantin Willkommen: Beraten Sie auch Menschen dazu? Was wird Ihnen da zurückgemeldet von denen, wie die das empfinden?
Frau Langton: Na ja, wir betreuen teilweise Frauen, natürlich. Nach Adoption steht diesen ja genauso Wochenbettbetreuung und Hilfe von Hebammen zu. Gerade wenn es ein sehr kleines ist. Wenn ein Säugling adoptiert werden kann, steht den Frauen Hilfe zu. Und da steht in der Regel erst mal noch die Freude im Vordergrund, dass es dann doch endlich geklappt hat. Und es ist genau wie bei der Reproduktionsmedizin ein langer, langer Weg, den die Frauen selber auch nicht so gewählt haben. Sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden und dann ist erst mal die Freude groß, dass das Kind dann doch bei ihnen angekommen ist. Aber es ist natürlich schon im Vorfeld, wenn man Privatleute kennt, denen das so geht, schon schwierig natürlich, die schon damit hadern, dass sie da durchleuchtet werden, ganz andere Anforderungen erfüllen müssen als Menschen, die auf natürlichem Wege Eltern werden können.
Konstantin Willkommen: Und wer ist das, der diese Kriterien festlegt?
Frau Langton: Das ist ja der Gesetzgeber.
Konstantin Willkommen: Der Gesetzgeber. Und wir wählen den Gesetzgeber. Also stimmen wir irgendwie alle gemeinsam darüber ab, wer Eltern werden darf und wer nicht.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ich würde es auch als etwas Positives auffassen, dass wir hier in Deutschland eine Regelung haben der Adoption. Gesetzliche Vorgaben, die letztlich ja zum Schutz auch eines adoptierten Kindes gedacht sind, dem Kindeswohl dienen. Mal unabhängig davon, dass das vielleicht für natürlich gezeugte Kinder nicht der Fall ist. Aber es ist gut für diese Kinder und auch letztlich für die Familien und die Gesellschaft, dass wir solche Regelungen haben, um eben auch Missbrauch vorzubeugen. Und insofern betrachte ich das als etwas Positives.
Konstantin Willkommen: (...) Wir hatten gerade die Reproduktionsmedizin schon mal angeschnitten. Dazu gleich die Frage Was steht da am Horizont für uns? Wo wollen wir dort hingehen?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ja, es ist der technische Fortschritt in den Naturwissenschaften ist so unglaublich groß und schnell und wir sind mittlerweile in der Lage, Gene zu reparieren oder zu verändern, was natürlich das Risiko birgt, dass man auch Gene optimiert, nicht nur um eine Krankheit zu heilen, sondern vielleicht um jemanden schöner, intelligenter oder was auch immer zu machen. Und das ist eine große Gefahr. Technologisch sind wir fast so weit, dass wir das umsetzen können, auch in menschlichen Organismen. Und dem muss man Einhalt gebieten. Da muss es Regelungen geben, da muss es Grenzen geben, die festlegen Wie gehe ich mit diesem technologischen Fortschritt um und wie verhindere ich einen Missbrauch?
Konstantin Willkommen: Das haben wir jetzt schon öfter immer wieder angehört. Dieses Moment zu sagen, wir müssen da Grenzen setzen oder wir müssen Regelungen schaffen. Wie werden diese Regelungen geschaffen?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ja, das geht letztlich nur im Diskurs, in der Gesellschaft und am Ende durch Gesetzgebung. Ich will mal ein Beispiel nennen: Es gab ja vor zwei oder drei Jahren diesen großen Skandal. Da hat in China ein Arzt einfach bei einer Frau die Eizellen aus ex vivo modifiziert, ein Gen modifiziert über CRISPR/CAS. Das ist die sogenannte Genschere. Und diese Kinder wurden auch gezeugt. Das ist verboten und auch weltweit geächtet. Und das war ein sehr großer Skandal. Das hat aber sehr klar gezeigt, dass das möglich ist und da muss man einfach Grenzen finden. Beziehungsweise das ganz konkret und für alle sicher Regeln. Und das geht nur gemeinsam. Das können nicht nur die Wissenschaftler alleine machen und die Ärzte, sondern das muss in der gesamten Gesellschaft diskutiert und gewertet und entschieden werden.
Bernd Kreissig: Da würde ich gerne ausdrücklich zustimmen. Deshalb bin ich auch diese Veranstaltung heute so toll. Wir reden viel in unserer Gesellschaft, aber oft in unseren Clustern. Und dass wir heute so schön interdisziplinär zusammenkommen, davon brauchen wir noch viel mehr. Ich glaube, es wird schwierig, zumal da die Geschwindigkeit, wie Sie gerade gesagt haben, zunimmt. Das vorlaufend schon alles geregelt zu haben. Das heißt, wir werden uns die Fälle, so sie auftreten. Sie haben jetzt ein sehr extremes Beispiel genannt. Die werden wir uns angucken müssen und dann daraus möglichst schnell sozusagen Schlüsse ziehen, die dann auch für die Gesetzgebung dienen und helfen können.
Frau Langton: An der Stelle finde ich immer schwierig. Was ist mit den Leuten, die sich nicht für Optimierung entscheiden? Wir kommen hoffentlich irgendwann nicht in die Rechtfertigungsspirale, die sagen ich nehme das alles so, wie es kommt. Ich akzeptiere das für mich. Ich möchte das nicht in Anspruch nehmen. Und da die das beobachte ich schon manchmal, dass man mit dem jetzigen technischen Fortschritt stand heute schon manchmal den Frauen sagt, das muss doch heute nicht mehr sein, das kann man früh erkennen.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Du, da stimme ich Ihnen total zu. Das ist auch etwas, was ich in meinem ärztlichen Alltag erlebe, dass Frauen oder Paare sich förmlich gedrängt fühlen, irgendwelche Diagnostik in Anspruch zu nehmen, um ja bestimmte Erkrankungen auszuschließen. Und sie wollen das nicht. Und das ist etwas, was man respektieren muss. Und dazu gehört zum Beispiel auch das sogenannte Recht auf Nichtwissen. Wenn also, weil es vielleicht eine genetisch bedingte Erkrankung in der Familie gibt, jemand eine Diagnostik initiiert und dann aber sagt, obwohl er das ursprünglich anders gesehen hatte ‚Ich möchte das Ergebnis nicht wissen. Ich möchte nicht wissen, ob ich auch mal Morbus Huntington zum Beispiel bekommen‘, dass eine schwere Neurodegeneration, die sich erst im Erwachsenenalter manifestiert. Dann muss man diese Entscheidung respektieren. Wir zum Beispiel, die wir solche Diagnostik anbieten, haben dann die Pflicht, ein solches Resultat zu vernichten bzw. dann eben nicht bekannt zu machen. Und das ist wichtig, dass man dieses Recht auch hat und das auch respektiert wird.
Konstantin Willkommen: Was macht das mit einem als Ärztin? Man hat dieses Ergebnis vor sich liegen. Die Eltern haben gesagt, sie möchten es nicht wissen. Wie geht man damit um in seinem Arbeitsalltag?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Das ist eine schwierige Situation. Also auf jeden Fall aber das Recht des Ratsuchenden oder des Patienten hat oberste Priorität, und das gilt es zu respektieren.
Konstantin Willkommen: Und wie wägt man das dann ab gegenüber dem vielleicht noch ungeborenen Kind und dessen Rechte auf Gesundheit? Sage ich es jetzt mal so.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Das betrifft jetzt eine Pränataldiagnostik, und eine Pränataldiagnostik ist ja immer, in jedem Fall mit einer sehr umfassenden Beratung verbunden, also einer genetischen Beratung oder Beratung durch andere Experten, zum Beispiel Frauenärzte. Und da hoffe ich einfach, dass das auch so umfänglich durchgeführt wird, dass ein Paar oder eine Schwangere sich auch der Konsequenzen bewusst ist, die es bedeutet, wenn sie ein Ergebnis nicht wissen will. Das ist natürlich Voraussetzung. Ja.
Frau Langton: Da möchte ich einhaken. Das Recht auf Gesundheit, das ist immer so ein bisschen, wo ich so drüber stolpere - Haben wir das wirklich? Ja, ich meine, trotz aller Pränataldiagnostik die letzten 30 Jahre, trotz allem technischen Fortschritt. Die Perinatalstatistik hat sich nicht wahnsinnig groß verändert. Es hat sich vielleicht ein bisschen verschoben, dass jetzt doch mehr frühgeborene Kinder lebend zur Welt kommen als früher. Aber es werden trotzdem 3 % aller Kinder mit irgendeiner Art Fehlbildung geboren. Das ist einfach Tatsache. Und ich finde, manchmal wird den Frauen vielleicht suggeriert, vielleicht suggerieren sie sich auch selbst zu sagen ‚Wenn ich nur alles mache, dann geht alles glatt.‘ Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und was wir untersuchen können vorher und vorsorgen und früh erkennen können, sind bestimmte Dinge. Aber was das Leben einem sonst noch vor die Füße wirft, das sehe ich natürlich auch nicht in der Pränataldiagnostik, in der vorgeburtlichen Diagnostik. Was sonst noch auf uns zukommt. Und ich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass die Offenheit für ich nehme, wie es kommt, ein bisschen verloren geht, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich gegen alles im Vorfeld absichern, dass diese Offenheit dann verloren geht. Tatsächlich. Und so ein bisschen suggeriere ich den Frauen, die damit hadern und nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, schon sagen Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, an Gott zu glauben, an das Schicksal, das Karma, was auch immer.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, das ist die große Verantwortung, die wir als Ärzte oder auch Pränatalmediziner haben, dass wir den Familien oder den werdenden Eltern mitteilen, dass es auch bei einer scheinbar unauffälligen Familienanamnese ein Risiko gibt, dass Fehlbildungen auftreten können. 2 bis 3 %. Und es ist auch so was gibt wie Schicksal. Ja, da stimme ich Ihnen zu.
Stephan Wiegand: Zwei Wortmeldungen haben wir noch. Also einmal eine Hörerin hat uns die Frage gestellt und uns aufgefordert, so einen kleinen Perspektivwechsel mal einzugehen und mal zu analysieren Wie geht man als Arzt, als Ärztin mit einem Schwangerschaftsabbruch um? Hat man da Albträume? Gewissensbisse? Wie beschäftigt man sich damit? Und was ist es, was einem dann vielleicht auch zu Hause so begegnet, an Gedanken, an Ideen. Wie fasst man das in Worte? Gibt es da Teams, die das auffangen? Wie auch immer, das ist eine ziemlich umfangreiche Frage. Aber ich glaube, diese Perspektivwechsel erst mal ganz interessant. Und dann kommt noch eine Wortmeldung aus dem Publikum. Das machen wir nach der Beantwortung dieser Frage.
Konstantin Willkommen: Wer von Ihnen möchte darauf zuerst antworten?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ich selber mache keine Schwangerschaftsabbrüche, deswegen kann ich das aus eigener Erfahrung jetzt nicht beantworten, bin aber durchaus im Rahmen von humangenetischen Beratungen involviert in solche Gespräche, wo es am Ende dann darum geht, eine Schwangerschaft auch zu beenden. Und das ist immer eine schwierige Situation. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eigentlich ganz klar, weil zum Beispiel eine ganz schwere Erkrankung in der Familie vorliegt. Es gibt schon ein Kind, das ganz, ganz schwer erkrankt ist. Eine ganz kurze Lebenserwartung hat. Aber manchmal ist es eben nicht der Fall und das ist dann nicht so einfach, auch für einen selber. Das nimmt man dann auch mit nach Hause.
Stephan Wiegand: (...) Mein Herz schlägt ja nicht nur für das Publikum und für alle, die uns Fragen senden. Fragen mit Fragen konfrontieren, sondern auch für die Musik. Und deshalb ganz besonderen Dank an Joe Altinger und Patrick Neumann, die immer dieses Intermezzo zwischen reinlegen. Aber es gibt noch eine Wortmeldung, und die wollen wir niemandem vorenthalten.
Publikum: Entschuldigung, ich muss noch mal stören. Also so aus der tagtäglichen Arbeit heraus habe ich eher das Gefühl, dass es mir immer schwerer wird, den Frauen zu erklären. Willst du das wirklich wissen? Ja, es ist ja kein Problem, bei einer Synthese oder über einen NIPT rauszukriegen. Hat das Kind eine Klinefelter Syndrom. Die Menschen laufen unter uns rum. Die kriegen vielleicht keine oder können keine Kinder zeugen. Ja, und dann sage ich immer Überlegen Sie doch mal! Das Kind läuft dann rum und ist von Anfang an stigmatisiert. Wenn das Kind irgendein Problem hat, heißt es ist ‚ja kein Wunder, sind Klinefelter und Turner.‘ Ja, und dann sage ich immer ‚Wollen Sie das wirklich, dass Ihr Kind von Geburt an stigmatisiert ist? Das kann das Kind doch auch selber entscheiden, wenn es 18 Jahre ist, ob es das wissen will oder nicht.‘ Ich mache auch keine Diagnostik auf Huntington oder sowas mehr. Ja, weil ich finde, da haben die Kinder wirklich das Recht zu entscheiden, wenn sie 18 sind, volljährig sind, ob sie das wirklich wissen wollen? Ja, und das andere? Da muss ich Frau Kirsch recht geben, auch wir als Ärzte. Im Moment ist es gerade bei mir in der Praxis jedenfalls wieder so Es gibt ganz, ganz viele Probleme. Und glauben Sie nicht, dass wir als Ärzte uns danach sehnen, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Und ich gehe seit einer Woche abends depressiv nach Hause, weil so viele schlimme Sachen auflaufen, die uns auch nachts umtreiben. Also wir machen das alle nicht aus Spaß. Also wir nehmen das alle mit nach Hause.
Stephan Wiegand: Vielen Dank.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Ich würde vielleicht noch gerne zwei Sachen ergänzen. Das eine ist, was Sie angesprochen haben mit Huntington wäre ja eine prädiktive Diagnostik. Und das regelt ja das Gendiagnostikgesetz, dass eine prädiktive Diagnostik, also die Frage ‚tritt eine genetisch bedingte Erkrankung im Erwachsenenalter auf‘, die kann ich bei einem Kind nicht klären, sondern da muss ich warten, bis dieses Kind einwilligungsfähig ist, also mindestens 16 oder älter. Aber die andere Situation ist die, dass eine Frau eine wie auch immer geartete ein NIPT macht oder eine andere vorgeburtliche Diagnostik. Und dann kommt vielleicht ein Turner raus oder ein Klinefelter. Das ist dann die schwierige Situation und ich glaube, das kommt dann vom Beratungskontext ab. Also ich persönlich finde es ganz schwierig, einer Frau zu sagen, ihr Kind ist deswegen weniger lebenswert oder das ist eine ganz schwierige Situation, sondern ich versuche dann ganz sachlich über alle Folgen oder Erscheinungen, die ein Kind mit einem Klinefelter oder eine Turner sind und das sind Kinder oder Mädchen oder Jungen, die eigentlich ein komplett normales Leben führen können, gewisse Einschränkungen haben und hoffe dann, dass diese Frau oder dieses Paar die für sich am besten funktionierende Entscheidung treffen kann. Aber ich finde, das ist ein Beispiel, wo ich es persönlich sehr, sehr schwer finde, eine Beratung zu machen und das Paar dabei zu begleiten. Ja.
Katharina Langton: Ja, ich möchte darauf noch mal eingehen, weil ich das aus der Hebammenpraxis so sehe. Es ist ja so die Frauen kommen, sind schwanger, gerade zu Hause vielleicht getestet, sind froh in der Regel darüber, kommen in die Praxis, lassen sich die Schwangerschaft bestätigen per Ultraschall und diverse Untersuchungen, die dann gemacht werden. Blutuntersuchung. Und dann ist natürlich für die ersten ersten Zyklus Pränataldiagnostik nicht mehr viel Zeit. Die kommen so 7. 08. Schwangerschaftswoche in der Regel, wo man es dann auch gut per Ultraschall sehen kann und sofort nach dem Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger kommt dann und hier haben Sie eine Broschüre. Jetzt geht es los. Wollen Sie Pränataldiagnostik? Ja. Nein. Und entscheiden Sie sich mal bitte jetzt, weil Sie brauchen einen Termin, denn in vier Wochen ist die Zeit rum. Und das finde ich persönlich einen ganz, ganz schwierigen Kontext, auch in der Beratung. Ja, man möchte fast sagen Bitte überlegt euch das, bevor ihr schwanger werdet, was ihr dann damit macht. Aber das ist natürlich Wunschdenken. Aber das ist so eine Schwierigkeit, die ich in meiner Arbeit auch oft gesehen habe. Dieser Konflikt, den die Frauen sagen zwischen Freude und dann könnte gleich was schief gehen.
Bernd Kreissig: Aber eigentlich gehört es schon in den Schulunterricht, würde ich sagen.
Frau Langton: Zumindest in der Entwicklung, die das in die rasante Entwicklung, die es in den letzten Jahren genommen hat, machen das sicherlich erforderlich. Dass ich da noch mal auf anderem Wege drüber Gedanken zu machen. Tatsächlich.
Konstantin Willkommen: Wie reflektieren denn dann die werdenden Mütter ihre Entscheidung für oder gegen die Diagnostik?
Frau Langton: Viele entscheiden sich für eine bestimmte Form von Pränataldiagnostik. Das heißt eine weite Palette, was Pränataldiagnostik alles impliziert. Es gab mal eine Zeit, da waren eigentlich fast alle Frauen in irgendeiner Form im Ersttrimesterscreening, Nackenfaltenmessung etc. was es da alles gab drin. In den letzten Jahren habe ich doch wieder mehr Rückmeldungen bekommen, die sagen na ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es doch lieber nicht gemacht. Dann war ich doch in der Spirale. Mein Kind war ja am Ende doch gesund. Aber die Freude über die Schwangerschaft, die war doch deutlich gedämpft. Immer die Sorge, es könnte doch was sein, wenn es das nicht ist, was Sie festgestellt haben. Aber vielleicht gibt es ja was anderes, was noch keiner gefunden hat. Also dieses Bewusstsein. Es könnte doch was nicht in Ordnung sein. Das war dann deutlich mehr verankert und es ist in meiner Beobachtung leichter gewesen für Frauen, die einfach gesagt haben Ich möchte das nicht alles. Ich bin froh, dass ich schwanger bin. Ich nehme es, wie es kommt. Die dann weniger gehadert haben.
Konstantin Willkommen: Erleben Sie das im klinischen Alltag auch so, dass mitunter Paare kommen und sagen. Hätte ich es doch nicht gemacht?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Also eher nicht so aber vielleicht auch, weil wir oder weil ich vor allen Dingen eher es mit Paaren zu tun habe, die eigentlich eine Vorgeschichte haben, wo es eben wo in der Familie schwer betroffene Kinder mit Erkrankungen da sind. Das sind so die Familien, die ich sehe. Und daher ist das, glaube ich, ein ganz anderes Klientel. Aber in dem Zusammenhang möchte ich auch sagen Es ist Gott sei Dank nicht nur so, dass wir nach Hause gehen mit einem sehr schweren Herzen, weil wir solche Entscheidungen mit begleiten müssen. Sondern es ist ganz toll, wenn wir Eltern sagen können Die vorgeburtliche Diagnostik hat ergeben, dass ihr Kind nicht von dieser schweren Erkrankung betroffen ist. Und das ist etwas, wo man wirklich dann auch mit den Eltern glücklich ist, diesen Glücksmoment, wenn die einfach vor Freude weinen, miterlebt. Und das ist auch mal was sehr Positives. Es gibt Gott sei Dank auch wirklich positive Erfahrungen in diesem Zusammenhang.
Stephan Wiegand: Wir hätten natürlich, bevor die Musik wieder uns ins Wort fällt, hätten wir natürlich noch eine Publikumsfrage. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen, aber wir versuchen das. Mal eine Frage an Professor Lee-Kirsch. Gerne an alle Vergleiche Präimplantationsdiagnostik von Embryonen, Untersuchungen vor Schwangerschaft von beiden Partnern in Deutschland versus Israel, Tschechien. Ist diese Diagnostik sinnvoll bei genetischen Störungen?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Also die Präimplantationsdiagnostik bedeutet, dass sozusagen in einem in vitro gezeugten Embryo, Zellen entnommen werden und dann auf eine genetische Erkrankung untersucht wird. Das ist in Deutschland nur unter ganz besonderen Bedingungen möglich. Und zwar nur dann, wenn eine sehr schwerwiegende Erkrankung vorliegt und auch welcher Art diese Erkrankung ist. Das ist gar nicht gesetzgeberisch definiert. Aber es erfordert, wenn eine Familie, ein Paar, das anstrebt, dass eine Ethikkommission zu Rate gezogen wird, für den individuellen Fall und das entscheidet. Das ist also ein langer Prozess, auch natürlich eine Beratung des Paares ist damit eingeschlossen. Und wenn es denn dann entschieden wird, dass das möglich ist, dann muss das Paar auch den Weg einer künstlichen Befruchtung gehen, der ja auch ein sehr harter und langer Weg ist. Aber grundsätzlich ist es möglich in Deutschland.
Stephan Wiegand: Eine weitere Frage haben wir noch geistlicher Natur - kommt der Pfarrer zum Einsatz. Im christlichen Glauben sprechen wir auch von der Seele eines Menschen, die jeweils unterschiedlich und individuell an eine Person gebunden ist. Ist mit der Befruchtung und ersten Zellteilung des Fötus/Embryo beseelt?
Bernd Kreissig: Der Begriff der Seele, der ist so ein bisschen, ich sage es mal, korrumpiert durch das, was so in Comics und Trashmovies kommt, dass es dann irgendwie von einem Menschen so eine Art blauer Nebel und das ist dann, was seine Essenz ausmacht. Das ist tatsächlich gar nicht die biblische Sicht auf das Wort Seele, sondern In der Bibel ist mit Seele das gesamte Leben eines Menschen bezeichnet. Sein Sein, auch sein durchaus körperliches Sein. Und das da kann man sagen, ja, das beginnt natürlich spätestens, vielleicht aber auch schon vorher mit dem Verschmelzen von Spermium und Eizelle. Ja, das ist nicht die gleiche Seinsform, die wir jetzt haben, mit schon entwickeltem Gehirnbewusstsein, aber in biblischer Sicht 100 % da und gleichwertig.
Stephan Wiegand: Gibt es Erfahrungen, ab wann ein Embryo Schmerz empfindet?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich sehe gerade, dass der Kollege da vielleicht was sagen kann.
Stephan Wiegand: Da bin ich natürlich gleich zur Stelle.
Publikum: Ja, also es ist schwierig. Also hören Geht man davon aus, dass ein Embryo so ab der 22 24. Schwangerschaftswoche kann? Ja. Das Problem ist, dass die Neuronen so wenig miteinander vernetzt sind, dass das Kind zwar das hört, aber wenn du fünf Minuten später ihm dasselbe vorspielst, das wieder neu ist. Also es kann sich nicht merken bis zur Geburt. Und so wie mit dem Hören geht man eigentlich auch mit dem Schmerz aus, so dass das so um die 22.- 24. Wochen Schmerzempfinden entwickelt, weil dann die Neuronen in der Lage sind, das überhaupt zu verarbeiten.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Genau. Voraussetzung für eine Schmerzempfindung ist auf jeden Fall, dass das Nervensystem einen gewissen Grad der Ausbildung abgeschlossen haben muss. Und das muss kann erst in der späteren fetalen Entwicklung der Fall sein. Aber wann genau das ist, da bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt.
Konstantin Willkommen: (...) Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Ausflug in ein weiteres Thema des Lebens. Etwas weg vom Menschen, hin in die Forschung. Denn Zellen leben ja auch und an denen wird fleißig geforscht. Stammzellen sind da ein Stichwort. Wer entscheidet eigentlich auch da, was wir damit anstellen. Sind Sie da völlig frei in dem, was Sie tun?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Nein. Auch das ist geregelt durch das Embryonenschutzgesetz. Zum Beispiel, dass Embryonen nicht hergestellt werden dürfen zum Zwecke der Forschung, um überzählige Embryonen zu verwenden, um Stammzellen zu generieren. Und das ist auch gut so! Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte schon existierende Zelllinien, die immer wieder propagiert werden, die man für die Forschung einsetzt. Und es gibt auch Techniken, mit denen man in vitro in der Petrischale sozusagen aus einer, zum Beispiel aus einer Hautzelle oder auch aus einer Blutzelle, die ja in ein Terminal differenziert ist, wie wir so schön sagen. Die kann man wieder rückgängig machen in eine pluripotente Zelle und dann wieder umdifferenzieren. Also das ist technisch möglich und auch gut, weil man dann Dinge erforschen kann, die Erkenntnisse bringen, die dem Menschen wieder zugutekommen.
Konstantin Willkommen: Ja, das klingt ganz schön faszinierend. Also ist es sozusagen möglich, aus jeglicher Zelle, die man mir entnehmen könnte, wieder ein neues Leben zu schaffen. Bin ich dann für meine Fortpflanzung gar nicht mehr nötig?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Technisch sind wir, glaube ich, fast soweit - ist das möglich. Aber das ist natürlich nicht das, was wir in der Forschung. Wenn ich sage, wir generieren solche pluripotenten Stammzellen dann nicht zum Zweck, einen neuen Menschen zu zeugen. Aber ich glaube, dass wir im Prinzip technisch fast so weit sind, dass wir das können. Sondern da geht es darum, möglichst viel zu lernen über Zellen, über Zelltypen, an die man sonst nicht rankommt, zum Beispiel Gehirnzellen. Wenn Sie erforschen wollen, wie funktioniert Alzheimer oder was funktioniert nicht bei Alzheimer oder bei Multipler Sklerose, dann ist es manchmal gut, Neuronen zu haben oder andere Zellen des Gehirns, mit denen man forschen kann. Und das In vitro zu tun geht eben nur, wenn man solche pluripotenten Stammzellen umwandelt. Deswegen ist das zum Beispiel eine Technologie, die sehr wichtig ist für den wissenschaftlichen Fortschritt. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich in vitro einen Menschen erzeuge.
Konstantin Willkommen: Noch nicht.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Nein.
Konstantin Willkommen: Wäre das dann trotzdem so der Horizont, auf den wir uns zubewegen, dass wir dann den ganzen Diskurs, den wir am Anfang des Abends hatten, die Konflikte, die mit der Entstehung vom Leben verbunden sind, dass wir das irgendwann ausschalten können.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Nein. Aber ein anderes Beispiel gab es ja jetzt auch in der Presse dass man künstlich Fleisch herstellt mithilfe von solchen Zellen. Das sind alles Zukunftsperspektiven, die real sind und die irgendwie oder irgendwann auch mal umgesetzt werden, vielleicht auch in industrieller Form. Und das ist natürlich schon eine bisschen gruselige Vorstellung. Auf der anderen Seite kann man auch solche Fortschritte natürlich positiv werten und nutzen, zum Beispiel für die Ernährung. Oder Menschen, die sonst keinen Zugang haben zu solchen Nahrungsmitteln.
Konstantin Willkommen: Wir alle, die wir jetzt hier zuhören, haben das verstanden. Und in unserem Bewusstsein könnten wir jetzt unsere Haare abgeben. Aber andere Lebewesen können das nicht, die wir auch für die Forschung verwenden. Wenn Fische reden könnten, was würden die wohl dazu sagen, dass wir mitunter von ihnen Gewebe entnehmen, um dann in der Petrischale Steaks zu züchten?
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Das ist eine schwierige Frage und sicherlich auch ein kontroverses Thema. Tierversuche. Auch hier sieht der Gesetzgeber vor, und zwar sehr streng vor, dass Tierversuche nicht jeder und ohne Weiteres machen kann, sondern jeder Tierversuch, der zum Beispiel bei uns im Uniklinikum und in Forschungsinstituten durchgeführt wird, muss vorher beantragt werden. Das heißt, es wird geprüft, Was genau mache ich? Wie viele Tiere werden gebraucht? Ist es wirklich nötig, dass man so viele Tiere braucht? Und das ist letztlich auch gut so, aber was ein Fisch oder eine Maus empfindet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Bernd Kreissig: Nun ist das menschliche Leben aber grundsätzlich damit verbunden, dass wir dauernd die großen und kleinen Dilemmata haben und uns entscheiden müssen Zwischen dem kleineren Übel, die wir hier heute gutwillig sitzen, verbrauchen wahrscheinlich eine ganze Reihe von Ressourcen, die in anderen Ländern der Welt schon wieder direkt oder indirekt zu Leid führen können. Und dem kann man nie ganz ausweichen. Und ich glaube, das ist jetzt die Frage, die da auch so ein bisschen hineinreicht. Da ist es, glaube ich, einfach wichtig, zumindest das zu wissen und zu sagen, dass es unsere Verantwortung ist, das daraus entstehende Leid oder schlechte Dinge zu minimieren. Wir werden das nicht ganz. Wir werden das nie ganz vermeiden können. Aber uns der Verantwortung bewusst zu sein und damit möglichst gut umzugehen. Ich glaube, das ist die Aufgabe dann von denjenigen, die die gesetzlichen Regelungen schaffen, die die entsprechenden Forschungen durchführen, das eben nie aus dem Blick zu verlieren. Und da ist das Tierwohl letztlich auch ein Faktor, der auf jeden Fall zu berücksichtigen ist. Und da lernen wir noch und sind aber auch schon besser geworden. In den letzten Jahren schon. Noch lange nicht da, wo ich glaube, wo wir sein sollten. Aber auch das ist besser geworden.
Konstantin Willkommen: Das wäre jetzt meine angeschlossene Frage gewesen, wie Sie das sehen, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen oder ob wir vielleicht schon unsere Schöpfungskompetenz überschritten haben.
Bernd Kreissig: Ich glaube, wir lernen dazu. Wir wissen inzwischen auch mehr darüber, was zum Beispiel Tiere auch fühlen, was sie erleben können. Dann gab es, solange diese Klassen, was weiß ich, nur höhere Säuge- und Wirbeltiere sind irgendwie relevant. Und jeder, der mal im Aquarium vor seinem Oktopus gestanden hat und sich auch nur zehn Minuten Zeit genommen hat, mit dem zu interagieren, der weiß, dass das nicht hinkommt. Und da werden wir peu a peu besser. Und es ist gut, dass sich Menschen dafür einsetzen. Aber auch das ist ein Prozess. Da sind wir im Werden.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten einfach unerlässlich, dass auch Tierversuche gemacht werden, weil wahrscheinlich keiner von uns hier würde sagen ich probiere jetzt mal irgendeine Substanz aus und guck mal, ob die irgendwelche schweren Nebenwirkungen macht. Und das muss aber natürlich in einer regulierten, kontrollierten Form erfolgen. Und im Übrigen gehört auch zu einem Versuchstier-Antrag, dass man begründet, wenn man Eingriffe macht, die mit Schmerzen für das Tier verbunden sind, irgendwelche invasiven Eingriffe, dass man das gut wissenschaftlich begründet, warum die notwendig sind oder ob die überhaupt notwendig sind und dass man eben alles an alternativen Möglichkeiten ausschöpft. Aber gerade wenn es um die Testung von Substanzen geht, die dann später mal in die Medikamentenentwicklung eingehen, also in ganz frühen Stadien, da sind Tierversuche letztlich unerlässlich, weil man nicht alles nur in vitro in einer Zellkultur untersuchen kann.
Konstantin Willkommen: (...) Leider sind wir jetzt nun schon zum Ende des heutigen Abends gekommen. Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Worte des Dankes aussprechen. Zum einen an das COSMOkrei Wissenschaftsforum, die Städtischen Bibliotheken der Stadt Dresden, die Sächsische Zeitung, die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus und natürlich die TU Dresden, die dieses Format hier ermöglicht hat. Ganz besonders natürlich auch Dank an unsere Gäste heute hier, die sich den Fragen gestellt haben. Wir danken auch allen, die Fragen gestellt haben, die uns die Fragen eingeschickt haben. Wir danken den Antwortenden. Wir danken dem guten Johannes von den Ballroom Studios, der hier das Ganze technisch möglich gemacht hat. Ich danke Nora Linn Schwerdtner, Doreen Pretze und Stephan Wiegand, die sich das ganze Format ausgedacht haben und uns alle hier versammelt haben, um hier Fragen zu stellen, gestellt zu bekommen und nach Antworten zu suchen. Natürlich, es gibt keine richtigen, keine falschen Fragen. Ein zentraler Aspekt der Wissenschaft ist aber, immer wieder neue Fragen zu suchen, denn die können uns irgendwann vielleicht auf die richtigen Antworten leiten. Und als Schlusswort möchte ich jetzt gerne unseren Gästen auch noch mal die Möglichkeit geben, nachdem sie die ganze Zeit geantwortet haben, eine Frage zu stellen. Die Antwort darauf darf dann jeder gerne mit nach Hause nehmen und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle wiedersehen oder wiederhören bei unserer nächsten Folge im Februar.
Frau Langton: Ja, eine Frage, die sich mir stellt, die sich ergeben hat aus einer Publikumsfrage Wie viel will man wissen?
Bernd Kreissig: Der berühmte Theologe und Mediziner Albert Schweitzer hat einmal formuliert ‚Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will.‘ Und hat daraus eine Ethik, der Respekt vor dem Leben entwickelt. Und meine Frage an Sie alle lautet ‚Was fällt Ihnen ein, wo vielleicht auch wir als Kirchen besser darin werden können, Menschen in diesem gelebten Respekt vor dem Leben zu unterstützen, in den Dilemmata, in die sie dann auch reinlaufen?‘ Und schreiben Sie mir Sagen Sie es uns, es wird uns erreichen.
Professorin Mina Ae Lee-Kirsch: Mir würde vielleicht noch einfallen, dass ich glaube, in der Wissenschaft gibt es so viele Fortschritte, so viele Veränderungen auf einer sehr schnellen Weise. Und wenn Sie Fragen haben, dass Sie sich jederzeit an uns wenden können, Es ist einfach wichtig, dass man miteinander redet und sich gegenseitig informiert.
Konstantin Willkommen: In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fragt nach.
Give us your feedback - simply, quickly and anonymously.
Here are a few impressions of our first event.

© André Wirsig

Musikalische Unterstützung durch Patrick Neumann und Jo Aldinger © André Wirsig

v.l.n.r. Moderator: Konstantin Willkommen, Referentin Katharina Langton und Referent Bernd Kreissig © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen und Referentin Katharina Langton © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

© André Wirsig

Referentin Katharina Langton © André Wirsig

Referent Bernd Kreissig © André Wirsig

Referentin Min Ae Lee-Kirsch © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Organisator Stephan Wiegand © André Wirsig
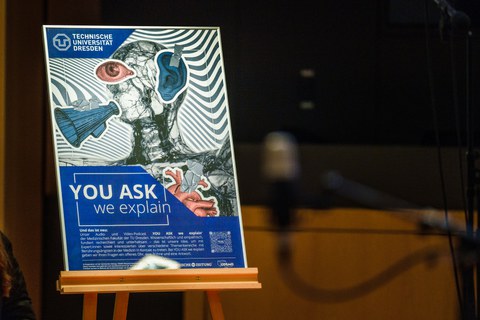
© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Referentin Katharina Langton © André Wirsig

Referent Bernd Kreissig © André Wirsig

Referent Bernd Kreissig und Referentin Min Ae Lee-Kirsch © André Wirsig

© André Wirsig

Referentin Katharina Langton © André Wirsig

© André Wirsig

Organisator Stephan Wiegand © André Wirsig

Referentin Min Ae Lee-Kirsch © André Wirsig

© André Wirsig

Referentin Min Ae Lee-Kirsch © André Wirsig

© André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Musikalische Unterstützung durch Jo Aldinger © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Referent Bernd Kreissig © André Wirsig

Referent Bernd Kreissig © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig
When: 18.01.2023, 17:00 h
Where: Kulturpalast Dresden, red stage in the foyer
Our Advisors:
- Katharina Langton - Head of the "Midwifery" degree program at the Carl Gustav Carus Faculty of Medicine
© TUD
Prof. Dr. med. Min Ae Lee-Kirsch - Molecular Genetic Diagnostics at the University Hospital Carl Gustav Carus
© Bernd Kreissig
Bernd Kreissig - Pastor of the parish of Edingen
Moderator:
© TUD
Konstantin Willkommen - Graduate of the Carl Gustav Carus Faculty of Medicine
Musical accompaniment:
- Jo Aldinger jochenaldinger.de
- and Patrick Neumann www.patrickneumann.net
This project is funded by the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF) and the Free State of Saxony as part of the Excellence Strategy of the
Federal and State governments.



































