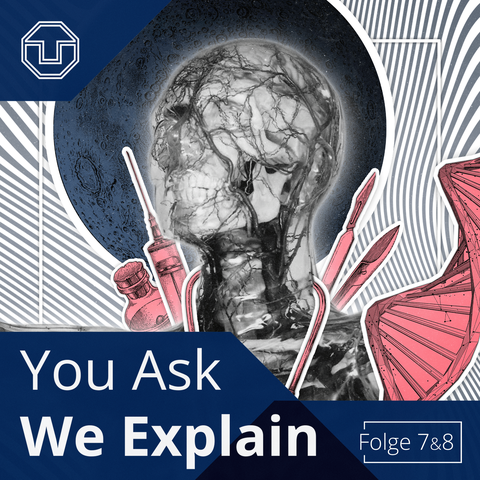30.06.2023
Folge 07: Was macht Wissenschaft mit der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft mit der Wissenschaft
Unsere Podcastreihe you ask we explain - Berührungsängste in der Medizin ist im Januar gestartet und erscheint monatlich. In der 7. Folge auf der Langen Nacht der Wissenschaften diskutierten wir über das Thema: Was macht Wissenschaft mit der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft mit der Wissenschaft
Wir wollten mit Ihnen diskutieren und Ihre Fragen beantworten. Sie hatten keine Zeit dabei zu sein? Kein Problem: Hören Sie sich unseren Podcast einfach von unterwegs an - bei Spotify, Apple Music, Deezer oder hier.
Stephan Wiegand: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem COSMO Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden.
Ines Meinhardt: (...) Joe Aldinger und Patrick Neumann, waren das für Sie, begleiten uns heute durch den Abend und wir haben schon festgestellt, Sie sind hier mit dem akademischen Viertel Verspätung angekommen. Und das passt ja heute zur Langen Nacht der Wissenschaften. Dresden ist sowieso ein bisschen spät dran. In Chemnitz hat die Technische Universität Anfang Juni ihre lange Nacht durchgeführt, in Leipzig war es vor einer Woche, Dresden also heute. Natürlich kommt zum Schluss immer das Beste. Wir haben noch ein bisschen Regen bestellt vorhin. Damit alle wissen hier drin ist es viel schöner als draußen. Und wir kommen jetzt in einer halben Stunde ins Gespräch mit dem Oberbürgermeister und geballten Wissen. Wir haben hier sechsmal den Titel Professor Doktor dabei. Das heißt, Sie wissen, was es für eine Herausforderung sein wird, in 30 Minuten durch diesen Zeitplan zu kommen. Wir bemühen uns, haben aber gesagt: Wenn es mal eine Minute drüber ist, es ist Freitagabend, wir sind alle entspannt. Unsere Fragestellung ist ‚Wie verändert Wissenschaft Gesellschaft und wie verändert Gesellschaft Wissenschaft.‘ Ich bin Ines Meinhardt. Bringen Sie jetzt durch die nächste halbe Stunde. Und mit dem Oberbürgermeister würde ich gerne beginnen. Sie sind ein großer Unterstützer dieser Idee. Wo liegt denn eigentlich bei der Wissenschaft Ihre Stärke?
Oberbürgermeister: Stephan Wiegand: Meine Stärke bei der Wissenschaft oder die Stärke der Wissenschaft für mich?
Ines Meinhardt: Suchen Sie sich was aus. Suchen Sie sich was, was besser passt.
Stephan Wiegand: Nein. Also, wenn man die Stärken unserer Wissenschaft anschaut, das ist so vielgestaltig von den Materialwissenschaften bis eben hin zu den Geisteswissenschaften. Ich glaube, die Besonderheit hier in der Region ist wirklich die Vielgestaltigkeit und die Breite, Tiefe und die Exzellenz, die wir haben. Und selbst ist man, bin ich, eher in zwei Technologiedisziplinen zu Hause gewesen, einmal in der Elektrotechnik und zum Zweiten in der Luftfahrt, wenn man so seinen eigenen Werdegang anschaut.
Ines Meinhardt: Genau. Sie haben ja an der Technischen Universität studiert. Warum haben Sie sich damals für diese Uni entschieden. #00:02:55‑8#
Stephan Wiegand: Weil sie eine tolle Universität ist. In meiner Heimatstadt.
Ines Meinhardt: Schon in den Neunzigern, ja?
Stephan Wiegand: Ja, in den Neunzigern genau. Also man hat ja den Werdegang einer Ostbiografie gehabt und da ist erst mal der Weg in die Lehre gegangen und dann das Abitur auf der Abendschule dann nachgeholt. Und dann war man eben jung genug gewesen und der Weg stand frei, noch mal völlig neu zu starten. Und da kam die gerade frisch aufgebaute oder im Aufbau befindliche Fakultät Wirtschaftswissenschaften gerade recht in der Kombination. Und das hat mich angepisert gehabt zwischen Betriebswirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite den technischen Disziplinen und damit das Wirtschaftsingenieurwesen als Studiendisziplin. Und das hat ich für mich genau die Interessen getroffen, die mir liegen. Und insoweit kann ich auch heute rückwirkend sagen Es war die richtige Entscheidung.
Ines Meinhardt: 20 Jahre lange Nacht der Wissenschaften. Was war für Sie in dieser Zeit ein Höhepunkt? Oder wo sagen Sie vielleicht auch Wir sind noch nicht am Ende. Uns fehlt noch was.
Stephan Wiegand: Ach, wir dürfen nie am Ende sein. So bleibt mehr stehen. Und so sieht man ja, wie engagiert alle Einrichtungen mitmachen. Und das ist wirklich das Faszinierende jedes Jahr wieder. Da kann man, egal in welche Institutionen kommen, das ist wirklich beeindruckend, wie über Tage, Wochen da vorbereitet und getüftelt wird, um wirklich die Dresdnerinnen und Dresdner zu begeistern in der Nacht und insbesondere und das glaube ich, macht eine riesige Faszination mittlerweile aus für alle Altersgruppen. Wahnsinnig viele Programme für die Familie, für die Kinder. Mittlerweile sehr, sehr viele Programme, die auch englischsprachig sind, sodass wirklich alle angesprochen werden in der Stadtgesellschaft. Das ist schon toll. Aber wenn man mein Highlight vielleicht sagt, dann war ein besonderes Jahr natürlich das Jahr 2006 gewesen, als wir Stadt der Wissenschaften waren. Und da noch mal besondere Formate, gerade wenn ich an das Abschlussfest Stadt der Wissenschaften im Dresdner Schloss zurückdenke, wo Tausende, wenn man aus dem Schloss rausguckten, auf dem Theaterplatz standen, um reinkommen zu können in die Räumlichkeiten und dann ein Teil des Ganzen sein. Das war schon Gänsehautfeeling.
Ines Meinhardt: Vielen Dank. Wir kommen jetzt vom ehemaligen Studenten zur jetzigen Rektorin der Technischen Universität. Professorin für Psychologie ist sie Professorin für Interdisziplinäre Alternswissenschaft Professorin Ursula Staudinger. Seit 2020 ist das Ihr Bereich. Sie haben sich auch vorgenommen, die Kommunikation, die wissenschaftliche, in die Stadtgesellschaft zu tragen. Wie ist Ihnen das bisher gelungen?
Ursula M. Staudinger: Also wir sind ja als die größte Arbeitgeberin in der Stadt, da kabbeln wir uns immer noch ein bisschen mit der Stadt Dresden und drittgrößte in Sachsen, einfach eine gesellschaftliche Akteurin, die zu den wesentlichen Herausforderungen unserer Gesellschaft Stellung nehmen möchte. Und wir haben verschiedene Formate entwickelt. TUD im Dialog oder TUDlectures, wo wir die großen Themen, die gerade anstehen, aufgreifen. Zum Beispiel regelmäßig während der Pandemie, haben wir informiert über die neuesten Erkenntnisse zu Covid in interaktiven Formaten. Wir haben auch in der Lausitz jetzt Verantwortung übernommen. Es gibt jetzt einen TUDcampus Lausitz, wo wir auch über Wissensvermittlungsprozesse uns mit der Bevölkerung in Verbindung setzen, wo wir mithilfe der Strukturwandel, Investitionen des Bundes einzigartige Forschungsinfrastruktur auf die Beine stellen für die Mobilität der Zukunft, für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft, damit wir ressourcenschonend weiter produktiv sein können und natürlich auch durch eines der Großforschungszentren für Astrophysik, Digitalisierung und Technologie. Das sind einfach drei ganz tolle Projekte. Und da versuchen wir auch mit den Bürgern und Bürgerinnen und vor allem mit der Jugend auch in Kontakt zu kommen, um sie dafür zu begeistern und dann hoffentlich auch in der Lausitz zu bleiben oder vielleicht sogar zurückzukommen.
Ines Meinhardt: Sie haben ja mehrere Jahre auch im Ausland gelebt und gearbeitet. Wenn man die Zeit des Forschens auch vergleicht, Gesellschaft und Wissenschaft, wie das aufeinander Einfluss nimmt, gibt es da Unterschiede in den verschiedenen Ländern? Oder auch Unterschiede, wenn Sie die vergangenen Jahre betrachten.
Ursula M. Staudinger: Es gibt natürlich grundlegende Unterschiede, vor allem zwischen den USA und Deutschland oder Europa, weil die Wissenschaft und Hochschulbildung in Deutschland in Europa völlig anders organisiert ist und weniger ökonomisiert. Wir leisten es uns als Gemeinwesen, Hochschulbildung frei anzubieten. In Amerika ist das nicht der Fall. Dort muss für alles bezahlt werden. Und diese Ökonomisierung beeinflusst natürlich auch die Forschung und beeinflusst auch die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Dort erscheint mir die Politisierung und die Abhängigkeit stärker als bei uns. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist die Freiheit von Lehre und Forschung nicht nur aufs Papier geschrieben, sondern nach wie vor auch gelebte Tatsache und Grundlagenforschung, die nicht primär daraus erwächst, dass ich etwas reparieren möchte, was in der Realität existiert, existiert bei uns. Und genau aus dieser Grundlagenforschung kommen dann die ganz überraschenden Dinge. Also beispielsweise wenige Menschen wissen es, dass durch die optischen Bedarfe in der Astrophysik und den Teleskopen der Astrophysik haben wir unsere Gleitsichtbrillen bekommen, sonst hätten wir die nicht. Das sind so Kleinigkeiten, über die man meistens gar nicht Bescheid weiß. Also die Grundlagenforschung, die existiert bei uns in Deutschland und ich denke, über die Jahre hat sich auch berechtigterweise das Auskunftsinteresse oder der Bedarf der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen erhöht, sodass Sie gerne wissen möchten, was passiert mit dieser Investition in Hochschulen in Forschungsinstitutionen? Und dem kommen wir aber auch sehr gerne nach. Und wir geben Auskunft. Und wir bleiben im Gespräch, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, ganz besonders in diese Zukunftskraft unserer Gehirne zu investieren.
Ines Meinhardt: Wir haben ja viele Forschungseinrichtungen in der Stadt. Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie mit anderen Bereichen in Sachsen auch zusammenarbeiten. Welchen Vorteil ziehen Sie daraus als Universität, dass es so viele Forschungseinrichtungen gibt, die hier nah beieinander sind?
Ursula M. Staudinger: Also ich bin ja nun vor zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, jetzt hier nach Dresden gekommen, und ich kann sagen, es ist eine einzigartige Verdichtung von Wissenschaft und Forschung in und um Dresden und vorbereitet durch sehr zielstrebige Investitionen in den 90er Jahren, die zur Ansiedlung von Industrie und dann aber auch zur Ansiedlung von Groß Forschungsinstitutionen wie Max Planck und Helmholtz und Leibniz führten. Und in der Wechselwirkung mit diesen Partnerinstitutionen. Wir haben uns ja zusammengetan in einem Verein, was die Deutschen ja gerne machen. Wir sind 36 Institutionen, die sich mit Forschung beschäftigen und fast 12.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier am Standort Dresden. Und das ist eine enorme Stärke. Ich glaube, wir hätten als TU Dresden alleine diesen Exzellenzwettbewerb jetzt ja schon zweimal überstanden. Wir hatten letztes Jahr zehn Jahre zehnjähriges Jubiläum. Exzellenzuniversität. Alleine hätten wir es nicht geschafft. Es geht gemeinsam. Es ist das Gemeinsame.
Ines Meinhardt: Und damit haben wir ja einen guten Übergang, sozusagen zu Professor Albrecht, Universitätsklinikum, dort der medizinische Vorstand. Herr Albrecht, Ihnen ist immer noch die Pandemie und das, was danach für uns alle als Aufgabe steht, wichtig. Nun gibt es ja viele Menschen, die sagen Nein, bitte nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum sagen Sie, es ist eine Chance, diese Aufarbeitung jetzt zu beginnen?
Michael Albrecht: Na, hören kann ich es eigentlich auch nicht mehr, aber es war einfach meine erste Pandemie. Ich glaube, das geht hier jedem so und ich stelle bei mir selber, ich muss auch schon immer nachschauen und bei den anderen noch mehr fest, dass man eigentlich nicht mehr ganz genau weiß, Wie ging es denn los? Was? Was ist gemacht worden? Und ich denke, wenn wir jetzt den Fehler machen und das Ganze einfach schnell vergessen, weil wir es vergessen wollen, dann haben wir das Problem, dass wenn die nächste Problematik auftritt und sie wird wieder auftreten, ob ich es jetzt noch mal erlebe oder ob es sehr rasch geht und wir ganz schnell wieder in eine ähnliche Situation kommen, weiß keiner. Und ich denke, da sollten wir besser gerüstet sein, als wir das da waren. Am 23. Januar, das wissen viele nicht mehr, ist Wuhan, eine der größten chinesischen Städte, abgeriegelt worden und wir haben ein paar Tagesschau Bilder gehabt. Und ich kann mich da an Sitzungen bei uns erinnern, wo jeder dachte Na, komm es ist weit weg, Da haben wir nichts damit zu tun. Lass das mal! Was da in China ist und und keine vier Wochen später waren die Probleme hier. Und ich würde mal ganz klar sagen, vorbereitet war niemand. Politisch waren wir nicht vorbereitet. Wir waren gesellschaftlich nicht vorbereitet und wir waren im Gesundheitssystem nicht vorbereitet. Und jetzt eigentlich wieder noch mal so ein Parforceritt machen. Ich glaube immer noch, wir haben es toll gemacht und viele enge Kontakte mit all unseren Wissenschaftspartnern, aber eben vor allen Dingen der Zeit, der Stadt, der Politik, dem Gesundheitsamt und und und. Aber ich möchte ehrlicherweise nicht wieder unvorbereitet in so eine Situation kommen.
Ines Meinhardt: Wenn Sie es vergleichen Wir haben ja auch viele Wirtschaftskrisen inzwischen auch erlebt. Die möchte auch keiner mehr hören. Vor allem möchte sie keiner erleben. Wenn Sie es ins Verhältnis setzen, so eine Pandemie und so eine Wirtschaftskrise, wie würden Sie es gewichten?
Michael Albrecht: Also für mich, und das ist jetzt eine persönliche Interpretation wenn ich mal nur aufs Gesundheitssystem schaue, war das ein Verstärker aller schlechten Eigenschaften des Systems, das wir haben. Das kann man sich dadurch besichtigen, Deswegen kann man so viel lernen. Ich glaube aber auch, dass eine Menge an gesellschaftlichen Folgen übrig geblieben sind. Noch jetzt. Also jeder merkt es auch noch tagsüber und in seinem persönlichen Umfeld, die wir nicht zuordnen. Also ich meine Isolation, Masken tragen, Abstand halten, andere Denkweisen sind negative Auswirkungen. Es gibt genauso gut positive. Also wir haben wirklich vor drei Jahren, wenn wenn eine Konferenz war, ist man da hingefahren, was ich bloß herumgereist und rumgefahren bin. Heute ist es normal. Das ist eine ZOOM Konferenz. Das bedeutet, die gab es genauso vorher auch die Technik. Wir haben es aber nicht gemacht. Also das ist mal eine positive Folge, aber gesellschaftlich und wir sehen es bei unseren Mitarbeitern, in der Pflege, aber auch bei vielen anderen bleibt da was übrig und das muss aufgearbeitet werden. Da muss man drüber reden und Positives und Negatives rausholen, das geht.
Ines Meinhardt: Sie haben gesagt, Sie wollen es mit vielen Akteuren auch tun. Wer sind die Akteure, mit denen Sie das gemeinsam tun wollen? Das Aufarbeiten? Wer ist dafür nötig, damit dann auch die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden? Und sie sagen Wir sind das nächste Mal besser vorbereitet.
Michael Albrecht: Also erst mal im System, im Gesundheits- und Versorgungssystem. Das ist unsere Sache, das müssen wir selbst machen. Wir haben gute Ergebnisse. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme weltweit, aber es ist auch gleichzeitig eines der teuersten. Und es ist eine Menge an Effektivitätspotential da drin. Und das muss man heben, weil wir es uns sonst nicht mehr leisten können. Dafür sind wir verantwortlich. Da arbeiten wir dann. Aber ansonsten das, was ich meine, gesellschaftlich, politisch, das müssen wir schon gemeinsam aufarbeiten, wenn Sie hier rumlaufen. Sie können unten zum Beispiel unseren Stand sich mal angucken. Da haben wir so ein Intensivbett aufgebaut - Kommunikation von Wissenschaft, Kommunikation von Gesundheitsversorgung in die Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel vorher sehr viel weniger gewesen. Da müssen wir viel mehr tun und machen. Also wenn Sie sich so ein Corona Tagebuch mitnehmen wollen, holen Sie sich unten eins ab. Wenn keins mehr da ist, schicken wir Ihnen eins. Also, das sind die Dinge, die auch wirklich stattfinden müssen und die gezielten fachlichen Dinge, die gehören in die Politik, in das Gesundheitssystem.
Ines Meinhardt: Und Sie sind zuversichtlich, dass dieser Dialog möglich ist. An vielen Stellen in der Gesellschaft ist er momentan ja sehr schwierig zu führen.
Michael Albrecht: Ja, der muss möglich sein. Alle bleiben und sind neugierig. Wir müssen auch einen gewissen Stolz haben, wenn wir so ein Wissenschaftsoutput hier haben. Dann muss man halt auch ausnutzen. Und ich denke, jeder, jeder hat Interesse daran, wenn man offen und frei und neugierig da rangeht. Und man sollte da auch keine Hemmungen haben. Es sind viele Dinge nicht gut und richtig gemacht worden, die möchte ich eigentlich nicht nächstes Mal wieder so machen und dann soll man es auch ansprechen.
Ines Meinhardt: Sie haben das Intensivbett angesprochen. Damit würde ich zu Professorin Esther Trost kommen, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität, Terroristen, Professorin für. Da muss ich mal ablesen, das ist wirklich so ein langer Titel, Bildgestützte Hochpräzisionsstrahlentherapie. Und Sie leiten die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum. Wenn Sie hören, dass ein Intensivbett, das zeigt, wie Beatmung außerhalb stattgefunden hat, wie dort Sauerstoff angereichert wurde, das in den Körper das Blut zurück transportiert wurde, dass inzwischen so eine Art Museumsstück wird. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Esther Troost: Sehr viele verschiedene Dinge gehen mir durch den Kopf mit den verschiedenen Hüten auf, sage ich mal, auch von der Zeit. Also die Ängste, die man natürlich in der Klinik hatte, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das war ein großes Thema, auch für uns in den onkologischen Fachdisziplinen. Wir hatten Angst, unsere Patienten wirklich zu verlieren. Gleichzeitig war ich Forschungsdekanin. Wir mussten uns überlegen Wie kriegen wir Promotionsvorhaben so gebahnt, dass Promovierende trotzdem auch dann sage ich mal das Ende erreichen können, ihre Promotionsarbeit beenden können oder auch überhaupt im Labor arbeiten können. All diese Dinge waren eine große Thematik und wir gingen natürlich auch im Jahre 2020 zusammen mit dem Klinikum in Chemnitz in unseren gemeinsamen Studiengang Medic, der schon angedacht war. Auf viele virtuelle Momente, viele virtuelle Lehrinhalte passte also sehr gut eigentlich dazu, aber war natürlich für uns alle komplettes Neuland. Wir mussten unsere Vorlesungen umstellen, wir mussten uns überlegen, wie kriegen wir trotzdem die Studierenden in den verschiedenen Fachdisziplinen ausgebildet? Und ganz wichtig auch in enger Abstimmung mit der Universitätsmedizin. Wie können wir die Lehre am Krankenbett weiterbetreiben und die Lehre an Krankenbett und das, was man jetzt unten als Museumsstück sieht, ist Museumsstück gewesen. Wir haben damit sehr vielen Patienten das Leben retten können. Ich kann mich auch an unsere Kolleginnen und Kollegen der Anästhesie und Intensivmedizin erinnern, die wirklich um jeden Patienten gerungen haben und das, was jetzt dann kommt, die Aufarbeitung, die Professor Albrecht genannt hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich denke, man muss daraus lernen und für die Zukunft sich wappnen und viele Dinge, die wir uns eigentlich damals vorgenommen haben, wie zum Beispiel wir werden Arzneimittel selber hier wieder produzieren. Oder wir müssen uns überlegen, welche anderen Sachen wir eigentlich vorhalten müssen als Land. Das ist ja wieder verbessert. Man reist wieder, man ist wieder unterwegs, die Normalität kommt irgendwo dann doch wieder zurück. Trotz der gerade eben auch angesprochenen Konferenzen. Also die Reisefrequenz von uns, Gott sei Dank als Forschende und Lehrende ist weniger als davor.
Ines Meinhardt: Sie haben es angesprochen. Sie sind auch zuständig für die Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen. Begegnet Ihnen inzwischen mehr Skepsis gegenüber der Wissenschaft, gegenüber den Forschenden? Weil wir sagen Ja, Wissenschaft in der Gesellschaft hat inzwischen auch einen größeren Zweifel zugelassen, weil man erlebt hat, wie auch Wissenschaftler untereinander Wissenschaftlerinnen Miteinander gestritten hat und das sehr, und das war vielleicht das Neue, in der Öffentlichkeit. Auch diesen Diskurs geführt haben.
Esther Troost: Also ich denke, für die Ausbildung der Medizinerinnen und auch der anderen Disziplinen, die wir ja bei uns in der medizinischen Fakultät ausbilden, ist es nicht so, dass die Neugierde um Wissenschaft anders oder schlechter geworden ist. Ich glaube, sie hat sogar zugenommen, weil wir einfach voneinander noch mehr lernen wollen als davor. Und es ist auch klar geworden, dass man Disput und Diskurs miteinander führen darf. Also es ist niemand, der jetzt immer recht hat und der andere hat immer Unrecht. Aber gerade diese Graubereiche zu identifizieren, bei uns regional, national, aber auch international und diese Forschungsverbünde, die man daraus auch generieren kann. Ich glaube, da ist die Neugier gerade gewachsen, dass man voneinander lernt.
Ines Meinhardt: Heißt das, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit jetzt dadurch beschleunigt worden ist durch die Pandemie auch, oder sind es andere Faktoren?
Esther Troost: Na ja, durch die Pandemie ist ein Stückchen erst mal weggewesen, nämlich das Vertrauen. Wenn man sich persönlich begegnet, kann man ja auch den anderen kennenlernen und ein Vertrauen aufbauen, was dann in eine virtuelle Welt tragen kann. Das war unter Corona eine Zeit lang nicht möglich, wie wir alle wissen. Auf der anderen Seite so internationale Trainingsnetzwerke, die wir haben, die sogenannten IRGGs. Einer ging in die Verlängerung, zusammen mit dem King's College. Einen zweiten haben wir gewonnen. Das heißt, diese Dinge sind einfach weiter belebt worden. Auch die verschiedenen Forschungsverbünde, die wir haben, national, die sind gestärkt worden. Und man ist doch auch vorsichtig dabei zu schauen nach anderen Universitäten, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und kurze persönliche Momente reichen im Moment schon aus, glaube ich, um dann in die virtuelle Welt einsteigen zu können. Und dann gehen die Abstimmungen schneller, als sie tatsächlich vor 2020 gingen. Also man braucht jetzt die Initialzündung und danach geht es aber etwas schneller in dem einander finden.
Ines Meinhardt: Vielen Dank. Wir gehen weiter zu Professor Fettweis und da habe ich mir was aufgeschrieben. Und zwar haben wir eine Vorabsprache gemacht. Vor dieser Runde, und da hieß es im Zusammenhang mit Ihnen schon immer sehr umtriebig, praxisrelevant Forschen ist sein Anliegen. Und ich frage Sie einfach Würden Sie sich genauso einschätzen?
Gerhard Fettweis: Ja, denke ich schon? Ja, ich glaube schon.
Ines Meinhardt: Also, Sie sind Leiter des Barkhausen Instituts, Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Weiß vielleicht nicht jeder.
Gerhard Fettweis: Ja, und zum Barkhausen Institut nur mal als Idee. Die Idee ist ja, Vertrauenswürdigkeit ins Internet zu bringen, und zwar vom Bottom up. Weil wenn wir heute über Vertrauenswürdigkeit im Internet reden, haben wir es ja oft mit Sachen, wo wir sagen, die Webpage muss angepasst werden und dies und das. Aber wir müssen eigentlich runtergehen bis zur Hardware. So wie wir im Haus auf ein stabiles Fundament setzen, müssen wir auch hier auf die Chips, auf die Betriebssysteme, auf die Funkkommunikation aufsetzen und da das Fundament setzen. Und dabei kommt es natürlich darauf an, wenn wir so ein Thema angehen, das auch mit der Öffentlichkeit zu diskutieren, weil es so ein wichtiges Thema, dass Sie sagten, das ist ein Thema, da geht es darum, auch hier mit der Öffentlichkeit nicht nur im Sinne von Zur Schau Stellung unserer Ergebnisse, sondern wirklich in den Diskurs einzutreten und hier miteinander zu diskutieren.
Ines Meinhardt: Nun haben Sie ja eigentlich eine Außenstelle hier im Kulturpalast. Sie wollten unbedingt mit dem COSMO Wissenschaftsforum hier rein. Haben Sie so an der Tür gerüttelt wie manche am Zaun des Kanzleramtes?
Gerhard Fettweis: Ja, ich meine, ich bin jetzt hier seit deutlich über 25 Jahren. Man kennt mich in der Szene auch. Insofern war es nicht schwierig, dass dann der OB Hilbert und die Frau Groth dann irgendwann mal an der Tür gerüttelt haben und gesagt Gerhard, hier ist was willst du da mal in der Ecke was loslegen. Und so haben wir hier das COSMO, diese Ecke angemietet, die wir zusammen mit Jens Krzywinski betreiben. Professor für, ich vergesse es immer, Disruptive irgendwas - Industrial Design bist du eigentlich. Aber auf jeden Fall sind wir hier in dem COSMO. Und die Idee ist wirklich, dass das COSMO nicht nur dem Barkhausen Institut, sondern eigentlich der gesamten Wissenschaftslandschaft Dresden Concept, was heute auch hier insgesamt ja die Lange Nacht der Wissenschaft feiert und ausrichtet, dass wir das als Schaufenster nutzen und als Kommunikationsplattform, nämlich auch als Zuhören. Wir wollen natürlich hier, wenn wir Sachen dort reinbringen, eben keine musealen Exponate, sondern interaktive, ich sage es mal, Spiele fast wissenschaftliche Spiele, wo ich lernen kann, wo ich was fühlen kann, erfahren kann, Fragen stellen kann, als jemand aus der Bevölkerung und dementsprechend auch wir mit dem Ohr reinhören können. Ah, das sind eure Wünsche, das sind eure Ängste, das sind eure verrückten Vorstellungen. Können wir denn das denn jetzt in unsere Forschung dann auch in Zukunft mit einbauen und auch hier und da Antworten geben für Themen, die wirklich dringend der Bevölkerung gerade am Herzen liegen?
Ines Meinhardt: Und wird es schon so gut frequentiert, wie Sie sich das wünschen? Oder sind Sie da noch nicht ganz am Ziel?
Gerhard Fettweis: Also wenn Sie mich fragen ich will immer mehr, das ist klar. So kennt man mich. Wir haben über 1000 Besuchende, wir haben ganz viele Multiplikatoren drin, wir haben Plattformen drin, wir haben Schulklassen, die kommen. Das Regelmäßige, das Women's in Dresden Concept Frauen in Dresden Concept Treffen, findet dort regelmäßig statt. Also wir sind innerhalb des Ganzen gut unterwegs. Aber wenn Sie mich kennen würden, würde ich sagen immer mehr.
Ines Meinhardt: Es steht auf der Internetseite, wenn man sich das anguckt vom Cosmo Wissenschaftsforum, noch dieser eine Satz ich glaube, den alle unterschreiben würden. Wissenschaft hilft, die Welt faktenbasiert und ohne Vorurteile zu verstehen. Ist das in der Bevölkerung, in der Gesellschaft auch wirklich so akzeptiert? Ich frage auch noch mal in diese Richtung. Es hat sich ja auch eine gewisse Skepsis gegenüber der Wissenschaft entwickelt. Ist denn das richtig, wenn der eine Wissenschaftler eine andere Meinung hat als der andere? In der Wissenschaft ist dieser Diskurs schon immer da gewesen, aber er ist jetzt, wie gesagt, öffentlich ausgetragen worden. Spüren Sie das in Nachfragen der Menschen?
Gerhard Fettweis: Wir spüren das im Nachfragen der Menschen. Wir spüren das als Wissenschaffende jeden Tag, muss ich ganz offen sagen. Wir hatten gerade die Woche auch in einem DFG Senat eine Diskussion über Nachhaltigkeit und unten. Das Thema ist ja auch gerade Nachhaltigkeit gewesen. Und wir wissen, dass Nachhaltigkeit und diese Themen in Frankreich ganz anders interpretiert werden, wenn es um die Stromerzeugung geht, als in Deutschland. Und wir Wissenschaffenden sind dafür da. Es gibt so einen schönen Spruch von einem CEO, einem Gründer von National Instruments, der Messinstrumente macht und der eigentlich genau das schön darstellt. We don't judge we measure ist sein Spruch. Das heißt, wir Wissenschaffenden sind nicht dafür da, politisch tendenziös Aussagen zu machen, sondern wir sind dafür da, zu bewerten und so neutral wie es geht, Aussagen zu machen als Fundament, als Grundlage, damit die Politik darauf Entscheidungen treffen kann und Menschen ihre Meinung sich bilden können. Auch wir Wissenschaftler machen unsere Meinung, das ist Bildung dabei natürlich. Aber die Wissenschaft an sich ist meinungsfrei.
Ines Meinhardt: Damit kommen wir zu Professor Büchner. Sie sind wissenschaftlicher Direktor vom Leibniz Institut für Festkörper und Werkstoffforschung in Dresden. Wie finden Sie das COSMO-Wissenschaftsforum?
Bernd Büchner : Ja, ich weiß natürlich, dass der Gerhard Fettweis sehr umtriebig ist, und ich finde es gut. Ich finde es sehr gut, dass die Kommunikation zu den Menschen gesucht wird. Intensiviert wird auch für Wissenschaftswissenschaftler direkt mit Leuten in Kontakt kommen. Ich meine, für uns als Festkörper-Werkstoffforschung ist es offensichtlich, dass wir für die Gesellschaft arbeiten, weil wir Themen aufgreifen, die relevant sind. Nachhaltigkeit spielt für uns eine große Rolle. Wir arbeiten an Photovoltaik, an Wasserstoffspeichern usw. Insofern ist das ein ganz einfacher Zusammenhang mit der Gesellschaft. Aber es gibt auch einen anderen, den ich, der mir wichtig ist. Und die Rektorin hat es gerade schon angesprochen Wissenschaft ist nicht nur Technologieentwicklung, sondern es geht auch um wirklich grundlegendes Verständnis. Und das grundlegende Verständnis zu erarbeiten ist die Aufgabe der Wissenschaftler. Und das ist wichtig, wichtig auch für zukünftige Technologien. Ich nehme ein anderes Beispiel, nicht die Gleitsichtbrille. Das Navigationssystem GPS funktioniert nur, weil relativistische Korrekturen eingebaut werden, die Albert Einstein irgendwann mal vor über 100 Jahren entwickelt hat. Und ich bin ganz sicher, der hatte ganz andere Ideen, als er das gemacht hat und ist aber trotzdem ganz wichtig, dass wir das haben. Das ist der Nährboden für alle Technologie, auch für gerade ganz neue Sachen, die kommen. Und dafür stehen wir. Und die Zeitskalen sind häufig sehr groß. Zeitskalen zwischen dem, was wir tun, und dem unmittelbaren Nutzen. Das ist in der Medizin viel einfacher. Das ist bei uns viel länger. Und trotzdem brauchen wir eben die Finanzierung für diese Grundlagenforschung. Und das ist nicht mehr so selbstverständlich. Und auch an der Stelle ist Kommunikation mit den Leuten sehr wichtig. Gerade. Lange Nacht der Wissenschaften ist ein super Beispiel, wo die Leute kommen und auch total spannend. Was ist Quantenmechanik? Wo sieht man hier wirklich Quantenmechanik? Das ist das, was die Leute fasziniert und das voranzubringen ist toll. Und ich nehme an, das ist bei euch ganz genauso, dass man wirklich die Grundlagen verstehen.
Ines Meinhardt: Also dass es die 20. schon ist. Ich glaube, das ist auch ein Verdienst Ihres Institutes, an dem Sie arbeiten. Denn vor 20 Jahren ging es da los mit einem Physik Event und ich habe immer das Gefühl, obwohl viele mit Physik so in der Schule ihre Probleme hatten, ist Physik durch die Faszination gut geeignet, Wissenschaft in die Gesellschaft zu tragen, auch an Kinder. Warum ist das so? Warum funktioniert das mit Physik so gut?
Bernd Büchner : Weil Physik eine tolle Wissenschaft ist. Ganz klar nein. Aber ich denke, vor 20 Jahren war klar Das war mein Vorgänger Helmut Eschrig. Oder der Gründungsdirektor des IFW, der damals die Idee hatte, diese vielen schon existierenden einzelnen Tage der Öffentlichkeit, die in den Instituten stattfinden, zu bündeln zu dieser langen Nacht der Wissenschaft. Und es schade, dass Sie nicht da waren. Das war eine super Show, die sie damals abgeliefert haben. Ich kam hier hin, ich kam 2003 hierhin. Ich muss auch noch ein Kompliment zurückgeben. Ich habe dann gelernt, dass der Oberbürgermeister damals in anderer Funktion wirkend, schon ganz am Anfang das finanziell unterstützt hat. Und das hat mir heute noch mal meine Referentin gesagt. Das wollte ich jetzt auch noch mal einen Dank geben. Es war also von Anfang an nicht nur eine Idee der Wissenschaftler, sondern eine tolle Unterstützung der Stadt. Und als ich hier hinkam ich war geflasht. Ich meine, ich hatte an drei anderen Plätzen in Deutschland gelernt. Das gab es nicht. Punkt. Auch wenn es vielleicht in Berlin Ähnliches schon gab, haben wir gerade diskutiert. Aber das gab es nicht. Und dann plötzlich kamen alle die Leute, die mit voll, mit leuchtenden Augen rein, das ganze Institut. Also von den Direktoren bis zu den Student*innen, Techniker*innen, die ganze Administration, alle haben dafür gearbeitet, dass die Wissenschaft an die Leute weitergegeben wurde. Ganz tolle Sache. Vor 20 Jahren. Und ich, ich glaube, das ist was Besonderes gewesen, zeigt auch was Besonderes in Dresden die Verbindungen zwischen Bevölkerung und Wissenschaft. Ich glaube, das ist wirklich ein hohes Gut. Toll. Und jetzt müssen wir, glaube ich und Sie sprechen es an, tatsächlich versuchen, diese Kommunikation zu verbessern. Dieses ‚Wissenschaft weiß ja auch nichts-Thema‘ doch ein bisschen zu beleuchten, denn ich weiß es schon.
Ines Meinhardt: Gibt es ja in vielen Bereichen so das Gejammer Wir haben keinen Nachwuchs, wir müssen gucken, dass die jungen Generationen sich dafür interessieren. Wie machen Sie das, dass die Kinder wirklich Spaß an Wissenschaften haben?
Bernd Büchner : Wir haben eine Truppe von jungen Frauen, die haben eine kleine Keime für die Wissenschaft. Die fahren also jetzt von Grundschule zu Grundschule. Es gibt also spezielles Geld, die machen da Chemieexperimente. Jedes Mal kommen die zurück mit leuchtenden Augen. Das ist unglaublich toll. Ich finde es auch super. Das sind Leute, die kommen aus Kolumbien, die kommen aus Indien. Also die, die Postdocs gehen in die Schulen rein. Kinder sind begeistert. Lehrer rufen an Können die nicht wiederkommen? Was ist los? Wir schaffen das von der Kapazität nicht. Große Mühen, das zu tun, auch wenn Sie sich Zeit nehmen und unser Institut besuchen. Die Kinderführung ist das absolute Highlight. Das ist der Versuch, den wir machen müssen. Aber ich finde einen anderen. Ich meine, es geht ja allgemein um Gesellschaft und Wissenschaft. Internationalität ist ein Thema, was sich gerade in den letzten Jahren sehr ändert. Und Wissenschaft war immer offen, offen für die ganze Welt. Und inzwischen gibt es so Themen wie technologische Souveränität, die uns betreffen. Und auch da wirkt tatsächlich das gesamtgesellschaftliche Umfeld auf uns ein, sowohl was die Themen angeht, dass wir versuchen, Technologie in Deutschland zu halten oder in Europa, als auch was das Personal angeht, wo die Anforderungen immer schwieriger und komplizierter werden.
Ines Meinhardt: Das heißt, komplexe Herausforderungen, denen sie sich aber gerne stellen.
Bernd Büchner : Müssen.
Ines Meinhardt: Müssen. Gut, auch das gibt es in vielen Bereichen. Wir machen den Wechsel von der Physik zur bildenden Kunst. Professor Sandner Auch da muss ich ablesen Was ist einfach zu viel, was Sie hier an Titel tragen. Prorektor der Hochschule für Bildende Kunst Dresden und Professor für Kunst, Technologie, Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturoberfläche. Sie sind also Experte für Wandmalerei und Architekturoberfläche, Naturwissenschaften und Kunstwissenschaften. Was verbindet Sie?
Markus Santner: Ja, mich hat es schon einmal gefreut, dass wir vorhin einen Vortrag zu einem Wandbild gehört haben, denn das ist nicht so selbstverständlich. Und Wandmalerei gibt es ja jetzt in Dresden auch nicht so ganz viel. Also von daher war das heute ein schöner Einstieg. Und in der Restaurierungswissenschaft spielt eben die Wissenschaft auch eine ganz wichtige Rolle. Sei es, wenn es darum geht, Lösungen zu finden für die Erhaltung, sei es, wenn es darum geht, Technologien oder Werktechniken von Kunstwerken zu untersuchen und dann letztlich auch an die Gesellschaft weiterzutragen. Ja, es gibt ja am Kulturpalast noch ein zweites wichtiges Wandbild, was ja hier sicherlich alle kennen der Weg der Roten Fahne und das ja auch politisch unterschiedlich betrachtet wird oder auch seine Geschichte hat. Aber hier kann eben die Restaurierungswissenschaft auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das Kunstwerk vielleicht von einer anderen Perspektive auch zu betrachten. Man hat damals, als das Ende der 60er Jahre gefertigt wurde, mit 90.000 Volt, glaube ich, mit Glasgrüssel hier Keramik auf das Wandbild geschossen. Und aufgrund der Untersuchung und der Analyse kann man hier vielleicht die Perspektive und die Information und auch die Wertigkeit letztlich von Kunstwerken anders an die Gesellschaft transportieren. Und von dem her ist das eben.
Ines Meinhardt: Das heißt, mit Ihnen müsste man unbedingt durch den Kulturpalast gehen. Sie haben an jeder Ecke eine Geschichte zu erzählen, oder? Ja, vermutlich ist das so. schön. Sie wollen ja auch Wissenschaft in die Stadtmitte bringen. Aus der Hochschule raus. Wie weit sind Sie damit gekommen?
Markus Santner: Ja, also für die Hochschule gesamt. Also man staunt ja vielleicht. Kunst und Wissenschaft passt ja auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich zusammen, aber wir sind ja auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, von Beginn an mit dabei. Und unsere Studiengänge sind mit einer Vielzahl an unterschiedlichsten Museen, Institutionen ganz eng verbunden. Hygienemuseum auch mit der Stadt, mit der TU Dresden natürlich, also mit ganz vielen Institutionen. Und auch heute hier im Kulturpalast selbst, da finden auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen viele Kooperationen statt. Und auch umgekehrt. Auch das Haus mit den diversen Standorten öffnet sich immer wieder und versucht auch hier das Publikum und auch die jungen Leute einzuladen.
Ines Meinhardt: Das heißt, der Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft ist da. Wie stark beeinflussen Sie die Veränderungen in der Gesellschaft, in Ihrem Forschungs- und Wirkungsbereich?
Markus Santner: Also ich sage mal, für die Kunst kann ich das ja nur peripher beantworten. Aber Kunst hat ja auch die Aufgabe zu reflektieren, zu polarisieren, vielleicht Impulse zu geben. Es gab ja, glaube ich, in den 50er Jahren in Amerika Black and Black Mountain College, wo Künstler mit Atomphysiker zusammen gearbeitet haben. Und ich glaube, Kunst kann Impulse geben in ganz verschiedene Richtungen. Und sie reflektiert ja auch in gewisser Weise auf Dinge, die in der Gesellschaft passieren. Und für die Restaurierung ja, die Restaurierung ist einfach auch wichtig, weil sie sich um Kunstwerke kümmert, die eine gewisse Erinnerung auch in sich tragen. Die, und das ist, glaube ich, für die Gesellschaft sehr wichtig, dass man die Erinnerungskultur, die Verbundenheit auch mit der Geschichte, die Kunstwerke zeigen ja auch in gewisser Weise den Stand der Technik, Materialien etc. Und das ist schon ein Punkt, der in der Restaurierung auch mit verschiedenen Institutionen versucht wird, hier in die Stadt zu spiegeln.
Ines Meinhardt: Herzlichen Dank Ihnen allen für diese Einblicke. Ich denke, es war eine spannende halbe Stunde. Danke schön.
Geben Sie uns ihr Feedback - einfach, schnell und anonym.
Hier ein paar Eindrücke unserer Veranstaltung.

© André Wirsig

Referent Dirk Hilbert © André Wirsig

© André Wirsig

Referentin Ursula Staudinger © André Wirsig

Referent:innen Dirk Hilbert und Ursula Staudinger © André Wirsig

© André Wirsig

Referent:innen Ursula Staudinger und Michael Albrecht © André Wirsig
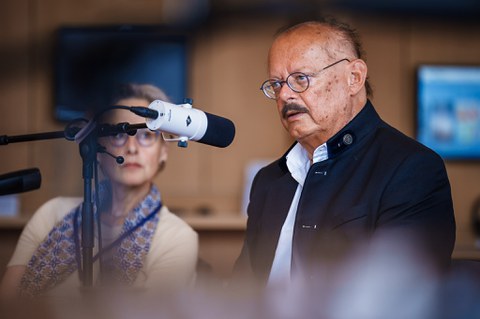
Referent Michael Albrecht © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Referent Michael Albrecht © André Wirsig

Referentin Esther Troost © André Wirsig

Moderatorin Ines Meinhardt © André Wirsig

Moderatorin Ines Meinhardt © André Wirsig

Referenten Gerhard Fettweis und Bernd Büchner © André Wirsig

Referent Gerhard Fettweis © André Wirsig

Referent Gerhard Fettweis © André Wirsig

Referent Gerhard Fettweis © André Wirsig

Referent Bernd Büchner © André Wirsig

Referent Bernd Büchner © André Wirsig

Referenten Gerhard Fettweis und Bernd Büchner © André Wirsig

Referent Markus Santner © André Wirsig

Referenten Bernd Büchner und Markus Santner © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig
Wann: 30.06.2023, 17:15 - 17:45 Uhr
Wo: Lange Nacht der Wissenschaften - Kulturpalast Dresden, 2. OG
Unsere Referent:innen:
-
Dirk Hilbert - Oberbürgermeister Landeshauptstadt Dresden
-
Prof. Dr. Ursula M. Staudinger - Rektorin der TU Dresden
-
Prof. Dr. D. Michael Albrecht - Medizinischer Vorstand Universtitätsklinikum Carl Gustav Carus
-
Prof. Dr. Dr. Esther Troost - Dekanin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden
- Prof. Dr. Bernd Büchner - Wissenschaftlicher Direktor Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden
- Prof. Dr. Gerhard Fettweis - Leiter des Barkhausen Instituts gGmbH
- Prof. Mag. Dr. Markus Santner - Prorektor der HfBK Dresden und Professor für Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturoberfläche
Moderatorin: Ines Meinhardt, Redaktionsleiterin MDR Sachsen
Musikalische Begleitung:
- Jo Aldinger jochenaldinger.de
- und Patrick Neumann www.patrickneumann.net
Dieses Vorhaben wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von
Bund und Ländern.