28.07.2025
#FactFriday: Hexenverbrennung
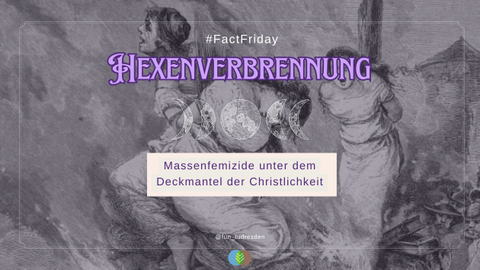
Hexenverbrennungen
Hexenverbrennung - Massenfemizide unter dem Deckmantel der Christlichkeit
Hexenverbrennung
Die sogenannte Hexenverbrennung bezeichnet die systematische Verfolgung und Tötung von Menschen, meist Frauen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Diese Verfolgungen fanden vor allem zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in Europa statt, ihren Höhepunkt erreichten sie im 16. und frühen 17. Jahrhundert.
Menschen wurden aufgrund von Gerüchten, abweichendem Verhalten, sozialem Status oder politischen Motiven angeklagt. Die Verfahren basierten oft auf Folter, religiösem Fanatismus und Angst vor dem Teufel, und endeten nicht selten mit öffentlichen Hinrichtungen – meist durch Verbrennung, aber auch durch Ertränken oder Hängen.
Die Hexenverfolgung war ein Ausdruck tiefer gesellschaftlicher, religiöser und politischer Spannungen – und ein Beispiel für staatlich und kirchlich legitimierte Gewalt gegen vor allem Frauen. Heute gilt sie als eines der düstersten Kapitel europäischer Geschichte.
Ablauf der Verfolgung
1. Beschuldigung und Denunziation
Die Verfolgung begann oft mit Anschuldigungen aus der Nachbarschaft. Ursachen konnten persönliche Konflikte, Neid, Krankheit, Missernte oder unerklärliche Todesfälle sein. Vor allem Frauen mit sozialer Randstellung – wie Heilerinnen, ältere alleinstehende Frauen oder auffällige Persönlichkeiten – gerieten in Verdacht.
2. Untersuchung und Verhaftung
Sobald eine Person beschuldigt wurde, konnte sie durch weltliche oder kirchliche Autoritäten verhaftet werden. Viele Regionen richteten Sondergerichte ein, sogenannte Hexenkommissionen, die speziell für diese Prozesse zuständig waren. Die Anklage lautete häufig auf Teufelspakt, Schadenszauber, Wetterzauber oder die Teilnahme am Hexensabbat.
3. Folter und Geständnis
Die Beweislage stützte sich meist auf Geständnisse, die unter Folter erzwungen wurden. Folter war nach damaligem Recht unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, wenn ein „begründeter Verdacht“ bestand. Typische Foltermethoden waren Streckung, Schlafentzug oder das sogenannte „Hexenbad“ (Ertränkungsprobe, oft ohne rechtliche Grundlage). Auch die Nennung von Mittäter*innen wurde unter Druck gefordert, was zu regelrechten Verfolgungsketten führte.
4. Hexenproben und Aberglaube
Neben der Folter wurden pseudowissenschaftliche Beweismittel herangezogen, etwa die Suche nach einem „Hexenmal“ auf dem Körper, das als Beweis für den Teufelspakt galt. Auch absurde Vorstellungen wie das Fliegen zum Hexensabbat oder das Auslösen von Seuchen wurden herangezogen, häufig gestützt durch die sogenannte Malleus Maleficarum („Hexenhammer“, 1487), ein kirchliches Handbuch zur Hexenbekämpfung.
5. Urteil und Hinrichtung
Wurde die Schuld festgestellt (was fast immer der Fall war), folgte das Urteil. Die gängigste Strafe war der Tod durch Feuer, oft in Form der Verbrennung bei lebendigem Leib. In manchen Regionen wurden Verurteilte vorher erdrosselt oder enthauptet. Die öffentliche Hinrichtung hatte eine abschreckende Wirkung und diente zur Machtdemonstration von Kirche und Obrigkeit.
6. Nachwirkungen
Viele Prozesse hatten nicht nur tragische individuelle Folgen, sondern auch soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf Gemeinden. Erbschaften wurden eingezogen, Familien stigmatisiert. Erst mit der Aufklärung und der Kritik an Folter, Aberglauben und kirchlichem Machtmissbrauch endete die Praxis allmählich.
Fakten & Zahlen
Anzahl der Opfer:
Zwischen 40.000 und 60.000 Menschen wurden hingerichtet.
(Einige ältere Schätzungen lagen bei bis zu 100.000, gelten heute aber als überhöht.)
Anzahl der Prozesse:
Schätzungen gehen von mindestens 100.000–150.000 Prozessen aus – viele davon ohne Todesurteil.
Geschlechterverteilung:
Etwa 75–85 % der verurteilten Personen waren Frauen, insbesondere ältere, verwitwete oder sozial marginalisierte Frauen.
Verlauf:
Einzelne Fälle ab dem 13. Jahrhundert, erste große Welle im späten 15. Jahrhundert. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert fand der Höhepunkt statt – besonders zwischen 1560 und 1630.Ein Rückgang war ab dem späten 17. Jahrhundert, mit der Aufklärung, zunehmender Kritik an Folter, und wachsendem wissenschaftlichem Denken, zu verzeichnen. Der letzte dokumentierte Hexenprozess in Europa fand 1782 in der Schweiz statt (Anna Göldi).
Warum der Begriff problematisch ist
Der Begriff „Hexenverbrennung“ ist weit verbreitet, wenn von den Verfolgungen und Hinrichtungen im Zuge der europäischen Hexenprozesse die Rede ist. Doch aus historischer und erinnerungspolitischer Sicht ist dieser Begriff verkürzt, unscharf und irreführend – und in Teilen auch verharmlosend.
1. Nicht alle Opfer wurden verbrannt
In vielen Regionen wurden vermeintliche „Hexen“ auch erhängt, ertränkt oder enthauptet. Der Begriff reduziert das komplexe Geschehen auf eine einzelne (und spektakulär grausame) Hinrichtungsform – dabei war der eigentliche Kern die Verfolgung und Entrechtung unschuldiger Menschen.
2. Der Begriff blendet die Justizprozesse aus
„Hexenverbrennung“ suggeriert ein spontanes, irrationales Geschehen, fast wie ein Pogrom. Tatsächlich handelte es sich meist um staatlich oder kirchlich organisierte Gerichtsverfahren, oft mit Folter, Geständnissen, Urteilsverkündung und Enteignung. Der Begriff verschleiert also die beteiligten Institutionen und die staatliche Legitimierung der Gewalt.
3. Er romantisiert oder verharmlost das Geschehen
In populärer Sprache wird „Hexenverbrennung“ oft dramatisch oder symbolisch verwendet – ohne Bezug zur tatsächlichen Gewalt und dem Leid, das damit verbunden war. Das trägt zur Verharmlosung des historischen Unrechts bei, insbesondere gegenüber den zehntausenden Frauen (und Männern), die gefoltert, ermordet und enteignet wurden.
4. Er zementiert ein falsches Täter-Opfer-Bild
Der Begriff „Hexe“ war eine Fremdzuschreibung, die mit Schuld, Teufelspakt und Aberglauben verknüpft war. Wenn wir heute von „Hexen“ sprechen, übernehmen wir oft unbewusst diesen historischen Täterbegriff – statt die Opfer als unschuldige Menschen zu bezeichnen, die Opfer von Angst, Sexismus und Gewalt wurden.
Alternative Begriffe:
Statt von „Hexenverbrennung“ zu sprechen, ist es historisch und ethisch präziser, Begriffe wie: „Opfer der frühneuzeitlichen Justiz“, „vermeintlich der Hexerei Beschuldigte“ oder „gewaltsame Hinrichtungen im Rahmen der Hexenprozesse“ zu verwenden.
Fazit
Der Begriff „Hexenverbrennung“ ist tief in unserem Sprachgebrauch verankert – doch wer sich mit der Geschichte auseinandersetzt, erkennt:
Es geht um weit mehr als ein Scheiterhaufen. Es geht um strukturelle Gewalt, staatliche Macht, patriarchale Kontrolle und die Ausgrenzung von Menschen, die nicht in das Weltbild der damaligen Zeit passten.
Ein bewussterer Sprachgebrauch ist daher ein Akt historischer Verantwortung und Respekts gegenüber den Opfern.
Die sogenannte „Hexenverbrennung“ war kein dunkles Märchen, sondern ein historisches Verbrechen an zehntausenden vor allem weiblichen Opfern. Sie wurden verfolgt, weil sie nicht ins Bild passten: zu laut, zu allein, zu selbstständig. Der Begriff „Hexe“ war nie eine Eigenschaft – sondern ein Urteil.
Auch heute noch werden Frauen oft vorschnell verurteilt: als „hysterisch“, „zu emotional“ oder „zu ehrgeizig“. Wer das Unrecht der Vergangenheit ernst nimmt, sollte sensibel mit Sprache umgehen und fragen: Wer wird beschuldigt – und warum? Erinnerung bedeutet nicht nur Gedenken, sondern auch Verantwortung im Heute.
Quellen:
[1] https://www.bpb.de/themen/zeit-kulturgeschichte/hexenverfolgung/
[2] https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/hexenverfolgung/index.html
[3] https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/hexen-und-hexenverfolgung
