03.10.2025
#FactFriday: Menopause
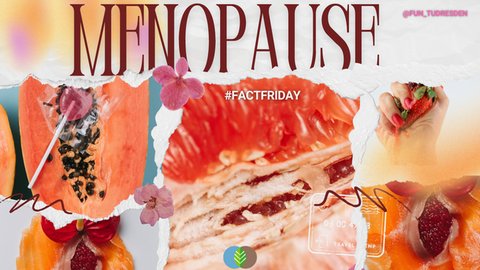
Menopause
Was ist die Menopause?
Die Menopause bezeichnet den natürlichen, biologischen Prozess im Leben einer Frau* / menstruierenden Person, bei dem die Menstruationszyklen dauerhaft enden. Sie tritt ein, wenn die Eierstöcke ihre Hormonproduktion – vor allem von Östrogen und Progesteron – so weit reduzieren, dass kein Eisprung mehr stattfindet.
Medizinisch gilt eine Frau als in der Menopause, wenn mindestens zwölf aufeinanderfolgende Monate keine Menstruationsblutung aufgetreten ist und keine andere gesundheitliche Ursache dafür vorliegt.
Zeitpunkt & Phasen
Das durchschnittliche Alter bei Eintritt der Menopause liegt bei etwa 51 Jahren, der normale Bereich reicht von 45 bis 55 Jahren.
Der Übergang ist meist nicht abrupt, sondern wird durch eine mehrjährige Vorphase eingeleitet:
Perimenopause: Die Zeit vor der letzten Regelblutung, in der Hormonspiegel schwanken und Zyklusstörungen häufig sind.
Menopause: Der medizinische Zeitpunkt der letzten Menstruation.
Postmenopause: Die Zeit nach der Menopause, in der die hormonellen Veränderungen stabil bleiben, manche Symptome aber fortbestehen können.
Evolutionäre Bedeutung
Auf den ersten Blick scheint es evolutionär unlogisch, dass weibliche Fortpflanzungsfähigkeit lange vor dem Lebensende aufhört. Das wirft die Frage auf: Warum hat sich das überhaupt durchgesetzt? Momentan liegt der Fokus auf drei Hypothesen, die das versuchen zu erklären:
1. Großmutter-Hypothese
Ältere Frauen erhöhen ihre indirekte Fitness (indirekte Verbreitung eigener Gene), indem sie Enkelkinder unterstützen statt weitere eigene Kinder zu bekommen.
⟶ Vorteile: Erhöhte Überlebenschancen der Enkel, Entlastung der eigenen Töchter, die dadurch mehr Kinder bekommen können.
2. Mutter-Hypothese
Fortpflanzungsstopp reduziert das Risiko für Mutter und Kind bei späten Schwangerschaften.
3. Kooperative Aufzucht-Hypothese
Menopause erleichtert kollektive Kinderbetreuung in sozialen Gruppen und aufgeteilte Versorgung durch Verwandte steigert den Fortpflanzungserfolg der Gruppe.
Mögliche Symptome
1. Hormonell bedingte körperliche Veränderungen
- Hitzewallungen
- Nachtschweiß
- Schlafprobleme
- Unregelmäßige Menstruation bis zum völligen Ausbleiben der Blutung
- Trockenheit der Scheide
- Häufigerer Harndrang oder Blasenschwäche
- Gewichtszunahme
- Haut- und Haarveränderungen
2. Psychische und emotionale Symptome
- Stimmungsschwankungen
- Reizbarkeit
- Antriebslosigkeit oder Müdigkeit
- Konzentrations- und Gedächtnisprobleme („brain fog“)
- Ängstlichkeit oder depressive Verstimmungen
3. Langfristige gesundheitliche Folgen (durch den Hormonmangel)
- Abnahme der Knochendichte → erhöhtes Osteoporoserisiko
- Veränderte Blutfettwerte → erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Medikamentöse Behandlung
Ob die Menopause medikamentös behandelt werden sollte, hängt stark von der individuellen Situation ab – denn:
Sie ist ein natürlicher biologischer Prozess und an sich keine Krankheit. Wenn die Symptome mild und nicht belastend sind, ist eine Behandlung nicht sinnvoll, wenn es jedoch zu starken Beeinträchtigungen kommt, kann eine Behandlung nach ärztlicher Absprache in Erwägung gezogen werden. Mögliche Behandlungsmethoden sind zum Beispiel Hormonersatztherapien, Lokale Östrogentherapien sowie Medikamente. Alternativ kann auf pflanzliche Präparate oder die Änderung des Lebensstils gebaut werden. Fest steht aber, dass die Menopause keine Krankheit und völlig normal ist.
Problematischer Data Gap
Wenn man jedoch eine Behandlung in Erwägung zieht, stößt man hier auf ein massives Problem: Die Datenlücke bei Medikamenten, die an Frauen in oder nach der Menopause getestet werden, ist tatsächlich erheblich – und das ist ein Problem in der gesamten Medizin.
Zum einen wurden Frauen - und vor allem ältere Frauen - historisch oft an der Datenaufnahme ausgeschlossen, da der Mann seit vielen hundert Jahren als (medizinisches) Ideal galt und das Standardmodell bildete.
Außerdem ist es schwierig mit dem “Störfaktor” Menopause zu arbeiten, da Studienkonditionen durch u.a. Veränderungen im Hormonhaushalt nicht konstant gehalten werden.
Medikamente, die für Erwachsene zugelassen sind, basieren oft auf Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus Studien mit jüngeren Männern oder gemischten Gruppen, in denen ältere Frauen unterrepräsentiert sind. Dosierungen könnten für Frauen in der Menopause suboptimal sein und Nebenwirkungen werden manchmal erst spät erkannt, weil Wechselwirkungen mit menopausalen Veränderungen nicht untersucht wurden.
Dieser Gender Data Gap zieht sich durch alle Bereiche und muss dringend ausgeglichen werden.
Und jetzt: Fazit
Die Menopause ist ein ganz natürlicher Lebensabschnitt im Körper jeder Frau / menstruierenden Person – kein Krankheitsbild, sondern ein biologischer Übergang, den jede unterschiedlich erlebt. Viele Beschwerden lassen sich durch Lebensstil, Austausch oder, wenn nötig, auch medizinische Unterstützung lindern. Wichtig ist, sie nicht mit Angst oder Tabus zu beladen, sondern offen und informiert damit umzugehen. Gleichzeitig zeigt die Forschungslage, dass Frauen in der Menopause noch immer in vielen klinischen Studien unterrepräsentiert sind. Das führt zu Wissenslücken über Medikamente, Dosierungen und Nebenwirkungen in dieser Lebensphase. Deshalb gilt: Die Menopause verdient nicht nur Normalisierung im Alltag, sondern auch mehr Aufmerksamkeit in der Medizin und Forschung – damit Frauen auf fundierte Daten und individuelle Unterstützung zurückgreifen können.
Und jetzt: eure Meinung
Habt ihr euch schon Mal Gedanken über die Memopause gemacht? Habt ihr mit (älteren) weiblichen Vaerwandten darüber geredet oder ist das noch ein Tabuthema?
Und welche Theme interessieren euch und würdet ihr gern im #FactFriday sehen?
Quellen:
[1] Hawkes, K., O’Connell, J. F., Blurton Jones, N. G. (1998). Grandmothering, menopause, and the evolution of human life histories. PNAS, 95(3), 1336–1339.
[2] Maki, P. M., et al. (2019). Menopause and cognition. Menopause, 26(9), 1034–1043.
[3] Holdcroft, A. (2007). Gender bias in research: how does it affect evidence-based medicine? Journal of the Royal Society of Medicine, 100(1), 2–3.
[4] https://www.who.int/health-topics/menopause
[5] https://www.nhs.uk/conditions/menopause/
[6] https://eige.europa.eu/publications/gender-and-health-data-gaps
[7] https://www.health.harvard.edu/womens-health/menopause-and-perimenopause
