May 24, 2023
Episode 06: How Much Excess Can Society Take - A Debate on Addictions and Their Consequences
Our podcast series you ask we explain - Berührungsängste in der Medizin started in January and is published monthly. In the 6th episode, we discussed the topic: How much intoxication can society tolerate - A debate about addictions and their consequences
We wanted to discuss with you and answer your questions. Didn't have time to join us? No problem: just listen to our podcast on the go - on Spotify, Apple Music, Deezer or here.
Stephan Wiegand: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem COSMO Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden.
Marie-Luise Rohm Marie-Luise Rohm: Willkommen zu unserer heutigen Podcast Aufzeichnung von You Ask Me Explain zum Thema Wie viel Rausch verträgt die Gesellschaft? Ich kann mir vorstellen und Sie sich wahrscheinlich auch, dass ein Großteil der hier anwesenden Personen über Woodstock, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Amy Winehouse oder vielleicht sogar sehr persönlich einige Erfahrungen mit sogenannten Drogen oder Suchtmitteln machen konnte bzw. machen wird. Und um das noch mal in harte Zahlen zu verpacken 2022 starben deutschlandweit 1.990 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums, 83 % davon waren männliche Personen und das Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren. Und wenn man jetzt auf die Jugendlichen der Gesellschaft blickt: In der letzten Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben im Alter von 12 bis 17 Jahren die Jugendlichen angegeben, dass ihr Konsum von Cannabis im Jahr zwei 2011 von 7 0,6 % gestiegen ist auf 10 %. Und bei den Erwachsenen, den 18 bis bis 64-jährigen, haben in den letzten zwölf Monaten mindestens 4,5 Millionen Personen einmal Cannabis konsumiert und jeder Vierte von diesen Konsumenten hat einen problematischen Konsum. So fasst das die Umfrage zusammen. Herr Wicha, wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck der Realität, des Konsums und der Sucht?
Uwe Wicha: Na ja, also ich bin ja Leiter einer Klinik, einer Fachklinik, die Drogenabhängige rehabilitiert, also von der Sucht versucht wieder wegzukriegen. Und nun habe ich dadurch einen ganz eigenständigen Blick. Ich kenne fast nur Jugendliche, die konsumieren. Ich bin mir aber sicher, es gibt noch andere. Aber meine berufliche Deformation ist natürlich, dass ich die Konsumierenden kenne. Und was wir in den letzten Jahren feststellen, ist, dass wir jüngere Einstiegsalter haben, nicht generell bei allen Jugendlichen, die anfangen zu konsumieren. Es gibt ja auch welche, die bei einem Probierkonsum bleiben, aber die, die dann tatsächlich irgendwann mal eine suchtausbildende Abhängigkeitserkrankung haben, die geben dann bei einer Befragung an, mit 11, 12 oder 13 mit dem Konsumieren angefangen zu haben. Man kann sich vorstellen, dass das eine besonders problematische Situation darstellt, weil das Hirn ja besonders vulnerabel ist in diesem jungen Alter und sehr leicht zu schädigen ist. Und dann schauen wir mal vielleicht noch mal einen anderen Blick. Wir haben jahrelang dominierend Crystal als Droge in Sachsen gehabt, auch in den angrenzenden Bundesländern. Und Crystal wird im Moment gerade von Cannabis bei uns abgelöst. Das heißt, es kommen zurzeit mehr Menschen, die sagen ich habe eine Cannabisabhängigkeit und habe nur wenige Ausflüge in die Welt der chemischen Drogen gemacht und das war nicht so meins. Und ich bin im Grunde genommen auf Cannabis kleben geblieben. Eine weitere Entwicklung, die wir jetzt feststellen, dass Heroin wiederkommt. Also wir hatten Heroin mal in Sachsen, bevor Crystel die Hauptdroge wurde. Das hat sich aber durch Crystal verändert. Das hatte was mit polizeilichen Maßnahmen zu tun. Nun ist es so, dass wir die ersten Heroinklienten wiederfinden. Auch bei euch. Keine von diesen Sachen ist wirklich gesundheitsförderlich. Also insofern, ich will damit aufspielen, dass manche sagen, es gibt harte Drogen und weiche Drogen. Mit dieser Unterscheidung gehe ich nicht ganz mit. Wenn ich gucke, was es für Schäden bei unseren Klienten anrichtet.
Marie-Luise Rohm: Herr Markieton, wie sieht die Sucht bei Ihnen aus und wie kann auch ein Hilfsangebot dementsprechend aussehen?
Maksymilian Markieton: Also mit meiner Sucht komme ich ganz gut klar. Ich bin quasi am anderen Ende der Nahrungskette wie der Uwe. Ich arbeite im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe. Das sind ja Menschen, die mit anderen Problemen zu uns kommen, als jetzt ihre Abhängigkeitserkrankung primär zu bearbeiten. Da geht es erst mal darum, eine Grundversorgung herzustellen, eine Unterbringung herzustellen, Finanzierung hinzubekommen, dass die überhaupt wieder was zu essen bekommen. Und wenn sie nichts zu essen haben, dann gibt es ein bisschen was von der Tafel, weil ein leerer Bauch, der ist nicht aufnahmefähig und das Gehirn gerade dann. Also der leere Bauch ist aufnahmefähig, aber das Gehirn dann eben nicht. Und dann stellen wir aber fest, dass natürlich auch Wohnungslosigkeit und dieser Dauerstressfaktor bei bestimmten Personengruppen auch einen Impact haben, dass natürlich auch konsumiert wird. Der Konsum ist eine Form von Selbstberuhigung, Selbstmedikation. Ohne den könnten die diesen Stress möglicherweise gar nicht durchhalten. Natürlich ist er nicht gesundheitsförderlich. Das Leben auf der Straße ist auch nicht gesundheitsförderlich. Wir wissen alle, dass da bestimmte Botenstoffe im Gehirn, also Stressoren, permanent da sind. Und was ich nur sagen wollte, ist, dass diese Menschen natürlich auch regelmäßig bei uns sind. Ich will damit sagen auch nicht alle. Es gibt viele wohnungslose Menschen, die haben andere Sachen, die. Da geht es nicht primär um Konsum, auch nicht nebenbei. Aber das spielt dann doch vermehrt eine Rolle.
Marie-Luise Rohm: Der Begriff des problematischen Konsums ist auch gerade schon gefallen. Vielleicht können Sie Herr Pilhatsch uns noch mal umreißen, was Sie darunter verstehen würden.
Maximilian Pilhatsch: Problematischer Konsum, der Name sagt es ja schon, tritt dann ein, wenn gesundheitliche Folgeschäden da sind. Dann reden wir zumindest von einem diagnosewertigen, krankheitswertigen Konsum. Das wäre dann der schädliche Gebrauch. Und wichtig ist, dass es sich tatsächlich um gesundheitliche Folgeschäden handelt, wie beispielsweise eine Leberwerterhöhung, eine Depression, eine Psychose. Im Falle von illegalen Drogen häufig die gesundheitliche Komplikation. Dann beginnt die Krankheit in meinen Augen.
Marie-Luise Rohm: Und wie kann eine Therapie davon aussehen?
Maximilian Pilhatsch: Die Therapie, man kann das jetzt nicht so einfach verallgemeinern, richtet sich natürlich schon nach der zugrunde liegenden Substanz. Wichtig ist, dass immer mit den Patienten und Patientinnen ins Gespräch zu kommen, was die individuellen Konsummotive sind. Das ist meistens eine Mischung aus inneren und äußeren Faktoren. Nach meiner Erfahrung. Äußere Faktoren können Belastungen sein, Stress, sein, Arbeitslosigkeit sein, Überforderung sein und kann aber auch zum Beispiel Verführung sein, Peergroup sein, Verfügbarkeit sein, innere Faktoren. Kann so etwas sein? Wie reagiere ich auf Stress? Vielleicht habe ich eine Komorbidität. Ängste brauche ich, bin ich Hedonist? Liebe ich den Rausch sozusagen? Das sind so die inneren Faktoren und so muss man das glaube ich, ganz individuell bei jedem, bei jedem einzelnen Patienten so entpuzzeln, um dann entsprechend Alternativen zu finden, diese Lücken zu füllen, die dann der Suchtstoff hinterlässt, wenn man ihn dann wegnimmt. Und das bedeutet für mich dann Therapie, idealerweise auch mechanismusbasiert. Das heißt, man identifiziert vorher, welche Mechanismen bei dem jeweiligen Patienten dann auch betroffen sind und setzt da zielgenau an.
Marie-Luise Rohm: Herr Wicha, können Sie das auch so bestätigen, sieht das bei Ihnen genauso aus. Oder haben Sie vielleicht einen anderen Realitätseinblick in die Therapie, wie sie bei Ihnen durchgeführt wird.
Uwe Wicha: Ja, bei uns findet ja die sogenannte Langzeitentwöhnung statt. Das sind 24 Wochen bei Abhängigen von illegalen Drogen. So lange dauert eine Langzeitentwöhnung. Die findet stationär statt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu Fachchinesisch ist, aber das Angebot muss regelbasiert, strukturiert sein und es müssen Begegnungs- und Erlebnisräume geschaffen werden. Was ich damit meine, ist die Menschen, die zu uns kommen, die haben Struktur und Regelhaftigkeit vollkommen verloren im Rausch. Das ist ja auch das, was an dem Rausch so faszinierend ist, dass man das hinter sich lassen kann und verlieren kann. Deshalb wählt man ja auch ein Rauschmittel aus. Und es gibt aber nur leider den Nachteil, dass der manch einer sich damit wegspülen lässt und es nicht wieder zurückerobern kann. Also dass er nicht zwischen den beiden Zuständen wechseln kann nach eigenem Belieben, sondern er es Belieben liegt in der Droge sozusagen. Und das ist dann auch das Problem, was die Abhängigkeit ausmacht. Was wir anbieten, ist an erster Stelle mal ein Ort, wo man sicher sein kann Ich weiß, was hier passiert, ich weiß, auf was ich mich einlasse. Ich weiß, dass man hier sich um mich bemüht und dann kommt all das, was eben gesagt wurde. Dann wird individuell geschaut Was sind deine Konsummotive, was hast du versucht zu lösen mit deinem Konsum? Welche Wirkungserwartungen hattest du an die Droge? Und das ist dann eine sehr individuelle psychotherapeutische Arbeit, die stattfindet. Und das andere, was ich beschrieben habe, das hat eine andere Aufgabe. Das Regelbasierte ist dafür da, endlich Sicherheit zu schaffen und Vertrauen zu schaffen. Deshalb braucht es so was und die Strukturierung hat eine ähnliche Aufgabe Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Und dann kommt als großer Indikator für eine gute Therapie Begegnungsqualität und Beziehungsaufbau. Es muss gelingen, dem Klienten so gegenüberzutreten, dass er Vertrauen fassen kann und sagen kann Es geht um mich. Und der Therapeut, der sich mit mir beschäftigt, der will mit mir mein Bestes.
Stephan Wiegand: (...) Teil unseres Konzeptes ist es, dass Leute uns Mails schicken können mit Fragen. Das Ganze ist immer anonym. Auch hier können Fragen gestellt werden, derjenigen, die dem Podcast hier mit beiwohnen. Zum Beispiel hat uns eine Mail erreicht: Wie sinnvoll ist es eigentlich, so eine Ersatztherapie zu machen, mit Polamidon oder ähnlichem. Gibt es da Erfahrungen in der Gesprächsrunde, wie hilfreich das ist, ob man damit tatsächlich irgendetwas bewegen kann oder eine Verschnaufpause geben kann?
Uwe Wicha: Ja, also die Substitutionsbehandlung ist eine Überlebenshilfe, das muss man als erstes mal sagen. Und Substitution gibt es nicht für jede Droge. Da sprechen wir jetzt über Heroin. Klassischerweise werden Heroinabhängige substituiert und da geht es darum, niedrigschwellig Überleben zu sichern. Und das kann zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr sinnvoll sein und notwendig. Jetzt ist die Frage Was macht derjenige und wie findet er dann noch andere Hilfen, die er ja trotzdem braucht? Also die Substitution sorgt dafür, dass er diesen Druck nicht mehr hat. Ich muss jetzt konsumieren, aber das, was in seinem Kopf passiert ist, was die Abhängigkeit getan hat, das ist damit nicht erledigt. Jetzt braucht er eigentlich noch eine ganze Menge an anderer psychosozialer Unterstützung. Und genau da fehlt es aber dann.
Stephan Wiegand: Beispielsweise Eine Wohnung.
Uwe Wicha: Wäre gut.
Maksymilian Markieton: Wäre gut oder eine ambulante Therapie, eine ambulante Therapie. Wobei ich denke, dass eine Substitution ohne eine begleitende Behandlung therapeutisch gar nicht verschrieben wird. Also sollte.
Uwe Wicha: Das Wort sollte spielt hier eine große Rolle.
Stephan Wiegand: Und das Schöne bei mir ist, dass ich mich nicht an Konzepte halten kann, sondern quer durch den Gemüsegarten diese Fragen immer bringen kann. Was sind eigentlich Drogen? Also worüber reden wir? Wenn wir Drogen als Sammelbegriff nehmen? Beginnt das beim Kaffee? Beginnt das bei einer Zigarette oder beginnt das erst bei Heroin? Frau Stock holt Luft.
Ann-Kathrin Stock: Genau. Ich hoffe, die Luft reicht. Also Drogen kann man auf verschiedene Arten definieren. Zunächst einmal Eine ganz gängige Definition ist, dass Drogen eine gewisse Abhängigkeitserkrankung erzeugen können. Das heißt, dass es Substanzen sind, die zu einer Freisetzung typischerweise von Dopamin führen im Belohnungszentrum des Gehirns. Und je höher diese Freisetzung ausfällt und je schneller sie erfolgt, desto größer ist in der Regel das Suchtpotenzial. Weil gerade die Veränderung des Dopaminspiegels in diesem Belohnungszentrum für uns ein Hinweisreiz ist zu lernen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas Leckeres esse oder eine gute Unterhaltung habe, schütte ich Dopamin aus und ich lerne. Das war gut für mich. Mach das noch mal! Wenn ich hingegen mich an einer heißen Herdplatte verbrenne, merke ich in der Regel, der Dopaminspiegel sinkt. Das war schlecht. Mach es nicht noch mal! Und Drogen haben eben typischerweise die Fähigkeit, eine sehr starke, sehr schnelle Erhöhung dieses Dopaminspiegels im Belohnungszentrum auszulösen und dementsprechend einen unnatürlich starken Lerneffekt zu erzeugen, der mich an einen Punkt bringt, wo ich eben sehr schnell lerne, das war gut, macht das noch mal! Und wenn ich diese Erfahrung oft genug wiederhole, komme ich eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an eine abhängiges Verhalten. Man muss aber auch sagen, nicht alle Drogen haben gleichermaßen diesen Effekt. Zum Beispiel hat Crystel einen stärkeren Effekt auf das Belohnungszentrum als Alkohol. Es gibt auch Drogen, die einen sehr kleinen Effekt auf das Belohnungszentrum haben, zum Beispiel MDMA oder Psilocybin. Das heißt, diese Drogen können dennoch abhängig machen, weil der Effekt als angenehm erlebt wird. Aber das Belohnungszentrum wird nicht gleichermaßen stark angesprochen.
Marie-Luise Rohm: Kann man das messen? Also kann ich auf molekularbiologischer Ebene an irgendeinem Punkt feststellen Ab diesem Moment ist der Drogenkonsumierende süchtig oder nicht?
Ann-Kathrin Stock: Also es gibt eine Reihe von Tierstudien, weil manche Dinge kann man am Menschen nicht ohne Weiteres messen. Ein ganz klassischer Versuch ist tatsächlich das Mäusebordell. In diesem Mäusebordell werden tatsächlich kleine Mäuseriche gehalten und die dürfen einen Tag lang sich ausleben. Und anschließend kommt die Mäuse Guillotine. Es gibt den Kopf ab und das Belohnungszentrum wird untersucht und es wird geschaut, Wie viel Dopamin wird ausgeschüttet in diesem Belohnungszentrum? Das kann man vergleichen mit Drogenkonsum, den diese Mäuse dann beispielsweise erhalten. Und daran kann man auch festmachen, wie stark abhängigkeitsmachend eine Droge ist. Und wenn man lang genug etwas einnimmt, führt es in der Regel zu einer Gewöhnung. Und diese Gewöhnung führt dazu, dass der Effekt immer kleiner wird und dementsprechend auch größere Mengen der Substanz eingenommen werden müssen, um noch die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und auch diese Toleranzbildung kann eben zum Beispiel ein Maß dafür sein, wie abhängig ich bin. Aber das ist ein körperliches Maß, kein psychisches. Dazu kann vielleicht auch der Max noch ein bisschen was sagen.
Maximilian Pilhatsch: Na ja, das ist ja auch Synonym zu dem unstillbaren Verlangen, fast zwanghafter Konsum. Das heißt, das ganze Leben verengt sich eben auf das Wollen der Droge. Andere Dinge werden vernachlässigt, andere Dinge ausgeblendet. Das Belohnungssystem wird manipuliert. Das hat Frau Stock, denke ich, sehr, sehr schön erklärt. Und das Problem liegt dann auch darin, dass die Gehirne der Betroffenen dann nicht mehr so empfänglich sind für diese normalen Verstärker. Die Frau Stock zum Beispiel auch genannt hat Gutes Gespräch, leckeres Essen. Es kommt dann sozusagen gar nicht mehr so als Belohnung, als etwas Positives an? Das kann dann wiederum ein Teufelskreis sein, weil letztlich wird ja immer wieder der, der Suchtstoff benötigt immer wieder aufs Neue. Toleranzentwicklung setzt ein. Normale Verstärker haben es umso schwerer. Irgendwann gehen auch die Hirnareale kaputt, die für diese normalen Verstärker zuständig sind. Und es ist dann sehr, sehr schwer, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen.
Maksymilian Markieton: Und sagt mal, ist das nicht so, dass Nikotin auch einen sehr hohen Dopaminausstoß hat oder habe ich mich da. Also es ist vergleichsweise für den für den Effekt ist das doch ein sehr hoher Ausstoß. Deswegen ist es ja auch so schwierig von Zigaretten wegzukommen.
Ann-Kathrin Stock: Also Nikotin kann man tatsächlich schon bei anderen harten Drogen wie beispielsweise Kokain ähnlich eingruppieren von dem Dopaminausstoß her. Aber es gibt durchaus Stimulanzien wie Amphetamine, die da noch deutlich mehr bewirken.
Marie-Luise Rohm: Gibt es auch Faktoren, die man jetzt bei den Konsumenten benennen kann, die einen anfälliger für ein Suchtverhalten machen oder nicht? Und sind die sogar vererbbar?
Ann-Kathrin Stock: Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren über die sozialen Faktoren bin ich vielleicht nicht der beste Ansprechpartner, um das jetzt gut zu beantworten, aber es gibt zum Beispiel Unterschiede darin, wie die Hirnchemie funktioniert, das heißt wie viel Botenstoffe ich von bestimmten Arten der Botenstoffe schon mitbringe. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel einen geringen Dopaminspiegel haben, sprechen möglicherweise anders auf Drogen an als Menschen, die einen hohen Dopaminspiegel mitbringen. Es gibt aber auch natürlich Faktoren, beispielsweise wenn es in der Familie schon eine Suchtgeschichte gibt oder dysfunktionales Verhalten erlernt wurde. Im Umgang mit bestimmten Substanzen kann das einen großen Faktor spielen. Aber jetzt zum Beispiel auch schon gesagt Stress ist ein großer Faktor, weil viele Menschen eben auch als Coping, also als Bewältigungsstrategie, dann beispielsweise zu Substanzen greifen können. Auch muss man sagen, es hat auch ein bisschen was mit der Körperlichkeit zu tun. Das heißt, Frauen haben zum Beispiel meistens ein geringeres Körpergewicht im Schnitt, haben einen höheren Fettanteil im Körper. Das heißt, Drogen wie Alkohol oder auch MDMA wirken stärker, das heißt, bei gleicher Dosis kann mitunter auch schon schneller ein schädlicher Effekt einsetzen oder vielleicht auch eine Abhängigkeit entwickelt werden, weil einfach die Wirkung dann stärker ausfällt.
Marie-Luise Rohm: Und was wären jetzt soziale Faktoren, die man da mit einbeziehen könnte?
Maksymilian Markieton: Also wenn jemand nicht gelernt hat, sich auf natürliche Weise sein Dopamin abzuholen und das dann irgendwann in der Kindheit bekommt und wahrscheinlich im ersten Konsum überrascht ist von der angenehmen Wirkung, ist diese Person möglicherweise nicht so resilient wie jemand, der über Sport, über Musik, kreatives Schaffen stößt ja auch erwiesenermaßen sehr viel Dopamin aus. Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten als soziale Faktoren. Wo kannst du einsetzen in der Prävention, das heißt, wo kann man einsetzen? Und das sind ganz basale Geschichten Verteilungsgerechtigkeit, Freizeitangebote schaffen für Kinder. Dass dann so etwas, wenn es nicht im Elternhaus gelernt wird, auf einer anderen Art und Weise erlernt werden kann, wo die Gesellschaft vielleicht eine Verantwortung dazu trägt. Du hast es ja auch schon gesagt, also auch den schädlichen Konsum zu lernen, den lernt man ja genauso auch aus dem Elternhaus. Kleine Geschichte nebenbei Es geht ja darum, dass Kinder von der Auffälligkeit des Jugendamtes in bestimmte Altersgrenzen reingebracht werden. Das Jugendamt schaut sehr genau hin, wenn Kinder sehr klein sind, schaut sehr genau hin, wenn sie geboren werden, in der Schwangerschaft. Wir haben in der Uniklinik das Mama, denk an mich Programm für konsumierende und abhängige Mütter. Dann schaut es hin, wenn sie in die Kita kommen, vielleicht noch in der Grundschule und irgendwann fallen die nicht mehr so in den Rahmen und dann kommen die erst wieder beim Jugendamt an, wenn sie selbst konsumieren. Und da hast du eine Lücke, da hast du eine Lücke, wo die unauffällig sind, wo sie zu Hause bei den Eltern sind, die möglicherweise konsumieren. Und hier kann man ansetzen. Eine Resilienz, also Resilienz ist quasi die Fähigkeit, trotz widriger Umstände ein gutes Leben zu schaffen oder selbst zu führen. Das kann gefördert werden und das ist eine Möglichkeit, wo Prävention ansetzen kann.
Stephan Wiegand: (...) Eine Frage ist uns gerade gestellt worden ist, hier aus dem Publikum. Sie reden von Dauersüchtigen. Was ist denn mit Wochenendkonsumenten? Wo ordnen Sie diese Drogen wie Kokain, Ketamin oder MDMA ein? Alle trinken Alkohol, und es ist okay. Wo ziehen Sie die Grenzen für okay des Konsums? Also alle zusammenholen. Luft, bitte.
Ann-Kathrin Stock: Also, es kommt immer ein wenig drauf an. Ich habe tatsächlich auch Studien, wo wir eben genau das simulieren. Also, das heißt, es kommen junge Männer her und die bekommen sogar noch Geld dafür, dass sie dann am Wochenende in sehr kurzer Zeit auf leeren Magen eine Menge Schnaps trinken. Und dann schauen wir auch, was das macht. Die Ergebnisse überraschen insofern, als dass die Ausfälle nicht so uniform sind, wie wir immer dachten. Das heißt, manche Funktionen fallen recht schnell und zuverlässig aus, andere sind durchaus noch lange zu erhalten, was wir nicht immer so erwartet hätten. Herr Pilhatsch hat ja auch schon gesagt es ist im Prinzip ein ganz wichtiger Faktor, ob es Probleme macht. Das heißt, wenn Probleme auftreten, selbst nur bei Wochenendkonsum ist es dennoch problematisches Verhalten. Das heißt, wenn ich regelmäßig Unfälle baue, weil ich am Wochenende zum Beispiel betrunken war oder wenn ich regelmäßig in der Notaufnahme lande, weil ich vielleicht zu viele Tabletten eingenommen habe, die ich nicht vertragen habe, dann ist das auch schon am Wochenende natürlich ein Problem. Aber was wir sehen, ist, dass die Toleranzbildung, die eben auch zu Entzugsproblematiken führt und auch weiterhin eine Motivation schafft, viel zu konsumieren, sich stärker ausbildet, wenn täglich konsumiert wird, als wenn es sich auf das Wochenende beschränkt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Wochenende allein nur harmlos ist. Wir haben zum Beispiel auch mal unsere Studenten und Studentinnen angeschaut, haben da eine Studie gemacht, die wir nicht veröffentlicht haben, weil die Ergebnisse nicht ganz so eindeutig waren, wie wir es uns erhofft hätten. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es bei jungen Männern einen kleineren Unterschied macht, ob sie am Wochenende viel trinken als bei jungen Frauen. Die Welt ist ein bisschen ungerecht. Das führte deutlich schneller zu Leistungsdefiziten, wenn sie denn sehr viel getrunken haben am Wochenende. Das heißt, da muss man tatsächlich auch sagen, die Biologie ist nicht gerecht. Aber es gibt Unterschiede, wer wie schnell betroffen ist auch beispielsweise.
Maximilian Pilhatsch: Darf ich dazu kurz was ergänzen zu der Frage? Wir haben ja ein großes Suchtforschungsprojekt, Das nennt sich Verlust und Wiedererlangung der Kontrolle bei Drogenkonsum. Und das ist eines der größten Suchtforschungsprojekte, die es je in Deutschland gegeben hat. Jetzt zweite Förderperiode bei der TU Dresden, sozusagen bewilligt worden von der DFG. Und dort haben wir die Trinkmuster von ungefähr 900 Teilnehmern, die leicht bis mittelschwer alkoholkrank sind, gemonitort. Und da war ganz auffällig eben dieses Trinkmuster, dass die am Wochenende sehr viel getrunken haben. Dann Mittwoch auch noch mal vermehrt Montag, Dienstag, Donnerstag dann in der Regel weniger. Man muss sagen, dass die halt eben auch schon mittelschwer alkoholkrank waren. Das heißt, es ist schon auch nicht unproblematisch, dieses Muster. Und aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, wenn man diese Denke hat, so nach dem Motto am Wochenende, da gönne ich mir das. Da geht es mir gut. Umso schlimmer ist der Absturz dann am Montag. Da leidet unterm Strich aus meiner Erfahrung die Lebensqualität, weil letztlich die Tage, an denen nicht konsumiert werden darf, an denen der Konsum sich verboten wird. Die haben eine viel, viel geringere Qualität als die anderen Tage.
Uwe Wicha: Vielleicht muss man auch noch mal gucken für sich selbst. Wann bekommt mein Konsum eine Funktionalität? Also wann soll der im Leben irgendwas ersetzen, was ich sonst. Was ich gerne hätte, aber nicht kriege. Und wenn wir unsere Klienten angucken, dann ist es oft auch so Übergänge vom Kind zum Jugendlichen, Entwicklungsaufgaben, vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Eine weitere Entwicklungsaufgabe, die ja nicht leicht fallen muss. Vielleicht muss man den Mädchen oder den Jungs gefallen. Solche Dinge spielen eine Rolle. Vielleicht hat man Probleme mit den Eltern. Man weiß nicht so richtig, wo man sich dazugehörig fühlt. Und dann bekommt der Konsum eine Funktion. Und wenn der Konsum eine Funktion bekommt, dann wird es meist problematisch, wenn der Konsum das einzige Mittel wird, um zum Beispiel Gestimmtheit zu verändern. Also wenn Sie merken, ich kann mich nur wieder runterfahren, ich kann mich nur beruhigen, wenn ich da zwei Bier getrunken habe, dann würde man schon sagen, hier müsste man mal genauer hingucken. Wenn Sie nur in Feierlaune kommen, wenn Sie eine Nase Koks sich reingezogen haben, dann würde man auch hingucken müssen. Also das sind so ein paar Dinge, auf die man achten würde. Und wenn ich die Lebensgeschichten unserer Klienten angucke, dann ist es nicht selten so, dass die aus diesem Ich habe doch nur am Wochenende konsumiert. Langsam aber sicher rüber rutschen in den Montag. Also die konsumieren zum Beispiel am Wochenende Crystal, weil die Party dann eben am Freitag losgehen kann und erst am Sonntag aufhört. Und nu ist aber der Montag da und es fällt ihnen ein, jetzt wäre Schule dran oder jetzt wäre Arbeit dran und irgendwann erinnern die sich dran. Es hat mir geholfen, diese Party 24 Stunden durchzuhalten. Warum soll ich nicht am Montagmorgen es auch hinkriegen, dann wieder was einzuwerfen oder durch die Nase zu ziehen, um in die Schule zu gehen oder zur Arbeit? In der Retrospektive sagen diese Klienten dann häufig Ich habe ja nur Crystal genommen wegen dem Leistungsdruck. Also das verschiebt sich dann auch in der Wahrnehmung, in der Retrospektive.
Maksymilian Markieton: Da hast du aber Crystal Meth wirklich als eine kleine Ausnahme. Es ist ja leistungssteigernd und es gibt eine sehr große Dunkelziffer, bin ich sehr der Meinung von Menschen, die das konsumieren, tatsächlich um die Leistung zu steigern. Also hatte ich auch schon. Wenn man sich überlegt, dass manche Leute am Bagger sitzen und C (steht für Crystal) genommen haben in der Früh. Nee, das gibt es auch.
Uwe Wicha: Im LKW gibt es das auch nicht selten.
Uwe Wicha: Aber es gibt eine Universitätsklinikum in Hamburg hat eine große Studie zu Crystalkonsumenten gemacht. Es ist sehr häufig dieses leistungssteigernde Argument vorgebracht worden. Es passt aber nicht zur Berufsbiografie, relativ häufig. Weil wir haben bei den Klienten oftmals natürlich die Tendenz, ich muss ja meinen Konsum irgendwo rechtfertigen, ich muss das der Mutter erklären, ich muss das irgendjemandem in der Gesellschaft erklären. Und dann gibt es ein paar Erklärungsmuster, die eher aufgenommen werden als andere. Hedonismus gilt in unserer Gesellschaft nicht als hinreichende Erklärung. Auch wenn ich gelernt habe, dass die Wissenschaftlerin in unserer Runde ein Mäusebordell betreibt.
Ann-Kathrin Stock: Nein, das habe ich leider nicht vor Ort. Ich arbeite nur mit Menschen. Aber die Chiara hat das in den 80er Jahren gemacht.
Uwe Wicha: Ich bin ganz erstaunt, was es alles gibt in der Wissenschaft.
Ann-Kathrin Stock: Aber man muss sagen, es ist einem Herren eingefallen, dieses Experiment. Aber was auch ein Punkt ist Ich habe auch Menschen vor der Flinte, die nicht unbedingt eine Behandlung suchen oder in dem Moment benötigen, sondern einfach nur an Studienteil nehmen. Und wir haben wirklich alles von der alleinerziehenden Mama, die zwei Nächte durchgemacht hat und dann am nächsten Tag noch im Schichtdienst funktionieren muss. Vom Möbelpacker, der einen doppelten Bandscheibenvorfall hat und am nächsten Tag ein Klavier schleppen muss, von einem ausgebrannten Schreibtischarbeiter, der vielleicht irgendwie noch weiter funktionieren möchte. Aber viele, muss man schon sagen, sind über die Feier erst mal an die Substanz gekommen. Das heißt, man geht meistens nicht Dienstagmorgens ins Büro und dann sagt die Kollegin Möchtest du mal Crystal probieren? Dann sagt man ja. Die meisten haben es eher auf Feiern zuerst ausprobiert und sind dann später auf die Idee gekommen, auch einen funktionalen Konsum daraus zu machen.
Stephan Wiegand: Eine Frage, die noch aus dem Publikum gestellt wurde Wie sieht denn das eigentlich aus? Kann ich meine Tochter und meinen Sohn, meinen Enkel in so einer Suchtklinik abgeben? Und dann wird denen geholfen? Was kriegen die Eltern mit auf den Weg? Gibt es da Beispiele dafür? Kann man das irgendwie ein bisschen plastisch machen, damit man vielleicht auch A) die Scheu verliert oder B) auch so sieht na ja, das kommt auf die Leute drauf zu. Herr Wicha.
Uwe Wicha: Der Weg ist so, dass es in jeder Stadt eine Sucht oder Drogenberatungsstelle gibt. Und das ist eine hilfreiche Institution, an die man sich wenden kann. Und es gibt natürlich auch Entgiftungseinrichtungen. Das ist das, was der Entwöhnungsbehandlung vorgeschaltet ist. Also in der Entgiftungseinrichtung wird der körperliche Entzug überwunden, die körperliche Entgiftung gemacht und die Entwöhnungsbehandlung. Das ist das, was wir dann tun. Da geht es um den Kopf. Nicht, dass es in der Entgiftung nicht auch um den Kopf ginge, das ist mir schon klar. Aber um es mal plastisch zu sagen Ich werde gerade kritisch angeguckt von den Mitdiskutanten. Ich habe es ein bisschen zu sehr vereinfacht. Man kann das Kind natürlich nicht abgeben und bei so einer Krankheit wie Sucht ist es eben nicht so, Da kommt ein Experte und stellt an vier Stellschrauben rum und dann klappt es wieder. Das funktioniert nicht so ganz, sondern so eine Krankheit braucht immer die Mitwirkung desjenigen, der betroffen ist und natürlich auch die Mitwirkung des gesamten familiären Systems. Also Angehörige müssen sich auch darauf einstellen, dass sie in die Therapie mit einbezogen werden, über Angehörigengespräche, über mögliche Auseinandersetzungen auch mit dem Kind, über das, um was es geht. Und dann kann das schon funktionieren. Die meisten Eltern werden aber leider die Erfahrung machen, sie sehen das Problem, aber das konsumierende Kind sieht es nicht. Das ist eigentlich immer das große Problem.
Marie-Luise Rohm: (...) Ich würde da gern nochmal genauer nachfragen Welche Ziele kann man sich denn als angehörige Person oder als betroffene Person selber für so eine Therapie setzen? Ist eine lebenslange Abstinenz ein realistisches Ziel oder auf welches Outcome muss ich mich da einstellen?
Uwe Wicha: Ein vernünftiges Ziel ist tatsächlich Abstinenz. Wenn ich einmal mir eine Sucht ins Hirn gezimmert habe, dann wird das mit dem kontrollierten Konsum dummerweise nicht mehr funktionieren, sondern dann brauche ich eine Überzeugung davon. Jetzt geht nur noch Abstinenz. Nun muss man natürlich sagen. Wer kann sich das denn vorstellen. Können sich das 16-jährige, also in unserer Klinik nehmen wir schon 16-jährige auf, die bei uns einen Schulabschluss machen können, können die sich das vorstellen? Das können die sich nicht am Anfang der Therapie, das heißt, die müssen erst dazu gebracht werden, ein Lebensbild zu entwerfen, Ziele sich zu stecken, Ideen zu haben, wer sie sein wollen und dann verstehen, wie diese Krankheit funktioniert. Dann kommt so ein psychoedukativer Teil dazu, dass auch dann über Ratio was funktionieren muss und dann sagen, das alles, was ich mir hier erträume, erarbeite, wie mein Leben sein soll, das kann ich nur dann bekommen, wenn ich Abstinenz habe und wenn ich die halte. Sagen wir mal, es gibt Menschen. Es gibt immer so Beispiele, dass man sagt aber ich kenne doch den und bei dem hat es doch so geklappt und bei dem hat es so geklappt. Ich kenne auch Leute, die haben Russisch Roulette mit einem Revolver gespielt, wo fünf Kugeln drin waren, und eine Kammer war leer. Die haben überlebt. Das ist ja auch immer die Frage bei einer, bei so einer schweren Erkrankung. In welches Risiko gehe ich denn? Wir haben ganz viele Klienten, die sagen Ich bin bestimmt derjenige, der es mit einem kontrollierten Konsum schafft. Dann sage ich, Es waren schon ein paar 100 da. Die Wetten stehen sehr deutlich gegen dich. Aber wir sehen uns hier wieder.
Maksymilian Markieton: Und das ist erlaubt. Also es sind gerade bei Langzeittherapien. Ich weiß nicht. Wie viele habt ihr, die regelmäßig da sind? Also schon immer mal ne?
Uwe Wicha: Ne, ne, ne.
Maksymilian Markieton: Bei euch ist Zauberland.
Uwe Wicha: Ne bei uns ist kein Zauberland, sondern bei uns ist es so, dass Klienten maximal zweimal kommen, weil wir. Wenn jemand ein drittes Mal kommen will, sagen, dann sind wir vielleicht nicht das richtige Angebot für deine ganz spezielle individuellen Bedürfnisse einer Behandlung. Also das hat nichts mit Zaubern zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir wissen, dass wir nicht für jeden das richtige Angebot haben.
Ann-Kathrin Stock: Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass es ja auch gerade gefragt Wie ist das? Kann ich für jemanden ein Ziel fassen? Fakt ist Das kann ich nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach Hause und sagen zum langjährigen Mann oder zur langjährigen Frau. Schatz, ich habe mir das lange überlegt. Du musst jetzt mal 30 Kilo abnehmen. Wie wird das wohl laufen, wenn der Wunsch beim Gegenüber nicht da ist, eine große Anstrengung zu unternehmen, etwas Fundamentales im Leben zu ändern? Wird das in der Regel auf sehr viel Widerstand stoßen. Das heißt, Angebote kann man machen, man kann auch unterstützen oder sagen Wenn du an dem Punkt ankommst, wo du das so siehst wie ich, unterstütze ich dich. Aber ein Ziel für einen anderen Menschen sich vornehmen und das dann erreichen. Wir wissen alle, wie schwer es ist, uns selbst zu ändern, einen anderen Menschen, der das nicht mal will, zu ändern, ohne dass dieser darin eingestimmt hat, ist ein vorsichtig ausgedrückt sehr ambitioniertes Vorhaben.
Marie-Luise Rohm: Und Sie hätten auch mit dem Kopf geschüttelt. Vielleicht wollen Sie.
Maximilian Pilhatsch: Vielleicht genau daran anschließend diese Frage Was kann man als Angehöriger machen? Betrifft ja das Problem dieser sogenannten Coabhängigkeit, dass man einfach durch seine Verhaltensweisen aus guten Motiven häufig aus Liebe um. Um einfach diese negativen Konsequenzen des Betroffenen abzupuffern, für denjenigen einsteht und dabei leider genau das Falsche erreicht, nämlich die Sucht noch stärker zementiert. Klassisches Beispiel Vielleicht jemand, der schon so viel getrunken hat, dass er keinen Alkohol Nachschub selber besorgen kann, dem dann vielleicht noch die Alkoholika bringen. Oder vielleicht auch Eltern, die sehr gut mit ihren Kindern meinen, bei einem Drogenverstoß im Verkehrsrecht zum Beispiel dann den besten Anwalt holen, um ihn da rauszuholen. Das ist sicherlich gut gemeint, aber am Ende verhindert man dadurch die Konsequenzen, die aus meiner Sicht notwendig ist, um eine Verhaltensveränderung bei den Betroffenen herbeizuführen. Das will ich auch noch mal unterstreichen. Also ohne die Motivation und wirklich eine starke Motivation des Betroffenen gibt es da aus meiner Sicht keinen. Keinen Weg raus aus der Sucht.
Maksymilian Markieton: Es gibt noch eine Sache, die gerade zum Thema Abstinenz erwähnt werden sollte. Abstinenz bedeutet dann wirklich gar nichts mehr. Also weil bei der Sucht ist ja so eine tricky Krankheit, das gibt sowas nennt sich Suchtgedächtnis und dem ist es eigentlich relativ egal, welche Substanz konsumiert wird. Wir haben Das Phänomen der sogenannten Suchtverlagerung erleben wir immer wieder bei uns zum Beispiel in Mutter Kind WGs oder was auch immer da gerade stationär bei uns in der Firma auch ist. Das kann bis zu Energydrinks gehen, das dann halt eben in großen Mengen solche Sachen konsumiert werden. Auch das muss dann restriktiv behandelt werden, auch sehr genau angeschaut werden. Es gibt auch so was wie Verhaltensrückfälle. Das sind ja auch solche Sachen, da muss nicht mal konsumiert worden sein. Nur die alten Verhaltensweisen werden dann halt wieder aufgelebt. Und das heißt halt wirklich eine Therapie, Uwe, was ihr macht, Hut ab. Das ist wirklich eine sehr, wie soll ich sagen, eine Reprogrammierung. Also in der Mitarbeit der Klientinnen der Patientin.
Uwe Wicha: Zur Motivationsfrage noch was sagen. Wir haben ja viele 16-jährige 17-jährige, die bei uns sind. Und da ist es durchaus nicht so, dass die ganz stark eigenmotiviert sind von Anfang an. Ja, die Zeit muss man auch lassen, dass erst Motivation wachsen kann. Da ist bei den Jugendlichen oftmals eine extrinsische Motivation da. Mit anderen Worten die Mutti steht dahinter. Wenn ich da frage Warum bist du denn zu uns gekommen? Dann sagt derjenige oder diejenige die Mutti hat das für mich ausgesucht. Und das ist dann auch wirklich hilfreich, wenn die Eltern dann mal sagen, das ist jetzt dran. Und dann ist es unsere Aufgabe, ein Angebot herzustellen und bereitzustellen und eine Begegnung bereitzustellen, wo jemand dann langsam auch reinwachsen kann und sagen kann Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Das erwarten wir nicht von Anfang an.
Marie-Luise Rohm: Herr Pilatsch. Vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, auf die sogenannten Rückfälle. Wie kann man mit so was umgehen? Im Rahmen einer kompletten Therapie gibt es das?
Maximilian Pilhatsch: Ja, Danke für die Frage, weil Herr Wicha hat es ja schon gesagt. Abstinenz. Natürlich ist es das Ziel, aber viele, viele können sich das nicht vorstellen. Und viele Menschen erreichen wir mit dem Suchthilfesystem noch nicht. Vielleicht auch, weil sie denken, ich kann mir nur Hilfe holen, wenn wirklich mein Ziel ist, die komplette Abstinenz. Und das stimmt so nicht. Wir versuchen natürlich auch Leuten zu helfen, wenn die sagen ich will erst mal die Trinkmenge nur reduzieren oder die Substanzmenge nur reduzieren. Natürlich immer mit dem Fernziel Abstinenz. Aber wie gesagt, man muss den Patienten auch da abholen, wo er steht. Und ähnlich gilt es für Rückfall. Ich bin auch nicht geneigt zu sagen wenn es zu einem Rückfall kommt, ist die ganze Therapie sinnlos gewesen, sondern man kann ja die Therapieziele auch ein bisschen anders formulieren, zum Beispiel eine Trinkmengen Reduktion zum Beispiel Tage ohne Konsum, zum Beispiel Zeit bis zum Rückfall verlängern, dann auch einen Plan für den Rückfall frühzeitig auch machen, dass der Rückfall auch nicht mehr so lange dauert, wenn er denn mal eintritt. Damit muss man immer rechnen. Deswegen Ich glaube, es ist wichtig, wenn es zum Rückfall kommt. Das ist ja mehr als wahrscheinlich, dass es dann irgendwann auch mal zum Rückfall kommt, dafür auch einen guten Plan zu haben.
Marie-Luise Rohm: Und ist das dann ein Leben mit der Sucht zwischen Rückfall und Rückfall? Oder ist dann die Abstinenz doch möglich?
Maximilian Pilhatsch: Ja, in vielen Fällen ist es so, aber das heißt für mich jetzt nicht zwangsläufig, dass die Lebensqualität dann unbedingt sehr, sehr schlecht sein muss. Wenn die Zeit zwischen den Rückfällen lang ist, dann kann da ja durchaus etwas was aufgebaut werden und ist aber schon so, dass das im Grunde chronische Erkrankungen sind, wie wir das ja auch hier jetzt gehört haben und dass natürlich immer die Rückfallgefahr da ist.
Uwe Wicha: Ich bin deutlich optimistischer, weil ich viele Menschen kenne, die wirklich über meine Arbeit auch mit Selbsthilfegruppen, gerade bei Alkoholikern, die ja über die Selbsthilfe sich eine Organisation geschaffen haben, wo sie viel Halt kriegen und wenn das Süchtigen gelingt, Lebensumstände zu schaffen, Gemeinschaft zu schaffen, dann ist es sehr gut möglich, dass sie auch über viele Jahrzehnte clean bleiben. Vielleicht auch das ganze Leben. Natürlich ist es so, dass ein Rückfall und da hat man im Laufe der Jahrzehnte gelernt in der Behandlung ein Rückfall muss nicht notwendigerweise zum Abbruch der Behandlung führen. Er muss auch nicht alles in Frage stellen. Derjenige muss aber in der Lage sein, zumindest gilt das für die stationäre Langzeitentwöhnung, offen mit dem Rückfall umzugehen. Also wenn jemand bei uns im Haus rückfällig wird, dann müssen wir es von ihm wissen, weil dann das ganze Therapieprogramm sich ändert. Wenn er es uns verschweigt und wir erst über eine Urinprobe oder eine Atemalkoholtest darauf kommen, dann hat er uns ja sozusagen den Arbeitsauftrag entzogen, weil dann hat er gesagt, das wäre ein ganz wichtiger Teil in seiner Behandlung, in meiner Behandlung. Aber darüber rede ich nicht. Dann können wir es auch sein lassen. Und ich glaube, das sind dann zwei unterschiedliche Perspektiven, die die Entwöhnung und die Entgiftung hat. Weil die Entwöhnung ist sehr, sehr hochschwellig. Das ist sozusagen das hochschwelligste Angebot, das wir, dass wir anbieten.
Marie-Luise Rohm: (...) Ich möchte noch mal auf ein Thema eingehen, was wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten hatten. Wenn ich in meinem Umfeld jemanden wahrnehme, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, alle Kriterien, die jetzt schon so genannt wurden, treffen vielleicht auf diese Person zu. Wann sollte ich so was ansprechen? Sollte ich so was ansprechen? Wen sollte ich eher ansprechen? Gibt es eine Möglichkeit für mich als Mitmenschen, da irgendwie positiv einzuwirken?
Maksymilian Markieton: Also wir haben das ja fast täglich, dass wir es möglicherweise ansprechen müssen. Zu sagen, kannst du dir eventuell vorstellen, dass es dir nicht nur deswegen so schlecht geht, weil die ganze Welt gegen dich ist, sondern weil möglicherweise auch dein Konsumverhalten so ist, wie es ist? Ich sage mal, wenn Leute wirklich dann auf der Straße sind, die können das schon sehr gut reflektieren das die merken ja klar, wenn ich jetzt hier ständig auf C sein muss und da ist dann halt am Anfang des Monats mein Geld weg und dann ist das die können das. Es gibt aber auch andere, da ist es ein bisschen schwieriger. Konfrontativ ist es immer, sehr schwierig. Man muss dann, wenn man diesen Schritt wagt, glaube ich, als Angehöriger auch damit rechnen, dass dann ein Beziehungsabbruch erfolgt. Es ist risikoreich, dass so eine Ansage stellt, glaube ich, jede Beziehung sehr auf die Probe. Es ist auf der anderen Seite, auch wenn man das so verpackt und wenn man das so geframed kriegt für die Person, die man anspricht, in dem Fall, dass das ein Zeichen von Zuneigung und Sorge ist, das so zu formulieren, dann ist das vielleicht auch möglich. Allerdings, man muss sich da auch bewusst machen, Also so eine sehr starke Abhängigkeitserkrankung ist auch ein Beziehungskiller. Das ist wir haben das ja oft also und da reden wir jetzt auch von nicht stoffgebundenen Süchten, also Süchte, die jetzt nur Zeit fressen wie Spielsucht oder Mediensucht oder sowas, wo Substanzen keine Rolle spielen, das Dopamin aber trotzdem schön feuert. Also, aber die lassen wir heute mal außen vor, das würde sonst den Rahmen sprengen, wo ich das auch für ein sehr wichtiges Thema halte. Ja, also bitte gut abwägen, nicht flapsig reingehen. Es wäre mein Rat dort, wenn jemand dort ist, sich selber Hilfe suchen. Die Drogenberatungsstellen bieten nicht nur Hilfe für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen an. Sie haben jeder hier das Recht, zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen und zu sagen Ich bin Angehöriger, ich möchte gerne wissen, wie ich damit umgehen soll. Dort können Sie den Fall ganz explizit besprechen. Die bieten das an.
Marie-Luise Rohm: Um den roten Faden von Beginn noch mal herum zu ziehen. Am 12. April wurde bei der Bundespressekonferenz ein neues Konzept für die Cannabislegalisierung veröffentlicht. Was denken Sie persönlich subjektiv? Wie kann man dieses politische Geschehen unter dem jetzt Gesagten und den ganzen Thesen, die aufgestellt wurden, einordnen? Vielleicht beginnen wir bei Herr Wicha.
Uwe Wicha: Also wenn ich persönlich subjektiv darüber reden soll, dann werde ich ausfällig. Dann würde ich sagen, das ist Schwachsinn. Also da hat jemand nicht begriffen, wie Sucht funktioniert. Und da hat jemand nicht begriffen, die Gesetzgeber haben nicht begriffen, wo die Problematik liegt. Also wir wissen ja, das Hirn ist ausgereift, wenn wir 21, 22 oder 23 sind und vorher nicht. Und wenn ich vorher da so eine Cannabis inhaliere, ist das mehr als schädlich. Und da frage ich mich, wie kommt man auf die Idee, das ab 18 freizugeben? Also alleine das schon ist vollkommen neben der Spur und das wissen diese Leute ja auch. Die wissen tatsächlich, ja, das ist das Problem. Jetzt gibt es ein paar Hoffnungen, die die haben, die man sich im Einzelnen angucken könnte und wo man sagt ja, vielleicht gelingt das und das wäre schön, wenn es gelingen würde. Eins ist Wie wäre es denn, wenn wir es schaffen, den Schwarzmarkt damit auszutrocknen? Sozusagen. Und das wird garantiert nicht funktionieren, weil unter kontrollierter staatlicher Abgabe kann das Produkt nie so billig sein wie auf dem Schwarzmarkt. Es sei denn, wir subventionieren es. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Was wird noch passieren? Der Schwarzmarkt wird darauf reagieren, indem die Menschen, die jetzt dealen, sagen Ich lasse mir doch nicht mein Geschäft wegnehmen. Ich habe bisher gut davon gelebt. Und jetzt muss ich entweder gucken, kann ich neue Käuferkreise erschließen. Das sind dann Jugendliche, die noch nicht im Social Club Mitglied werden können oder nicht im Fachgeschäft kaufen dürfen. Also was müssen die machen? Sie müssen weiter zum Dealer gehen. Oder aber es wird ein neuer grauer Markt entstehen. Das sind die älteren Brüder und Schwestern und Kumpels, die dann was mitbringen. Das kennen wir beim Alkohol auch. Genau das wird passieren. Das ist in anderen Ländern auch passiert. Also das wird nicht funktionieren. Dieser Teil kann nicht funktionieren, denn die Dealer werden eine weitere Lücke angehen. Die wird eine Angebotserweiterung und Veränderung machen. Wenn mir gewisse Leute kein Cannabis mehr abkaufen, muss ich ein größeres Sortiment anbieten. Das ist einfach nur ökonomisch gedacht. Das sind Leute, die wollen Geld verdienen, die denken ökonomisch. Und dann wird es so sein, dass natürlich für jemanden, der den Rausch sucht, das hochpotente Rauschmittel mehr wert ist als das Niedrigpotente. Nun wird es aber in den Fachgeschäften nur niedrigpotente Rauschmittel geben. Das ist aber für mich als Konsument langweilig. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche den Kick. Ich suche den Rausch. Und den kriege ich nach wie vor bei dem, der ihn mir bisher verschafft hat. Beim Dealer. Und dann haben wir preissensible Kundschaft auf dem Markt. Und die preissensible Kundschaft wird garantiert bei dem Dealer kaufen. Das sind insbesondere die Jugendlichen. So Menschen wie wir, die vielleicht nicht kiffen. Aber nehmen wir mal an, wir würden kiffen. Das wären die Leute, die dann sagen Na, da geh ich doch lieber ins Fachgeschäft Und wenn sie in die USA gucken. Diese Fachgeschäfte sind schön aufgebaut. Es sieht so aus wie in einem Apple Store zum Teil. Und in Kanada, da können sie sich ganz gepflegt einen abholen und können sich die Rübe zuziehen. Da haben sie noch ein ganz tolles Gefühl dabei.
Ann-Kathrin Stock: Und was man vielleicht auch ein bisschen noch mitdenken muss, ist jetzt außer vielleicht gesundheitlichen oder hirnphysiologischen Konsequenzen auch tatsächlich legale Konsequenzen. Denn die Tests, die wir zum Beispiel auf Cannabiskonsum machen, die testen gar nicht auf THC, sondern auf THC COH, also einen Metaboliten, also ein Abbauprodukt, was wir im Körper herstellen, wenn wir das Ganze verstoffwechseln. Und dieses Abbauprodukt kann mitunter sehr, sehr, sehr lange nachweisbar sein. Das heißt, wenn ich beispielsweise regelmäßig konsumiere, kann das passieren, dass ich drei Monate später immer noch positiv teste, obwohl ich schon nichts mehr genommen habe. Und wie ist das dann beispielsweise mit dem Autofahren? Müssen wir jedes Mal einen Bluttest machen? Müssen wir jedes Mal. Zum Beispiel müssen wir jetzt Polizisten ausbilden, Blut, eine Blutabnahme machen zu können oder ähnliches. Das ist ja auch alles noch gar nicht geklärt. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass ich diese ganzen Metaboliten im Fettgewebe ablagern, wenn ich plötzlich sehr viel Gewicht verliere, dass ich plötzlich irgendwann wieder positiv bin, obwohl ich eigentlich in letzter Zeit gar nicht konsumiert habe. Und das sind auch so Probleme, die eigentlich noch nicht richtig zu Ende diskutiert worden sind.
Marie-Luise Rohm: Was ist Ihre Perspektive dazu, Herr Markieton?
Maksymilian Markieton: Ach, wir hatten das. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ja ein suchtspezifischer Träger. Das hat einen großen Impact bei uns gehabt. Wir haben uns die Zeit genommen, das in der Firma selber zu diskutieren. Ich glaube 25 Menschen waren wir da und haben darüber über die Pro und Contra Argumente wirklich zwei Stunden lang sehr heiß diskutiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das für unsere Arbeit überhaupt keinen Unterschied macht. Wir arbeiten mit erkrankten Menschen. Also ich meine jetzt außerhalb der Wohnungsnotfallhilfe. Also wir haben eine Clean WG. Wir haben sozialtherapeutische Jugendgruppen. Das will ich nebenbei noch mal sagen. Und das macht überhaupt keinen Unterschied. Die Arbeitsweise wird die gleiche bleiben, weil die Erkrankung ist, wie sie ist. Und das ist nur abstinenzorientiert zu bearbeiten. Ich selber kann mir keine Vorstellung machen, wie es wird. Also ich persönlich finde es gut, wenn es entkriminalisiert wird. Wir haben den Impact auf dem Markt jetzt schon in der Gesellschaft. Es ist da, es betrifft andere Personengruppen und ich merke immer, dass viel vermischt wird, was nicht vermischungsbar ist. Und in diesem Gesetz, in dem Eckpunktepapier ist es teilweise vermischt. Das macht es schwierig. Das heißt nicht, dass da nicht Ansätze dabei sind, die auch gut sind. Ich habe keine abschließende Meinung dazu. Ich versuche nur, möglichst viele Punkte zu sehen. Aber ich habe mir da auch noch keine abschließende Meinung dazu gemacht.
Stephan Wiegand: Weil wir gerade so an diesem gesellschaftlichen Diskussionspunkt angekommen sind. Ist auch ein ganz großer Themenkomplex der Fragen, die uns erreicht haben Wie gehen wir als Gesellschaft mit Drogenabhängigen um? Wie gehen wir mit Abhängigkeit um? Wie gehen wir mit Entzug um? Wie gehen wir mit Therapie um? Ist es eine Krankheit, die wir definiert haben? Warum definieren wir das als Krankheit, als ein Teil der Frage? Ein zweiter Teil der Frage. Da wird es ein bisschen konkreter Inwieweit hat Social Media einen Einfluss auf den Konsum von Drogen bei Jugendlichen? Wie sind die Erfahrungen bei den Referenten mit den Erstkontakten von Drogen im digitalen Bereich? Und das Gesellschaftliche nicht außer Acht lassen.
Maksymilian Markieton: Okay, kann ich noch mal die erste. Das waren zwei sehr lange Fragen. Kannst du noch mal die erste kurz wiederholen?
Stephan Wiegand: Also, es gibt so einen ganz großen Themenkomplex, der uns erreicht hat an Fragen Wie geht man damit um? Wie geht man in der Gesellschaft mit dem Phänomen um?
Maksymilian Markieton: Ja, und ganz kurz dazu ganz einfach: Wenn deine Oma dement wird oder jemand bei einem Autounfall eine Erkrankung bekommt, die nicht mehr reparabel ist, die chronisch ist, die möglicherweise Diabetes ist. Es ist eine Erkrankung und einen Menschen abzuwerten, bloß weil er eine andere Erkrankung hat, ist nicht fair. Also ich finde, das kann auch nur in der Arbeit mit erkrankten Menschen funktionieren, wenn die auf Augenhöhe passiert, Wenn man den Menschen nicht von oben herab anguckt und den auch nicht dafür bewundert, dass er es konsumiert, sondern geradeaus reinschaut und sagt Du, pass auf, was, was willst du? Du hast ja auch selber gesagt, Uwe, man muss ja rauskriegen, wo die Möhre hängt. Was, was die Lebensziele sein können die halt. Ihr lacht, wo die Möhre hängt. Also ich meinte jetzt die vor dem Eselkarren. Also wohin das Leben gehen soll, was ohne Drogen passieren kann. Und das ist das, wo man da ansetzen kann. Und insofern hat dieser Mensch auch verdient, dass man ihn respektvoll behandelt.
Stephan Wiegand: Ist das jetzt deine persönliche Meinung?
Maksymilian Markieton: Meine fachliche Meinung.
Stephan Wiegand: Oder ist das die Meinung derer, die sich mit Drogenabhängigen auseinandersetzen?
Maksymilian Markieton: Also anders geht es gar nicht. Ich weiß, euch geht es ja mit Sicherheit auch so, die Menschen, mit denen kannst du vielleicht nicht immer so kommunizieren wie mit jemandem, der vielleicht studiert hat oder so, bei Menschen, die sehr viel konsumiert haben, da sind auch Teile des Gehirns in der Kognitivität schon beschädigt, da wird es schwierig. Das heißt aber nicht, dass ich den dann abwatschen muss, bloß weil er mir halt kommt. Dann kann man trotzdem fragen Wie geht es dir? Was ist los? Wie lange ist der letzte Konsum her? Ich merke, du bist heute ein bisschen ruhiger. Woran liegt's? Also da kann man ja in die Richtung schon mal gehen. Das heißt ja nicht, dass ich da jetzt von oben herab runtermache. Das meine ich. Das kann jeder auch probieren.
Stephan Wiegand: Ich habe es befürchtet. Die Band zuckt. (...) Ich hatte es befürchtet, dass die Band uns dazwischengrätscht. Aber ich habe mir natürlich die Frage gemerkt, also auf den Zettel geschrieben und hoffe, dass ich mich nicht ganz verzettel, Aber nichtsdestotrotz. Inwieweit hat Social Media einen Einfluss auf den Konsum von Drogen bei Jugendlichen? Gibt es da Erfahrungen? Gibt es da eine Analyse?
Uwe Wicha: Ich fange mal an mit dem, was wir so einfach beobachten. Und sie haben vielleicht mehr und Systematischeres erforscht. Das wäre für mich sehr interessant. Wir haben Beobachtungen und unsere Beobachtungen fußen darauf, wir fragen unsere Klienten, die zu uns kommen Wo hast du dich informiert? Wie bist du an gewisse Drogen rangekommen? Wie hat sich im Freundeskreis das entwickelt, dass man zum Beispiel künstliche Cannabinoide im Shop kauft? Wie hat sich das so durchgesetzt bei euch in der Peergroup? Und da spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Das berichten Klienten. Es gibt TikToker, so heißt das, glaube ich. Und die TikToker, die konsumieren zum Teil vor der Kamera. Es gibt YouTuber, die Partys schmeißen als Live Events, wo sie sich die Birne weghauen und es wird live übertragen. Dann gibt es noch Twitch und ähnliche Dinge. Also da gibt es ein ganzes Universum von Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, deren Modell das ist, darüber Aufmerksamkeit zu erregen und vielleicht auch Geld zu verdienen. Das weiß ich nicht, ob sich das monetarisieren lässt. Und wenn Sie bei YouTube nur mal zum Spaß eingeben Cannabis, dann finden Sie auf den ersten Rangplätzen ganz, ganz weit Anleitungen, wie man eine Tüte rollt, wie man eine Bong ordentlich in Betrieb nimmt, wie man einen Apfel so umbaut, dass man durch den Apfel rauchen kann, Cannabis usw also es ist ein richtiges Handwerkerportal. An dieser Stelle und ganz, ganz spät finden Sie irgendjemanden, der sagt Ach, mit dem Cannabis. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist schwer zu finden in den sozialen Medien.
Ann-Kathrin Stock: Man muss jetzt sagen Die Rolle der sozialen Medien haben wir nicht systematisch untersucht bislang, obwohl es mit Sicherheit interessant wäre. Was man aber sagen kann, ist, dass die meisten eher über die Peergroup, also über ihre Freunde oder Bekannte, den ersten Kontakt haben. Also das heißt, sie schauen sich selten etwas im Internet an und probieren es dann ganz alleine aus. Oft ist es eher im Freundeskreis, dass Dinge ausprobiert werden. Dann werden neue Ideen im Internet oder auf sozialen Medien geholt. Und es gibt ja eben auch diese Algorithmen, die letztendlich dafür sorgen, dass man, wenn man erstmal bestimmte Themen interessant findet, immer mehr dieses Contents angeboten bekommt, egal ob das Sinn macht oder nicht. Egal ob das gute Inhalte sind, die werden immer weiter vermittelt. Und was tatsächlich auch so ein bisschen ein Problem ist, was du auch schon sagtest, sind tatsächlich auch die synthetischen Drogen, weil halt mittlerweile häufig eben einfach irgendeine legale Substanz erzeugt wird, in dem eigentlich illegale Substanzen chemisch leicht verändert werden, sodass sie nicht mehr gesetzlich unter die Regulierung fallen. Und die werden dann oft auf irgendeine Trägermasse aufgebracht, also zum Beispiel Oregano oder irgendein Grünzeugs, was häufig sehr unprofessionell in einem Betonmischer oder ähnlichem einfach durchgemischt wird. Dann wird dieses synthetische zum Beispiel Cannabinoid aufgebracht. Und wenn zum Beispiel so ein Mischer nicht vernünftig gereinigt wird, kann es auch einfach sein, dass es irgendwann zu Verunreinigungen kommt, dass viele verschiedene Substanzen auf einem Produkt hinterher zum Tragen kommen. Und da das ja auch nicht überwacht wird, ist es auch einfach immer schwerer einzuschätzen, wie dann diese synthetischen, vermeintlich legalen Substanzen tatsächlich auch wirken. Und das ist auch einfach ein Problem, was wir sehen, dass das, was übers Internet zu beziehen ist, was legal zu beziehen ist, mitunter einfach diese Risiken mitbringt, weil der Herstellungsprozess mitunter unsauber abläuft oder weil eben viele verschiedene Substanzen sich da auch vermischen können. Wenn das nicht sehr strikt eingehalten wird, wie das produziert wird und das ist nicht immer der Fall.
Zuhörerin: Ich möchte jetzt mal eine ganz andere Frage stellen, die mich gerade umtreibt, und zwar bei den Jugendlichen. Also man hat seine Kinder, die sind 16. Die hängen in ihrem Freundeskreis. Dann wird der erste Joint geraucht oder irgendwas. So und dann gibt es die einen, die sagen Ah, Mama, ich beichte dir das mal, ich habe jetzt einen geraucht, aber du, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das überhaupt nicht cool, dass ich meine Kontrolle verliere. Das hat sich alles so langsam angefühlt. Aber ich habe es jetzt mal gemacht. Die machen aber nicht weiter. Und dann gibt es die anderen, die wollen immer mehr davon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer nur die Familie ist, immer nur das soziale Umfeld ist. Oder wird da irgendwas anderes kompensiert? Ist da was in einem, was einen schon so triggert, dass man dazu veranlagt ist, das zu machen? Oder ist es Tatsache, so, dass einem irgendwie ganz viel fehlt an anderen Komponenten, um das zu kompensieren? Um zu sagen hier habe ich einen Fluchtort, hier gehe ich irgendwo hin.
Uwe Wicha: Ich glaube, Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Es ist dieser eben merkliche Unterschied, den die Klienten merken. Es gibt Menschen, die haben Von Natur aus sind die reich gesegnet mit Juhu, hier gibt es Dopamin für free, Da bin ich sowieso schon gut drauf. Da muss nicht viel passieren. Und dann gibt es leider Menschen, da ist es nicht so freigiebig. Und wenn die jetzt anfangen, etwas sich in den Kopf zu schütten, was auf einmal eine neue Welt, eine neue Dimension eröffnet. An Freude. Dann ist das für die ein ganz anderes Erlebnis. Dann sagen die nicht na ja, war ein bisschen langweilig. Wenn ich von der Rutsche im Freibad rutsche, ist das genauso toll wie ein Joint. Sondern dann sagen die Oh, eine neue Welt tut sich auf. Und für die ist das dann schwierig zu sagen. Da gehe ich nicht hin, weil das eine andere Qualität gibt.
Maximilian Pilhatsch: Ein wichtiger Mechanismus in dem Zusammenhang finde ich auch so Impulsivität. Wonach richtet man sein Verhalten aus? Ist das eher so, dass die kurzfristige Belohnung, Ist es die Sensation im Moment oder ist es eher, dass man vernünftig ist, eher so an die Zukunft denkt mittelfristig. Derjenige, der eher zukunftsorientiert ist und weniger impulsiv, der würde dann vermutlich nicht unbedingt weiter rauchen am Joint. Und derjenige, der jetzt nicht an daran denkt, was in zwei Jahren ist, der würde dann vielleicht eher dazu neigen, beim Cannabis hängen zu bleiben.
Ann-Kathrin Stock: Und wie gesagt, was auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist das, was wir in der Forschung als Alternative Reward bezeichnen. Also habe ich Alternativen. Wenn ich in meinem Leben weniger Quellen für Spaß und Freude habe, wenn es wenige Dinge gibt, die mir gut tun, wenige Menschen gibt, die mir gut tun. Dann ist natürlich, wenn ich diese eine Sache finde, wo es mir mal ein paar Stunden richtig klasse geht, viel verlockender, als wenn ich diese eine Sache finde, die eine von vielen Optionen ist, mit denen ich letztendlich mich gut fühlen kann. Und dazu kommt einfach auch - man kann natürlich nicht alles auf die Familie schieben. Zum Beispiel auch der Wunsch, in einer Peergroup dazuzugehören, ist gerade auch im jugendlichen Alter einfach riesengroß. Und je nachdem, wie da auch die Dynamik ist, spielt auch das eine Rolle. Aber generell kann man einfach auch nicht sagen, dass es den einen Grund gibt. Es sind oft viele Faktoren, die da zusammenkommen, in welcher Gewichtung auch immer. Das unterscheidet sich dann auch von Mensch zu Mensch sehr stark.
Maksymilian Markieton: Und hier kann ich mich ja auch noch mal wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Angebot, solche Alternative Rewards zu lernen, das kann wirklich von früh auf erlernt werden. Also nicht nur das Kuscheln, wenn es ein Kleinkind ist, sondern auch wirklich später. Erlebnisorientiert erziehen.Der Staat hat ja auch Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt ja auch offene Kinder- und Jugendarbeit, die gerade auch dort arbeiten, wo halt auch Peergroups das Bedürfnis dort quasi faktisch befriedigt werden kann. Und da finde ich einen sehr wichtigen Teil in der Jugendarbeit. Sozialraumorientierte, offene Kinder- und Jugendarbeit. Einfach mal zu gucken, was gibt es denn bei mir? Da gibt es auch Sozialarbeiter, also Kollegen von mir, die machen das sehr gut mit, die machen das geschlechterorientiert. Da gibt es Angebote für Jungs, Angebote für Mädels. Da kann man sagen wenn du nicht mit mir drüber reden kannst, dann geh mal da hin, mit denen kannst du drüber reden, vielleicht auch mit anderen Kids in einem anderen Raum, der vielleicht nicht so familiär geschlossen ist. Einfach mal schauen, was gibt es. Und auch hier, wenn man selber Bedenken hat, nicht zögern Drogenberatung immer. Also das ist ein Angebot des Gesundheitsamts, da kann man jederzeit darauf zugreifen.
Uwe Wicha: Vielleicht kann man es noch mal ergänzen um das, was wir vorhin gesagt haben. Da ging es um die Frage Wie können denn Angehörige, wenn sie denn merken, dass ihr Kind da eine Problematik möglicherweise entwickelt oder entwickelt hat, wie wird das sein, dass sie in Therapie kommen? Wir erleben bei den Angehörigen, dass sie dann oft Angst haben. Dann kommt der Therapeut in so einem Angehörigengespräch und sagt Guck mal, das hast du alles falsch gemacht. Das ist nicht unser Blickwinkel. Wir gehen davon aus, dass wir alle als Eltern oder als Angehörige irgendwas mal im Leben falsch machen. Also es ist ja nicht so, dass wir perfekt sind. Niemand. Und es geht auch nie darum, Schuldige zu finden und uns Schuld zuzuweisen, sondern zu sagen So ist es nun. Wie kriegen wir es wieder hin? So. Also da braucht niemand Angst haben, dass wir hier mit der Lupe nach Schuldigen suchen. Das würde nicht sehr helfen.
Marie-Luise Rohm: Zusammenfassend würde ich gern noch mal die Frage an alle richten. Wir haben jetzt sehr viel über Social Media und Angehörige und generell die Gesellschaft gesprochen. Sollten wir alle mehr über das Thema Drogen sprechen oder welche konkreten Punkte würden Sie sich in der Diskussion mehr wünschen?
Uwe Wicha: Also meine Wünsche sind eigentlich, dass wir die guten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Umgang mit Nikotin und Zigaretten, dass wir das auf andere Suchtmittel übertragen. Das hat sehr gut funktioniert. Also man hat in der Gesellschaft ein Klima geschaffen. Ob man das wirklich so konstruieren kann, weiß ich nicht. Aber wo Rauchen nicht mehr so cool ist, wie es mal war, als ich Jugendlicher war, als ich Jugendlicher war, da gehörte das dazu. Für mich war noch James Dean eine Figur, die besonders cool war. Die meisten Menschen wissen nicht mehr, wer der war, aber der war ohne Zigarette nicht denkbar. Das hat sich vollkommen verändert. Und wir haben es geschafft, dass wir über eine unglaubliche Preiserhöhung dann auch dieses Nikotin und diese Zigaretten sehr unattraktiv gemacht haben. Dann haben wir es geschafft, dass in den Peergroups es immer weniger Raucher auf einmal gab. Auch gerade bei Jugendlichen hat das funktioniert. Im Erzgebirge, in der Nähe zur tschechischen Grenze, funktioniert das nicht, weil der Preis unterboten wird, auf der anderen Seite der Grenze. Aber ansonsten hat man so ein Umfeld geschaffen, wo Leute gesagt haben Ich bin doch nicht verrückt, ich fang doch nicht an zu rauchen, weil dafür kann ich mir das leisten, dafür kann ich mir das leisten. Das ist es mir nicht wert. Und es wurden sehr deutlich in die Gesellschaft getragen. Wir sind hier viele Nichtraucher. Du musst immer rausgehen deswegen. Das ist auch doof. Usw. Also ich habe lange Jahre geraucht und ich habe das mit großer Freude gemacht. Ich habe es nicht vertragen. Ich hätte viel früher aufhören sollen. Aber auch bei mir ist die Vernunft sehr spät eingezogen. Aber so was hilft und wenn wir über solche Dinge nachdenken würden, auch mit Alkohol. Wir haben jetzt viel über illegale Drogen gesprochen. Das größte Problem in dieser Gesellschaft ist Alkohol. Mehr Menschen sterben an den Folgen von Alkohol. Mehr Menschen sind in Krankenhäusern an den Folgen von Alkohol. Mehr Familien zerrütten an den Folgen von Alkohol. Also, da kommen die illegalen Drogen nicht mit. Und warum nicht? Weil die illegalen Drogen nicht frei verfügbar sind, aber Alkohol schon. Das ist der Unterschied. Die Illegalität schützt wenigstens noch den Großteil der Menschen. Alkohol, der legal und überall erwerbbar ist, führt dazu, dass wir das wie ein Massenphänomen haben.
Maksymilian Markieton: Das Thema Abhängigkeitserkrankungen ist wirklich sehr umfassend. Wir haben jetzt heute wirklich. Du hast schon gesagt, nur den kleinen Teil der illegalen Drogen besprochen. 1800 Tote. Ich glaube, dem gegenüber stehen Hunderttausende bis Millionen. Die Folgen des Alkohols tragen in Deutschland und nicht davon gesprochen, dass jetzt auch Arbeitsausfälle zu großem wirtschaftlichen Schaden führen, was auf Alkohol zurückzuführen ist. Da sind auch gigantische Summen noch mit dran. Was mir wichtig ist, ist auch nicht zu vergessen, dass es wirklich auch die sogenannten nicht stofflich gebundenen Süchte gibt. Ich habe jetzt gerade hätte es vorhin rausholen können wollen, aber wir waren so schön im Gespräch, gerade den aktuellen Suchtbericht für Sachsen da und was, was über die ganzen Jahre jetzt sichtbar ist, ist ein langsamer, stetiger Anstieg von problematischem Medienkonsum. Also es sind immer nur ein paar 100. Das, was in Beratungsstellen tatsächlich ankommt, das steigt stetig an, da hat auch Corona keinen Effekt drauf gehabt. Bei Nikotin haben wir einen Effekt, dass Jugendliche jetzt nach der Zeit wieder verstärkt rauchen. Das zumindest wissen die Leute nicht warum, aber die führen es auf Corona zurück. Weil es der einzige Impact ist, den man da so machen kann. Die nicht stofflich gebundenen Süchte sind nicht ungefährlicher. Auch hier haben wir die gleiche Mechanik im Gehirn, was Dopaminausstoß und das Verlangen nach der Tätigkeit angeht. Kaufsucht, Spielsucht, Binge-Watching, Social Media. Auch ein Auge darauf zu haben, dass ruhig kritisch zu sehen, das offen zu besprechen, auch mit den Betroffenen. Na ja, selbstkritisch sein und das würde ich mir auch wünschen.
Ann-Kathrin Stock: Ja, also was ich auch sehr wichtig fände, wäre zwar unabhängig davon, ob man sagt, wir kriminalisieren oder entkriminalisieren den Konsum, bessere Drugchecking Möglichkeiten anzubieten, dass die Menschen, die trotz allem konsumieren, eben auch eine bessere Kontrolle darüber haben, zu wissen, was sie denn überhaupt tatsächlich konsumieren, um auch erwarten zu können, was für Effekte da vielleicht eintreten können, oder auch sich in Zukunft besser schützen zu können, wenn sie etwas nicht vertragen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach realistische Erwartungen zu schaffen, weil was diese Abschreckungskampagnen oft einfach als Nebeneffekt mit sich bringen, ist, dass Menschen, wenn sie nicht sozusagen das Extrem der Auswirkungen spüren, oft denken Och, das läuft ja bei mir. Zum Beispiel diese Faces of Meth Kampagne, die es mal in den USA gab, wo Leute innerhalb von Jahren wahnsinnig abgebaut haben und im Gesicht eben auch sehr, sehr verschlechtert ausgesehen haben und dann fotografiert wurden. Das hat viel damit zu tun, dass man in den USA oft obdachlos wird, wenn man drogenabhängig ist, meistens die Zähne ausfallen. Das macht das Gesicht nicht schöner, meistens auch die Gesundheitsversorgung verliert. Das heißt, man kann Zähne und offene Wunden nicht mehr behandeln. Und dann, in vielen Fällen kochen die Leute in den USA zum Beispiel auch noch selber ihr Crystal Meth. Und dann, wenn das Labor mal hochgeht, macht das auch nicht schöner. Und die Menschen, die dann hier unter Umständen noch Krankenversorgung, noch Wohnungen, noch ein bisschen Struktur haben, schauen sich selber im Spiegel an und denken sich Ist doch okay bei mir. Und das sind zum Beispiel auch Probleme, die wir über diese Abschreckung eher schaffen, als dass wir sie beseitigen, wenn wir unrealistische Erwartungen schaffen und dann die Menschen das mit ihrer Realität abgleichen und denken Das ist ja gar nicht so schlimm, was ich mache und dann vielleicht andere Effekte vernachlässigen, die eigentlich doch problematisch sein können.
Marie-Luise Rohm: (...) Ich gebe Ihnen das letzte Wort noch, Herr Pilhatsch.
Maximilian Pilhatsch: Danke. Also ich fand das sehr gut, was Herr Wicha eben noch mal gesagt hat. Diese Transformation, die wir hinbekommen haben in Bezug auf die Tabakproblematik in der Gesellschaft. Die ist wirklich toll. Also wenn man sich vorstellt, vor ein paar Jahren konnte man noch im Flugzeug rauchen, wie unvorstellbar so was heutzutage ist. Das ist vielleicht in der Tat ein Modell dafür, wie man auch mit dem Alkohol das Alkoholproblem in den Griff bekommen könnte. Ja, auch. Stichwort Werbung. Auch wie die Gesellschaft schon auch wirklich durch den Alkohol auch ein Stück weit manipuliert ist. Wenn man nichts trinkt, wird man direkt gefragt Ja, was ist denn mit dir los? Das ist fast unvorstellbar. Dann wir hatten gesagt, 2000 Drogentote gab es in Deutschland. Im selben Zeitraum gab es in den USA 100.000 Drogentote, weil die dort einfach diese Opioidkrise haben und dieses Opioidthema. Ich hoffe, dass das nicht unser Thema hier auch wird, weil das ist noch mal eine ganz andere Wucht, glaube ich, die dann sozusagen das Thema Drogen bekommen kann. Also da müssen wir uns wirklich gut aufstellen, dass so was hier nicht passiert. Ansonsten eben auch gerade hier in Sachsen speziell das Thema Methamphetamin. Crystal Meth ist immer noch nicht suffizient behandelt. Also hier würde ich mir auch wünschen, dass noch viel an Unterstützung Forschungsgeldern da vielleicht auch rein fließt. Das wären meine drei Punkte.
Marie-Luise Rohm: Vielen Dank für Ihre vielen Denkanstöße. Ich hoffe, das Publikum hatte auch einige Erleuchtungen oder Erweckungsmomente. Vielen Dank, dass Sie alle da waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Stephan Wiegand: Ja, vielen Dank. Danke schön.
Give us your feedback - simply, quickly and anonymously.
Here are a few impressions of our event.

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig
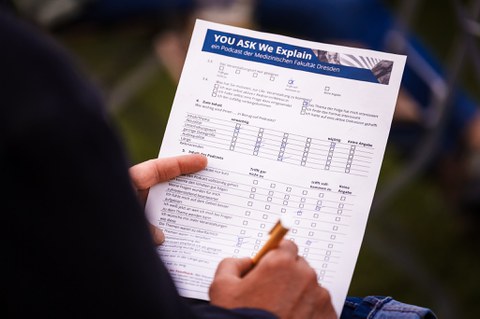
© André Wirsig
When: 24.05.2023, 20:00 - 21:30
Where: El Horst beer garden (Bergmannstraße 39, 01309 Dresden)
Our Advisors:
-
Dr. Ann-Kathrin Stock - Research Associate at the Clinic for Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University Hospital Dresden
Prof. Dr. med. habil. Maximilian Pilhatsch - Chief Physician at the Clinic for Psychiatry and Psychotherapy Elblandklinik Radebeul and Head of the Outpatient Addiction Clinic at Dresden University Hospital
- Uwe Wicha - Managing Director of the specialist clinic "Alte Flugschule"
-
Maksymilian Markieton - Radebeuler Sozialprojekte gGmbH
Moderator: Marie-Luise Rohm - Medical student
This project is funded by the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF) and the Free State of Saxony as part of the Excellence Strategy of the
Federal and State governments.






























