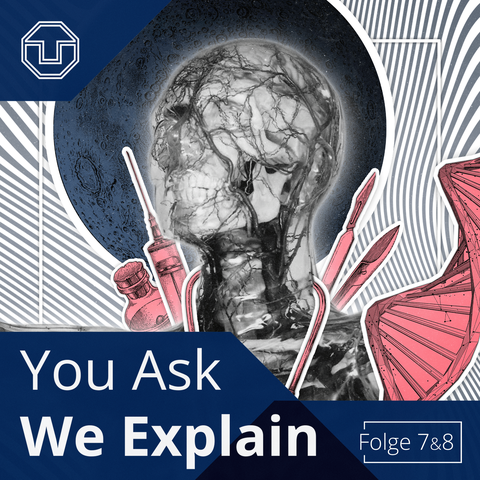Jun 30, 2023
Episode 08: All this is science - Laureates of the DRESDEN EXCELLENCE AWARD presented
Our podcast series you ask we explain - Berührungsängste in der Medizin started in January and is published monthly. In the 8th episode, we discussed the topic: All this is science - presenting the winners of the DRESDEN EXCELLENCE AWARD .
We wanted to discuss with you and answer your questions. Didn't have time to be there? No problem: just listen to our podcast on the go - on Spotify, Apple Music, Deezer or here.
Stephan Wiegand: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem COSMO Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden. (...) Jo Aldinger und Patrick Neumann, zuständig bei unserer Podcastreihe You Ask We Explain für den guten Ton. Eine Band, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Also haben wir uns irgendwas überlegt, wie wir sie bei der Stange halten können, haben wir gesagt, sie können machen, was sie wollen und das haben sie sich ausgesucht, dass sie alle zehn Minuten anfangen zu spielen. Gut, das ist nicht jedermanns Sache, aber wir müssen damit leben, weil ansonsten laufen sie uns weg und sind dann irgendwo in einer Late Night Show wieder dabei. Wir haben uns heute getroffen hier zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts You Ask We explain. Also wir sind nicht unbedingt diejenigen, die nur einen Frontalunterricht machen, sondern wir finden es auch ganz gut, wenn man mit uns in Kontakt tritt, mit uns interagiert. Das kann man per Mail machen, das kann man während eines Podcasts machen und das kann man einfach mit einer Wortmeldung machen und dann kommen Sie mit dazu. Wir haben uns irgendwann überlegt, dass es ganz gut ist, Musik zu hören, dass es aber noch viel wichtiger ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann war die Idee geboren, einen Podcast auf den Weg zu bringen. Da kam meine Tochter ins Spiel. Die wird jetzt bald 18 und hat ‚Von wegen Lisbeth‘ immer mir vorgesungen. Doch bitte, bitte keinen Podcast, weil zu viele Podcasts gibt, haben wir uns überlegt Wir gehen dorthin, wo die Menschen eigentlich sitzen und wo wir mit ihnen die Interaktion suchen können. Deshalb freue ich mich, dass wir in der Langen Nacht der Wissenschaften junge Wissenschaftler präsentieren können und ein bisschen einen Einblick bekommen in ihr Leben und so nachvollziehen wollen. Warum sind sie in Dresden? Warum bleiben sie in Dresden? Warum suchen sie vielleicht doch was Neues? Und was brauchen sie, um hier zu bleiben? Das ist das Thema unseres Podcasts und ich denke, weil die Musik so schön ist und noch keine zehn Minuten um sind, können wir noch mal was hören? Applaus ist immer gern genommen. Mein Name ist Stephan Wiegand. Und weil es vielleicht unterhaltsamer ist, wenn man zu zweit moderiert, habe ich Nora-Lynn Schwerdtner mitgebracht.
Nora-Lynn Schwerdtner: Ja, herzlich willkommen hier im Kulturpalast. Wir hatten gerade schon in der vergangenen Folge das Thema Wissenschaft und Gesellschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Und was passt da besser zu guter Musik, eigentlich einem guten Getränk, ein gutes Gespräch über die Wissenschaft in Dresden. Ich würde direkt anfangen mit den Science Award Gewinnern. Ich habe viel gelesen im Internet, was die Themen waren, bin schon meistens bei der Überschrift gescheitert. Ich kann Herrn Carsten Albert vorstellen in dem Text irgendwas mit Quantenphysik raus gelesen, würde jetzt aber gerne das Wort abgeben. Ich denke, Sie können es am besten erklären, welche Teilchen Sie untersucht haben im Universum.
Carsten Albert: Genau, also sehr gerne. Erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin übrigens bisher kein Podcasthörer gewesen, also zumindest kein großer. Aber ich glaube, vielleicht ändert sich das heute. Ich bin da ganz guter Dinge. Ich habe mich in meiner Abschlussarbeit. Das war die Abschlussarbeit fürs Lehramt in Physik mit einer Ausstellung beschäftigt, die sich rund um das Thema Wissenschaftskommunikation in Physik, insbesondere in Quantenphysik, dreht. Also vielleicht kurz zur Einordnung Ich habe meinen Abschluss 2021 gemacht und habe im IFW, wo wir Professor Büchner gerade auch gehört haben, als Student, damals noch in der Wissenschaftskommunikation mitgearbeitet. Und es gab da einen ganz spannenden Vorschlag zusammen mit den Technischen Sammlungen Dresden, dass dort eine Ausstellung entstehen soll zum Thema Quantenphysik. Also das ist quasi ein weiteres Projekt in der Wissenschaftskommunikation vom IFW gewesen und da wurde ich gefragt Hey, du machst doch Lehramt, Du beschäftigst dich doch damit, wie man Physik irgendwie unter die Menschen bringt, wie man zeigt, dass Physik auch Spaß machen kann und nicht nur trockene Theorie sein muss. Und genau so ist es dann entstanden und ich habe mich in meiner Abschlussarbeit damit beschäftigt. Für dieses Projekt, was quasi noch im Entstehen ist, die Kommunikationsstrategie für diese Ausstellung zu entwickeln. Also wie kann man Quantenphysik in so einer Ausstellung vermitteln, wo jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer eine Führung dabei ist, sondern die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich richtige Mitmachexponate haben. Hands on-Exponate, wo man spielerisch irgendwas über Quantenphysik erfahren kann. Und ich habe geschaut, wie kann man das kommunizieren, Wie kann man die Inhalte da so transportieren, dass tatsächlich bei den Besucherinnen und Besuchern spielerisch und mit viel Spaß irgendwas hängenbleiben kann?
Stephan Wiegand: Alle unsere Gäste sind Gewinner bzw. Preisträger des Dresden Excellence Awards. Juana Mai ebenfalls für eine Bachelorarbeit. Da sieht man auch so ein bisschen, dass man nicht habilitieren muss, dass man nicht promovieren muss, dass man keine Masterarbeit schreiben muss, sondern dass das auch mit einer Bachelorarbeit geht. Kannst du dich noch daran erinnern, an deine Bachelorarbeit, was du den Leuten vorgestellt hast und was da im Prinzip den Auslöser dafür gab, auch einen Preis dafür zu bekommen?
Juana Mai: Ja, natürlich kann ich mich noch an meine Bachelorarbeit erinnern.
Stephan Wiegand: Du hast auch eine Masterarbeit mittlerweile geschrieben.
Juana Mai: Habe ich mittlerweile auch geschrieben.
Stephan Wiegand: Zwei Seiten weiter.
Juana Mai: Genau, die hat keine Auszeichnung bekommen, die habe ich auch nicht in Deutschland geschrieben. Ich habe Holztechnik studiert, Das wissen die meisten irgendwie gar nicht, dass man das überhaupt studieren kann. Und das war ein duales Studium an der Berufsakademie hier in Dresden. Und es gab dann zum Beginn des letzten Semesters den Aufruf von unserem Direktor und Studiengangsvorsitzenden, Herr Hensel. Der ist ja auch in der Sondertour mit unterwegs. Der hat aufgerufen: Hier die Fachhochschule Bern sucht wieder einen Studenten von der Berufsakademie. Da besteht schon länger eine Zusammenarbeit, die die Forschungsarbeit vorantreibt, wieder also aufbauend auf einer anderen Arbeit, die im Jahrgang vor mir schon jemand angefangen hat. Und für mich war das dann so der Punkt, wo ich dachte, jetzt kann ich endlich mal mit Vollholz arbeiten, weil in der Firma, in dem Praxispartner, mit dem ich bis dahin zusammengearbeitet habe, der hat eher so mit Spanplatten und MDF zu tun gehabt.
Stephan Wiegand: Und das ist was anderes.
Juana Mai: Vollholz heißt Vollholz, wie vom Baum gefällt, geschnitten und dann, ohne das zu schreddern und wieder zusammenzukleben, direkt bearbeitet.
Stephan Wiegand: Das ist aber nicht so billig.
Juana Mai: Nee, nicht so billig.
Stephan Wiegand: Genau deshalb macht man das nicht so oft richtig.
Juana Mai: Und in der Arbeit ging es am Ende um die Verklebungsgüte von Brettschichtholz, quasi Vollholzlamellen.
Stephan Wiegand: Also doch wieder auseinandergeschreddert.
Juana Mai: Genau um das Holz aber stabiler zu machen. So ganz große Hallenträger sind aus Brettschichtholz hergestellt. Meistens. Und die müssen ein bisschen was tragen, wenn die da so über zehn 15 Meter ein Dach zum Beispiel tragen müssen.
Stephan Wiegand: Okay.
Juana Mai: Aktuell werden die hauptsächlich aus Nadelholz hergestellt und in der Arbeit ging es aber darum, das Ganze mit Laubholz zu machen, weil das halt stabiler ist und in Europa auch gut wächst. Thema Mischwald und Laubholz lässt sich aber nicht so gut verkleben wie Nadelholz. Das hat halt andere Eigenschaften, hat feinere Poren. Und dann ging es darum Wie müssen wir das Holz bearbeiten, damit das Gut klebt?
Stephan Wiegand: Größere Poren quasi
Juana Mai: Genau. Und vor allen Dingen Wie prüfen wir das? Wir Prüfen wir die Verklebungsgüter möglichst zerstörungsfrei, damit wir da nicht so viel opfern müssen von dem Holz. Und die aktuelle Hauptprüfung dafür ist die Delaminierungsprüfung. Die ist sehr.
Stephan Wiegand: Jetzt habe ich das verstanden. Das ist nicht nur so eine feine Fichtenholz, sondern das sind so kleine Bretter, die einen halben Zentimeter…
Juana Mai: Genau die. Also in meinem Fall waren das dann sechs Bretter, die zu einem dicken Brett zusammengeklebt werden. Und zwischen diesen Brettern dieser Klebstoff muss ja halten, damit dieses Dach am Ende auch hält und uns nicht auf den Kopf fällt.
Stephan Wiegand: Okay, verstanden.
Juana Mai: Genau. Und die Hauptprüfung dafür ist aktuell die Delaminierungsprüfung und die ist sehr umständlich. Da wird dann das Holz in Stückchen geschnitten, also wieder kleiner gemacht, quasi in Prüfkörper, dann in den Autoklaven geschoben, geflutet und mit Vakuum wird das Wasser quasi unter Druck und unter Vakuum da reingepresst. So extrem Schwellen des Holzes quasi dargestellt und danach wird das radikal runtergetrocknet bei wenig Luftfeuchte und hohen Temperaturen, um dieses Extremschwinden nachzuahmen. Was dieser Holzträger über sein ganzes Leben auch irgendwie durchmachen muss. Durch verschiedene Klimata, die da in so einer Halle auch vorherrschend sind.
Stephan Wiegand: Können wir vielleicht später noch mal kurz drauf eingehen.
Juana Mai: Und da ging es dann aber auch darum, dann mit einer NIR-Spektroskopie das vielleicht loszuwerden, das Thema.
Nora-Lynn Schwerdtner: Ich sehe, Frau Mai hat den Preis komplett zurecht bekommen. Ich hätte es gekauft. Ich fand es super. Ich hoffe es gibt ein YouTube Tutorial davon. Wir gehen zwei akademische Stufen weiter. Drei Entschuldigung, Herrn Dr. habil. Thomas Kämpfe. Ich komme persönlich aus der Sozial- und Kommunikationswissenschaft und verstehe auch wieder nichts von kleinen Teilchen Elektrik, Speicher, Nano. Vielleicht können Sie drei Worte zu Ihrer Forschungsarbeit verlieren. Was hat Sie da angetrieben? War das eine intrinsisch motivierte Arbeit? Erzählen Sie gern.
Thomas Kämpfe: Habilitation ist sozusagen ja, schon, vielleicht schwer zu verstehen. Kennt kaum jemand. Da geht es darum, dass man eigentlich Lehrtätigkeit nachweisen kann und nicht wissenschaftliche Arbeit. Das ist vielleicht mal was Neues. Da geht es eigentlich darum, dass man an der Hochschule Vorlesungen halten darf und damit berechtigt wird, das zu machen in einem größeren Umfang. Das heißt, eigentlich soll man dokumentieren, dass man Doktoranden anlernen kann und mit denen wissenschaftlich arbeiten kann. Und das zusammenzuführen. Das heißt eigentlich, meine Arbeit war eine kumulative Arbeit, wo sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten so zusammengefügt wurden, die sich alle um das Thema elektronische Bauelemente drehten mit einem bestimmten Material das Hafniumoxid, das in der Mikroelektronik extrem verwendet wird. Das Thema kommt aus meiner Promotionsarbeit vielleicht zum Teil, die ich schon vorher an der TU Dresden gemacht habe. Da ging es auch um so einen Effekt. Der nennt sich Ferroelektrizität, da werden elektrische Dipole eingestellt. Und das hat eine breite Palette von Anwendungsfeldern. Und in einem viel praktischeren Material konnte ich das dann am Fraunhofer Institut weiterführen. Also wo man es wirklich in Mikroelektronik einbringen kann. Da gibt es ganz viele Randbedingungen , Kontaminationen, die man berücksichtigen muss in so einem Reinraum. Und dieses Material war da viel geeigneter. Und wir haben jetzt versucht, dieses Material in der Breite der Palette von Anwendungsfeldern zu untersuchen, ob das sinnvoll ist. Eine Anwendung ist, dass man das für Speicher anwendet. Gibt es auch verschiedenste Konzepte, die wir untersucht haben. Dann gibt es Möglichkeiten, diese Speicher zu verwenden für KI Hardware, also Hardware, die jetzt besonders energieeffizient ist. Also jeder kennt Themen wie jetzt GPT und andere KI, die immer populärer wird. Und da ist das Thema, wie kann man da eigentlich das ausführen und diese Algorithmen ausführen, ohne dass das Unsummen an Energiebedarf, also es gibt so eine…
Stephan Wiegand: Ja, sie tun was sie wollen und komponieren jeden Einzelnen. In diesen kleinen Clips, die da gespielt werden, werden extra für jeden Podcast neu komponiert und neu arrangiert. Und das ist jedes Mal eine kleine Premiere, wenn so ein Kunstwerk dann die Boxen verlässt. Wir waren bei der Energie stehengeblieben. Energie, die weniger eingesetzt werden sollte. Wenn Bauteile, also Widerstand, Spule, Kondensator in einem irgendwie verarbeitet werden, dass man versucht also möglichst niederschwellige Energien einsetzen zu müssen, dass diese Bauteile irgendwie funktionieren in einem Schaltkreis.
Thomas Kämpfe: Sind vielleicht nicht die Bauteile, die wirklich vorkommen in so einem Chip, aber im Prinzip genau.
Stephan Wiegand: Was kommt dann vor. Dioden, Transistoren?
Thomas Kämpfe: Ja, genau. Weniger Spulen, die gibt es da nicht mehr. Die sind dann zu groß. Die macht man in der Mikroelektronik dann weniger. Wir haben ja häufig die Diskussion zu energetischer Transformation und alles, was mit Mobilität zu tun hat. Aber auch im Bereich Computing, Nutzen von Smartphones, Cloud verbrauchen wir enorm viel Energie und die steigt exponentiell. Und es gibt Projektionen, dass wir bis 2040 fast die komplette Energie nur für Berechnen brauchen und nicht nur für die anderen Themen, die wir hier auch diskutieren. Energetische Transformation für Heizen oder Mobilität. Deswegen ist es ein extrem relevantes Thema, dass man sich beschäftigt, wie man Energie einsparen kann.
Stephan Wiegand: Haben Sie ja kaum Zeit zum Urlaub machen. Felix Lansing, der vierte Gast in der Runde. Auch Dresden Excellence Award Preisträger, mittlerweile Firmeninhaber, recht erfolgreich mit einer Geschichte aus der Medizinbiologie. Alles eine Frage der Gene. Kann man viel draus machen? Kann man viel reinbringen? Vielleicht können Sie kurz erklären, was es mit so einer Genschere auf sich hat, was man daraus machen kann. Weil ich glaube, das ist so der Grund, weshalb Sie die Auszeichnung bekommen haben.
Felix Lansing: Ja, genau. Mein Thema der Dissertation, die ich an der medizinischen Systembiologie gemacht habe, ging halt, um neue Werkzeuge in der Molekularbiologie zu finden, mit der man genetische Defekte bearbeiten kann. Viele kennen natürlich die CRISPR/CAS Genschere mittlerweile. Die hat ja durch den Nobelpreis aber auch schon vorher in der Gesellschaft sozusagen Anschluss gefunden. Was viele nicht wissen ist, dass diese CRISPR/CAS Genschere tatsächlich nur eine Schere ist. Das heißt sie kann gehen, schneiden, aber nicht reparieren und dafür ist dann die Zelle zuständig. Was aber oft Fehler mit einher bringt. Und an der medizinischen Systembiologie an dem Lehrstuhl gibt es eine ganz andere Klasse von Enzymen, sogenannte Rekombinasen. Und die können schneiden und reparieren. Und was ich während meiner Dissertation gemacht habe, was vorher noch nicht möglich war, ist, dass man diese Rekombinasen neu programmiert, um bestimmte Gendefekte zu erkennen und dann zu korrigieren.
Stephan Wiegand: Kann man da ein Beispiel draus machen, was man da gerade versucht hat rauszuholen. Also kann ich es mir wirklich so vorstellen, man geht hin mit so einer Enzymschere, die nehme ich nicht in die Hand. Aber so eine Enzymschere, die nimmt ein Stück von der DNA raus und sucht irgendwo wieder zwei Teile Aminosäuren zusammen und sagt Gott, packen wir wieder was rein, funktioniert.
Felix Lansing: Genau. Also ein Beispiel ist die Bluterkrankheit. Hier gibt es eine Art von Mutation, die wirklich einfach nur die Orientierung der DNA ändert. Das heißt, das Leseraster ist falsch rum und die Information ist verloren, um einen bestimmten Faktor herzustellen, dass man Blutgerinnung betreiben kann. Und wir haben eine Genschere entwickelt, die quasi dieses Segment erkennt, ausschneidet, dreht und wieder einbaut und damit zum Beispiel den Gendefekt in der Bluterkrankheit beheben kann und dann auch sozusagen wieder den Faktor, der benötigt wird, für die Blutgerinnung herzustellen. Und man bringt die ein. Jetzt die Frage Wie kriegt man das in die Zelle? Man muss es ja in den Körper bekommen. Und da haben wir uns zum Beispiel der Meteorologie von den Corona Vakzinen sozusagen genommen. Das heißt, wir haben LNPs, die Nanopartikel und mRNA genommen, um die Genschere quasi im Körper an die richtige Zelle zu bringen, dass sie dann da die Korrektur hervorheben kann.
Stephan Wiegand: Kann ich mir das so vorstellen. Ich habe einen Gendefekt, quasi eine Bluterkrankheit. Dann gehe ich zu Ihnen und sage Mensch, Herr Lansing, also das funktioniert jetzt nicht so gut. Dann können Sie sich überlegen, dass man tatsächlich bei mir im Organismus genau diesen Gendefekt irgendwie identifiziert, ausschneidet, umdreht und dann ist alles wieder plante.
Felix Lansing: Ja. So kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich individuell, jede Krankheit hat verschiedene Gründe. Es ist nicht immer, dass das Fragment verkehrt herum ist. Man muss manchmal eine richtige Kopie einbringen, ein Segment austauschen. Manchmal gibt es ein Gen, was defekt ist, was man ausschneiden will und die Genschere, die wir entwickelt haben, die Rekombinasen, die können alle diese Reaktionen anwenden. Das heißt, man kann wirklich eigentlich jede Krankheit damit adressieren. Man muss halt nur wissen, wo der Defekt liegt und wie er sozusagen in der Genetik sich darstellt.
Stephan Wiegand: Und das machen Sie jetzt erst mal in vitro oder schon an größeren Zellhaufen oder in einem Modell.
Felix Lansing: Wir hatten Glück bei der Hämophilie, dass mit der medizinischen Fakultät der Kontakt zu einem Patienten da stand. Der hat dann wirklich Zellen gespendet. Die konnten wir dann sozusagen in der Zellkultur kultivieren und korrigieren. Und darauf basierend aus diesen Erfolgen haben wir jetzt auch angefangen, ein Mausmodell zu generieren, was die Krankheit auch rekapituliert. Und die nächsten Schritte sind es dann in der Maus zu testen. Und mit den Ergebnissen kann man sich dann für eine klinische Studie sozusagen anmelden und das dann im Menschen dann anwenden.
Stephan Wiegand: Und so ähnlich funktioniert es auch bei HIV. Also es ist auch so ein Ansatz, dass man guckt, wo der Gendefekt dann liegt und so eine Genschere ansetzen kann.
Felix Lansing: Ja, der HIV Virus kapert sozusagen das menschliche Genom, baut sich selber ein und eine Heilung von HIV ist eigentlich nur möglich, wenn man sozusagen das HIV Genom wieder aus der Zelle entfernt. Momentane Medikamente unterdrücken, dass der Virus dann sich wieder ausbreitet im Körper. Aber mit der Genschere könnte man auch den HIV Virus aus dem Genom der Zelle wieder ausschneiden und damit wirklich die Zelle heilen und HIV sozusagen heilen. Das ist eine andere Anwendung, die auch aus dem Labor kommt.
Stephan Wiegand: Aber hätte ich auch einen Preis dafür gegeben. Gab es da Geld dafür? Für den Preis?
Felix Lansing: Das ist vor meiner Zeit passiert. Genau das war 2016. Aber meine Arbeit hat dazu beigetragen, dass man die Genschere für jegliche Art von Defekten benutzen kann. Das war ein konkretes Beispiel, was auch sehr viel Interesse geweckt hat an dem Bereich und meine Arbeit dann darauffolgend war halt kann man diese Enzyme in der ganzen Breite anwenden? Und das ist jetzt möglich und das setzen wir auch sozusagen in der Firma um, die jetzt Anfang des Jahres ans Laufen gegangen ist.
Nora-Lynn Schwerdtner: Vielen lieben Dank dafür. Uns hat natürlich extrem interessiert, auf jeden Fall, wieso Sie sich für diesen Preis beworben haben, warum Sie den bekommen haben, was Ihre innere Motivation dafür war. Sind Sie beim zwölften Geburtstag aufgewacht und dachten sich Jetzt mach ich was mit Quantenphysik. Ich kriege auf jeden Fall einen Preis und Geld. Das ist genau mein Ding? Oder wo hängt Ihre Urkunde jetzt? Irgendwo im Flur. Auf Toilette? Oder ist die Oma da total stolz drauf? Und das hängt bei ihr im Wohnzimmer.
Stephan Wiegand: Neben so einem brüllenden Hirsch?
Nora-Lynn Schwerdtner: Vielleicht. So irgendwas Schönes über dem Kamin? Liebe Frau Mai, was war Ihre Begeisterung/ Motivation? Was hat Sie vielleicht noch beflügelt, jetzt den Master zu machen? Ist vielleicht auch eine Habil drin? Oder doch erst mal der Doktortitel? Logischerweise der Doktortitel zuerst.
Juana Mai: Ich muss sagen, bevor ich die Arbeit nicht überhaupt fertig hatte, wusste ich gar nicht, dass es diesen Award überhaupt gibt. Meine beiden Professoren, die die Arbeit mit mir begleitet haben, haben mich dann mal darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt Du hast da so eine geile Arbeit geschrieben, Bewirb dich doch einfach mal!
Nora-Lynn Schwerdtner: Pack das Holz unter den Arm und geh los.
Juana Mai: Genau. Genau. Gönn dir. Und ich habe auch, bis ich den Anruf bekommen habe, dass ich den Award tatsächlich auch gewonnen habe, für mich war das Thema eigentlich auch so Entweder ich kriege oder ich kriege nicht. Also es hat jetzt eigentlich gar keinen großen Einfluss bis dahin gehabt. Ich habe natürlich, als es dann so weit war, stolzester Moment meines Lebens bisher.
Nora-Lynn Schwerdtner: Kriegt ja nicht jeder Bachelorabsolvent, muss man ja auch.
Juana Mai: Richtig. Und die 3.000 € nimmt man natürlich auch gern mit 21 Jahren. Also es ist schon vier Jahre her mittlerweile. Und das Geld ist nicht mehr da.
Stephan Wiegand: Also haben Sie da Holz davon gekauft?
Juana Mai: Nein, damit habe ich mein Studentenleben im Masterstudium finanziert. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich da auf diese eine Masterstelle, das war dann in Design und Produktmanagement an der Fachhochschule Salzburg zu bewerben. Ich habe mich beworben. Die haben dann auch gesagt Ja, geht los. Und dann war das so die zweite nach der Entscheidung, die Bachelorarbeit in der Schweiz zu schreiben über dieses Thema war das so die zweite ‚Scheiß drauf, Ich mache das jetzt‘- Entscheidung in meinem Leben dann auch noch den Master zu machen.
Nora-Lynn Schwerdtner: Lieber Herr Albert, der Preis ist zu Ihnen gekommen. Oder sind Sie zum Preis gekommen?
Carsten Albert: Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, Es war ein bisschen ein Umweg. Ich habe mich vorher schon mal beworben. Ich hatte parallel zu meinem Lehramtsstudium Physik auch im Hauptfach studiert und hatte mich mit meiner Bachelorarbeit damals schon beworben, weil diese Kärtchen, wo ich ja auch vorhin eins gefunden habe. Diese Werbekärtchen damals bei uns im Institut auslagen. Ich habe das gesehen und dachte ja, kannst dich ja mal bewerben. Und das hat damals für eine Nominierung gereicht. Das ist quasi so eine Art dritter Platz. Hat leider mit meiner Bachelorarbeit damals nicht funktioniert und dann hatte ich auch meine Staatsexamensarbeit fertig. Und dann dachte ich ja, also es war ja schon mal knapp, vielleicht probiert man es einfach noch mal.
Nora-Lynn Schwerdtner: Staatsexamen war auch gut.
Carsten Albert: Anscheinend war ganz okay. Genau. Und dann dachte ich Ja, probierst du es einfach noch mal. Und auch da habe ich mich zweimal beworben. Man darf sich immer zwei Jahre in Folge bewerben. Das erste Mal kam nichts raus und beim zweiten Mal. Und deshalb war ich auch sehr von dem Anruf überrascht, weil ich es eigentlich schon abgeschrieben hatte, hat es dann tatsächlich funktioniert. Also manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Glückssache.
Nora-Lynn Schwerdtner: Trotzdem sehr, sehr stolz. Auch beim zweiten, dritten Anlauf, bei der Bewerbung, oder?
Carsten Albert: Ja, auf jeden Fall. Also einfach, weil es einem auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt für das Thema, was einem am Herzen liegt. Und also beispielsweise hatte ich jetzt eine Anfrage. Ich bin ja quasi studierter Lehrer, promoviere jetzt zwar noch, aber mir liegt ja trotzdem irgendwie Bildung und Schule sehr am Herzen und durch den Preis hatte ich jetzt teilweise auch Aufmerksamkeit, zum Beispiel von einer Referentin vom Kultusministerium. Und da darf ich jetzt bei einer Werbekampagne auch mitmachen, um Lehrer beispielsweise anzuwerben. Und das finde ich sehr schön, dass das einfach dazu führt, dass man auch sein Thema ein bisschen nach außen weiter transportieren kann.
Nora-Lynn Schwerdtner: Man sieht ja, Postkartenwerbung hat damals schon viel gebracht. Bei Ihnen ist es hängen geblieben. Deswegen immer noch marketingaffin. Ich würde weitergeben. Natürlich. Zum vierten Preisträger hat Ihnen ein Netzwerk gebracht. Hat es Ihnen ein Publikum gebracht? Hat es Ihnen rückenstärkende Menschen verschafft?
Thomas Kämpfe: Das war eine sehr schöne Anerkennung. Also, um die Frage nochmal zu beantworten, ob ich jemand das vorgeschlagen hat. Ich habe es irgendwie durch Zufall mal gesehen. Und ein Bekannter hatte genau diesen Preis das letzte Jahr bekommen und da bin ich darauf gekommen und habe gedacht na gut, ich habe das jetzt auch gerade abgeschlossen. Könnte man mal probieren und habe die Bewerbung dann quasi am letzten Tag kurz vor 00:00 eingereicht. Schnell, noch nachdem der Flug in Dresden gelandet war.
Stephan Wiegand: Machen Naturwissenschaftler nicht immer so, oder?
Thomas Kämpfe: ... Und ja, ich war dann überrascht und froh, dass ich ausgewählt wurde. Direkt für diesen Preis. Ich habe jetzt eine zusätzliche Aufgabe bekommen, noch eine Vorlesung zu halten. Zusätzlich.
Stephan Wiegand: Glückwunsch. Da wird es nicht langweilig. Das ist doch gut. Einen Preis gekriegt hat auch Natalie Lehnart. Die kann leider heute nicht da sein. Da ging es darum, dass man sich im stressigen Alltag ein bisschen zur Seite nehmen kann mit einer VR Brille und etwas mehr Entspannung finden kann. Wer das ausprobieren möchte hier drüben sind zwei Liegestühle VR Brillen und da gibt es Entspannungsprogramm. Ein zweiter Teil von unserem Podcast ist ja nicht nur zu gucken, Was sind denn das für Preise, die man da ausgelobt hat und was hat man mit dem Geld gemacht? Ist man da Unternehmer geworden oder hat sich eine schöne Woche gemacht, sondern dass man ein bisschen nachguckt. Was braucht man als Wissenschaftler, als Start up Unternehmen, als Jemand, der ins Berufsleben startet? Was braucht man in der Region, um sich wohl zu fühlen, um auch das machen zu können, was einem so am Herzen liegt? Juana Mai. Was ist es denn, was Sie aus Salzburg wieder zurück nach Dresden gebracht hat? Und haben Sie hier diesen beruflichen Weg so ganz einfach beschreiten können? Standen da 20 Leute dort haben gesagt Mensch, Frau Mai, das ist aber schön, dass Sie bei uns vorbeikommen. Also hier ist der Sessel, hier ist der Tisch. Toben Sie sich aus. Leben Sie sich aus. Bringen Sie sich ein. Wir haben auf Sie gewartet. Ist das so die Realität oder sieht die anders aus?
Juana Mai: Die Realität sieht leider anders aus.
Stephan Wiegand: Schade.
Juana Mai: Ja, also, ich bin gebürtige Sächsin. Ich stehe da auch voll dazu. Also ich komme aus einem kleinen Dorf hier eine halbe Stunde weg von Dresden, habe dadurch auch Familie, Freunde, alles hier, was natürlich die Entscheidung leichter macht, hier zu bleiben auch. Es war schön, mal rauszukommen. Für den Master. Für die Bachelorarbeit. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Das lernt man, wenn man weg ist. Der erste Job war tatsächlich gar nicht so schwer zu bekommen. Ich habe mich da bei den deutschen Werkstätten beworben, die haben mich genommen. Da hat auf jeden Fall die Chemie nicht so richtig gestimmt, wie das halt manchmal so ist. Ist ja im Liebesleben auch nicht immer einfach. Und so ist es eigentlich auch in der Jobsuche. Und dann findet man aber nicht unbedingt direkt Anschluss in der nächsten Firma. Also ich habe dann lange gesucht, viele Bewerbungen geschrieben, viele haben auch einfach gar nicht auf die Bewerbung reagiert. Ich glaube, das ist aktuell so ein allgemeines Problem auf dem Bewerbungsmarkt Fachkräftemangel. Aber es reagiert auch keiner.
Stephan Wiegand: Ist das eine Erfahrung, die ihr alle gemacht habt? So ein bisschen, dass es Fachkräftemangel ja gibt. Aber dass die guten Jobs nicht unbedingt hierzulande auf der Straße liegen. Herr Lansing, Sie nicken. Also da gehe ich davon aus, dass Sie was sagen können.
Felix Lansing: Ja, Im Endeffekt habe ich ja durch die Gründung meinen Job selbst geschaffen, weil davor gab es den nicht. Das Unternehmen gab es nicht. Es gab die Finanzierung nicht. Es gab keine Unterstützung in dem Sinne, dass finanziell bei der Ausgründung irgendwie vielleicht vom Mutterinstitut noch dabei geholfen wird. Das heißt, im Endeffekt war ich mit der Gunst von meinem Doktorvater habe ich meinen Postdoc gemacht, natürlich noch weiter wissenschaftlich gearbeitet, konnte aber halt danach nach der Arbeit, die die Zeit nutzen, halt die Idee mit Kollegen aufzustellen. Wie kann man aus der Idee ein Unternehmen machen? Und dann haben wir ein Jahr lang wirklich Fundraising betrieben. Also das war ein Jahr unsicher, ob das klappt oder nicht. Im Endeffekt haben wir jetzt 12,5 Millionen € eingetrieben und können jetzt 18 Arbeitsplätze momentan in Dresden schaffen damit. Aber das war Arbeit, die einfach nur intrinsisch motiviert war.
Stephan Wiegand: Die Frage ist ja die, ob sie lieber sich hätten anstellen lassen, wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt Mensch, ich habe auf Sie gewartet. Oder ob das so ein Traum von Ihnen war, dass man sagt Klar, ich nehme mein Glück selbst in die Hand. Und das Risiko trage ich auch ganz gern. Ich bin halt so ein Typ. Oder ob hierzulande das halt so nicht möglich war. Und dass sie dann deshalb irgendwie eher ein bisschen härter zufassen mussten oder mehr Innovation reinlegen mussten.
Felix Lansing: Also in dem Bereich...
Stephan Wiegand: Ich habe nach einem Wort gesucht risikofreudiger sein mussten.
Felix Lansing: Also in dem Bereich, wo ich arbeite und hätte Arbeit finden können, da wäre es in Deutschland sehr schwierig geworden. Dann wäre USA gewesen, da hatte ich schon einen Auslandsaufenthalt gehabt. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Und dadurch war es für mich eigentlich klar Entweder ich nehme das selber in die Hand oder ich mache einen anderen Job, der vielleicht nicht mehr mit meiner Leidenschaft zur Genetik und auch zu dem Thema zu tun hat. Das wäre die Alternative gewesen. Also Angebote oder Bewerbungen hätte ich schreiben können. Aber in einem anderen Bereich und da war einfach klar Das will ich nicht machen. Ich probiere es jetzt auch meine private Situation hat mir das erlaubt. Ich hatte keine Verpflichtungen in dem Sinne und wurde auch von meiner Partnerin unterstützt, das zu machen und deswegen war es okay. Ich kann es jetzt probieren. Wenn es klappt, schön, Wenn nicht, dann suche ich mir einen Job.
Nora-Lynn Schwerdtner: Herr Lansing, Sie haben vorhin schon gesagt, die USA ist nicht so richtig Ihr Setting. Haben Sie sich damals ganz bewusst für eine Exzellenz-Uni, die TU Dresden, beworben? Was macht die TU Dresden für Sie so attraktiv, hier zu forschen? Wie war die Forschungslandschaft? Hat es Spaß gemacht? Was hätten Sie sich mehr gewünscht? Oder wo war es schon sehr gut. Erzählen Sie gerne, was Sie da für Erfahrungen als junger Wissenschaftler gesammelt haben.
Felix Lansing: Also ich wollte schon immer Biologie studieren. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine ganze Familie Biologie sozusagen, Botaniker, Molekularbiologe, Schwester auch, mein Bruder auch Molekularbiologe. Es war irgendwie auf jeden Fall in der Familie drin. Ich habe dann aber nach dem Bachelor gemerkt, ich würde ganz gerne die medizinische Ausrichtung haben und da wird es dann tatsächlich. Für den Masterstudiengang kann man natürlich Allgemeinbiologie weitermachen, aber es gibt dann sehr wenig Studiengänge, die Medizinfokus haben. Einmal an der Charite in Berlin, Biomedizin, da hatte ich auch die Möglichkeit hinzugehen. Und dann hatte ich aber in Dresden den Studiengang gefunden, Regenerative Biologie und Medizin. Und das hat die beiden Fächer eigentlich sehr gut verbunden, dass man halt trotzdem Biologie Schwerpunkt hatte, aber mit medizinischer Ausrichtung. Und das war der Grund, warum ich nach Dresden gekommen bin. Vorher war ich noch nie hier gewesen, habe dann gemerkt, dass es auch eine sehr schöne Stadt ist, auch finanziell ganz angenehm im Vergleich zu Berlin. Mit Wohnungssuche und so was. Und dass im Nachhinein, das hier ein top Ort ist, um Wissenschaft zu machen, das habe ich erst danach rausgefunden. Also von außen habe ich das so direkt nicht wahrgenommen, als ich mich hier beworben habe und dann auch hierhin gegangen bin.
Stephan Wiegand: Herr Lansing hat gemeint, dass er 12 Millionen € irgendwie per Fundraising zusammengeklaubt hat. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Regionen, also mit Kollegen, die in anderen Fraunhofer Instituten unterwegs sind, ist es in Dresden leichter, an Geld zu kommen oder ist es bei denen leichter?
Thomas Kämpfe: Generell sind solche Themen Deep Tech, wie man das ja dann so sagt, ein bisschen schwieriger in Deutschland als in den USA im Vergleich. Man versucht das immer weiter zu unterstützen, dass das auch wirklich funktioniert, dass man deutsche Startups gründen kann. Und da gibt es auch viele nationale Förderfonds usw., die das im ersten Moment auch fördern. Also das ist schon etwas, was immer mehr in den Blickpunkt kommt, weil bezüglich Projektförderung, ich glaube in meinem Institut. Wir sind halt auf Mikroelektronik fokussiert, aber arbeiten auf 200 und 300 Millimeter, also wirklich voll auf industriellem Level. Das gibt es sonst in Deutschland so kaum oder gar nicht. Das unterscheidet uns extrem von anderen Instituten. Also wir haben einen extremen Fokus und deswegen ist es dann klar, wenn es um diese Themen geht, dann muss man nach Dresden kommen. Wir sind eben in Dresden das Mikroelektronik-Zentrum.
Stephan Wiegand: Vielleicht noch bevor ich das Wort wieder (...) Es war ein bisschen wie so eine Reise mit so einer 3D Brille zur Entspannung. Danke, dass ihr das so schön gemacht habt. So ein Innovationsunternehmen kann 12 Millionen € so zusammen. Ist das tatsächlich unabhängig vom Standort wäre das egal für Sie gewesen, wo dieses Unternehmen gegründet wird? Oder ist das in Dresden ein fruchtbarer Boden, wo die Idee gefallen ist?
Felix Lansing: Man muss ja auch sagen, diese 12 Millionen haben eine Laufzeit von 18 Monaten, 24 Monate, wenn es hochkommt. Und danach brauchen wir neues Geld. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine sehr kurze Zeit, um wirklich den Investoren auch klarzumachen Die Idee kann klappen. Das heißt, wir müssen sozusagen sofort loslegen. Und das ging nur in Dresden, weil hier natürlich das Talent war, was die Technologie mitentwickelt hat. Ich weiß nicht alleine. Wir konnten wirklich sehr viele Mitarbeitende von dem von dem Lehrstuhl in die Firma holen und wir hätten das, glaube ich, nirgendwo anders so schnell umsetzen können. Da hätte man wieder Laborfläche suchen müssen, die Leute einstellen. Das sind ja auch Spezialfachkräfte, die es eigentlich nur in Dresden gab. Das heißt, so schnell das umzusetzen, ist nur hier gegangen. Sicherlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte man das auch woanders machen können. Aber dann wäre die Frage, wer hätte das umgesetzt? Und die Leute gab es auch nur in Dresden. +
Stephan Wiegand: Und das sagt einem Bio Unternehmen: Also einen Moment mal, ihr kriegt von uns 5 Millionen € für eine Laufzeit von anderthalb Jahren. Wenn ihr es schafft, diese Genschere so einzusetzen, dass die in einem Modell irgendwie funktioniert. Das sind so die Absprachen dazu.
Felix Lansing: Genau. Es gibt ganz knallharte Meilensteine, nennt sich das. Die werden vorher festgelegt und die bestimmen, wann das Geld kommt. Das kommt auch nicht alles mit einem Schlag, sondern ist tranchiert. Das heißt, man hat schon einen sehr, sehr starken Druck und auch eine Bringschuld gegenüber den Investoren, weil sonst wird auch ganz schnell entschieden, wenn das nicht fruchtet. Die verschwenden keine Zeit.
Stephan Wiegand: Ist ja eine Riesenstimmung bei Ihnen in der Abteilung, oder?
Felix Lansing: Die Stimmung ist sehr gut, weil es klappt. Es klappt eigentlich alles so, wie wir es vorgestellt haben.
Stephan Wiegand: Und Sie können auch immer schlafen.
Felix Lansing: Ich kann ganz gut schlafen, weil ich ja auch lange arbeite. Das ist geht dem einher so ein bisschen
Stephan Wiegand: Ja, das ist eine ganz schöne Challenge, die man da trotzdem reiten muss, wenn man immer über so Ausgründungen spricht. Also auch die TU ist sehr interessiert daran, dass es Ausgründungen gibt. Da stellt sich für mich immer so die Frage Na, da geht ja quasi das gesamte Tafelsilber über den Tisch. Gibt es da einen Rückfluss? Ist das so, dass man da auch Konzepte erstellt, wie zum Beispiel Innovationen wie Ressourcen auch wieder zurückfließen an so eine Bildungseinrichtung? Oder ist das so? Na ja, gut, dann entlassen wir die auf dem Markt. Also ähnlich wie eine Stadt auch ihre Filetstücke verkaufen kann. Also dass man sagt, das ist dann halt so ein so ein kapitalistischer Prozess.
Felix Lansing: Gar nicht, weil tatsächlich die Erfindung ist ja an der TU Dresden entstanden, das heißt, die Patente, die Schutzrechte, die gehören der TU Dresden. Und da wirklich ein ganz großes Lob ans Transferoffice der TU Dresden, mit denen wir in Verhandlungen getreten sind. Zu welchen Konditionen können wir eine exklusive Lizenz oder vielleicht das Patent in die Firma kriegen? Und da sind natürlich Rückflüsse gegeben, das heißt die TU Dresden, ich glaube auch mit der Arbeit in allen anderen Bereichen. Es gibt ja viele Ausgründungen, Beispiele, die machen sehr faire Konditionen, aber die achten auch darauf, dass sozusagen ein Rückfluss gegeben ist. Wenn man erfolgreich ist. Mit der Technologie, an der TU Dresden entwickelt wurde, dann ist auch gewährleistet, dass sie zurückgeht. Und das ist aber nicht auf einer Basis von man muss jetzt hier feilschen, sondern auch der Support vom Transfer Offices klar gegeben Wir wollen, dass ihr das macht. Und wenn euch die Konditionen oder die Investoren die Konditionen nicht passen, dann kann man auch noch mal drüber reden. Aber es ist ganz klar, dass Geld auch wieder zurückfließt.
Thomas Kämpfe: Bei Fraunhofer ist es genau das Gleiche. Also es ist natürlich gewünscht, dass es da weitergeht und dass man nicht nur das Geld verforscht, dass man am Ende was anbietet. Und es gibt auch viele Ausgründungen, die werden dann vielleicht weiterverkauft und dann fließt eben viel Geld, wenn es dann weiterverkauft wird, auch wieder an das Institut zurück, wenn die Anteile übernommen werden. Da kommt eben was wieder zurück und das kann auch dann die Arbeit, die folgende Arbeit, in der man etwas wirklich Neues wieder anfangen kann, beflügeln. Also es ist natürlich so, zum Beispiel bei Fraunhofer gab es das MP3 Patent was oder die Rechte an der Entwicklung, die extrem geholfen haben, zum Beispiel eine Stiftung aufzubauen, die ganz viele neue Projekte unterstützt hat. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, neue Ideen auch dann in den Instituten, in der Forschungsgruppen zu unterstützen und nicht immer nur das Alte weiter zu machen. Es ist ja auch ein Rausgeben, was eben dann zu mehr führt. Ein Startup ist viel dynamischer vielleicht als Institut hat eben nicht diese Randbedingungen, wie so Forschungsprojekte einwerben. Und dann dauert es ganz lange, bis es bewertet ist. Vielleicht wird es abgelehnt, vielleicht wird es aber doch angenommen. Dann dauert es, bis es startet. Man hat vielleicht eingeschränkte Ziele. Ein Start up ist da viel dynamischer, viel flexibler. Und dann kommt vielleicht auch viel mehr dabei raus. Also das ist eigentlich das.
Stephan Wiegand: Also sind Sie auch so dieser Start up Typ? Wie sollte der Wissenschaftsstandort aussehen, um Ihre Arbeit genauso fortzuführen bzw. noch ein bisschen zu intensivieren oder ein bisschen was auf den Weg zu bringen? Herr Albert, fangen wir bei Ihnen an?
Carsten Albert: Also was ich schon mal gut finde ist, dass wir in Dresden ja tatsächlich sehr zentral alles haben. Also tatsächlich örtliche Nähe, finde ich, hilft manchmal sehr. Also ich kann zum Beispiel aus dem Institut rauslaufen und bin in zehn Minuten an der Uni, wo ich irgendwas erledigen muss. Das finde ich sehr gut. Was prinzipiell hilft und das ist natürlich immer ausbaufähig. Aber da sind wir in Dresden auch schon nicht schlecht sind Netzwerke einfach zu schmieden und zwar nicht nur in der Wissenschaft selber, sondern eben auch mit anderen Akteuren. Also beispielsweise bei mir wäre das jetzt mit Ämtern, die zum Beispiel zuständig sind für den Schulbereich, dazu zählen vielleicht auch irgendwie so was wie Museen etc., wo wir quasi auch schon dabei sind, die in diesem Dresden Concept Verbund zu haben. Ich glaube, da kann man natürlich immer weiter machen, weil einfach Netzwerke und kurze Wege und Kontakte einfach in ganz vielen Bereichen extrem helfen, Dinge zu beschleunigen oder zu ermöglichen.
Juana Mai: Erst mal für mich aus der Sicht des dualen Studiums, das vielleicht auch von den anderen oder generell dieses Studium vollwertig anerkannt wird, weil es wird dann immer gesagt ja, ihr habt ja bloß anderthalb Jahre studiert und das erschwert uns natürlich auch den Weg, da voranzuschreiten. Es gab einen Grund, warum ich den Master in Österreich gemacht habe und nicht hier in Dresden. Und wenn sich das zukünftig ändern würde? Also die BA ist zum Beispiel.
Stephan Wiegand: Weil Salzburg eine schöne Stadt, ist.
Juana Mai: Das sowieso. Anders schön als Dresden, aber auch schön. Die duale Hochschule zu werden, das könnte vielleicht schon ein wichtiger Schritt sein, dass unser Studium auch wirklich als vollwertiger Bachelor anerkannt wird. Vielleicht wird auch da wieder der Diplom und Master direkt auch dual wieder eingeführt. Und dadurch kann es vielleicht doch ein bisschen leichter werden, weil Dresden ist ein guter Standort auch für Holz. Wir haben hier gut eine gute Basis, mit der man arbeiten kann und jetzt auch mein Preis sollte auch den Fokus ein bisschen. Hey, Dresden Holz, das geht, das funktioniert, da ist was los und das muss jetzt noch ein bisschen aktiver und präsenter werden. Und ich glaube, dann wird das auch für die Forschung hier in Dresden noch ein bisschen attraktiver. Vor allen Dingen, wenn man aus einem dualen Studium kommt.
Stephan Wiegand: Herr Kämpfe?
Thomas Kämpfe: Netzwerke sind super in Dresden generell. Also es gibt, glaube ich, 70.000 Beschäftigte in diesem Forschungsbereich, in dem ich aktiv bin, Mikroelektronik und alles, was so da mit dranhängt. Es gibt das Silicon Saxony, was das alles versucht zu unterstützen, verschiedenste Arbeitskreise, die da drin sind. Gerade war jetzt der Silicon Saxony Day die Staatsregierung, also nicht nur die Stadt, sondern auch das Land unterstützt Mikroelektronik extrem. Versucht ganz viel zu unterstützen. Wenn jetzt der Wissenschaftsminister, wo ich mit dabei war bei einer Delegationsreise nach Taiwan, dabei ist versucht eben auch da MikroelektronikIndustrie aus Taiwan nach Dresden zu holen.
Stephan Wiegand: Und das ist erfolgreich.
Thomas Kämpfe: Hoffentlich.
Stephan Wiegand: Jo Aldinger, Patrick Neumann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Publikum. Vielen Dank an die Diskussionsrunde. Fand ich spannend, auch die Einblicke zu bekommen, aber das habe ich ja schon mal betont gehabt. Vielen Dank an die Musik. Wer Lust hat, dem Alltag noch mal für eine Sekunde zu entfliehen, kann die 3D Brille die 3D Brille so probieren nicht? Ich bin da eher Generation Robotron. Aber gut, wir sind. You ask we explain. Der Podcast kann man überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Schicken Abend noch.
Give us your feedback - simply, quickly and anonymously.
Here are a few impressions of our event.

Musikalische Unterstützung durch Jo Aldinger (links) und Patrick Neumann (rechts) © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Referent Carsten Albert © André Wirsig

Referent:innen Carsten Albert und Juana Mai © André Wirsig

Referentin Juana Mai © André Wirsig

Referentin Juana Mai © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Referent Thomas Kämpfe © André Wirsig

Referent Thomas Kämpfe © André Wirsig

Musikalische Unterstützung durch Patrick Neumann © André Wirsig

Moderator Stephan Wiegand © André Wirsig

Referent Felix Lansing © André Wirsig

Referent Felix Lansing © André Wirsig

Moderator Stephan Wiegand und Referent Felix Lansing © André Wirsig

Moderator Stephan Wiegand © André Wirsig

Referent Felix Lansing © André Wirsig

Moderator Stephan Wiegand und Referent Felix Lansing © André Wirsig

Moderatorin Nora-Lynn Schwerdtner © André Wirsig

Musikalische Unterstützung durch Jo Aldinger © André Wirsig

© André Wirsig

Referent Carsten Albert © André Wirsig

Moderatorin Nora-Lynn Schwerdtner © André Wirsig

© André Wirsig
When: 30.06.2023, 18:00 - 19:00
Where: Kulturpalast Dresden, 2nd floor
Our Advisors:
-
Juana Mai, Dresden State Academy of Studies of the Berufsakademie Sachsen
-
Carsten Albert, TUD Dresden University of Technology
- Dr. Felix Lansing, TUD Dresden University of Technology
- Dr. habil. Thomas Kämpfe, TUD Dresden University of Technology
Moderators: Stephan Wiegand and Nora-Lynn Schwerdtner - Public Relations of the Carl Gustav Carus Faculty of Medicine
Musical accompaniment:
- Jo Aldinger jochenaldinger.de
- and Patrick Neumann www.patrickneumann.net
This project is funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Free State of Saxony as part of the Excellence Strategy of the Federal and State governments.