Dresdner Stahlbaufachtagung 2025
Die 17. Dresdner Stahlbaufachtagung fand unter der Überschrift „Stahl- und Verbundbau – Neues aus Forschung, Normung und Praxis“ am 19. März statt. Im Heinz-Schönfeld-Hörsaal wurden den Teilnehmenden durch fachkundige Referenten Einblicke in vielfältige Themen des Stahlbaus gegeben.

Blick ins Auditorium des Heinz-Schönfeld-Hörsaals der TU Dresden
Die Inhalte der Fachvorträge in der ersten Tageshälfte thematisierten Neuerungen in den für den Stahlbau relevanten technischen Regelwerken, insbesondere der Europäischen Normung. Es wurden die Low Emission Steel Standards, Stabilitätsnachweise für Stabtragwerke, die brandschutztechnische Bemessung und Stahlsortenwahl zur Vermeidung von Sprödbrüchen sowie Abnahmekriterien im Stahlbau behandelt. In der zweiten Tageshälfte folgten Fachvorträge zur Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und die Begutachtung historischer Stahlgusslager am Beispiel des Chemnitzer Viaduktes. Die Vortragsreihe wurde durch Projektberichte zum Fly Over am Nürnberger Ostkreuz sowie dem Hauptbahnhof Stuttgart 21 abgerundet.
Organisiert wurde die Tagung durch das Institut für Stahl- und Holzbau der Technischen Universität Dresden in Zusammenarbeit mit der Bauakademie Sachsen. Die Veranstaltung wurde unterstützt vom bauforumstahl, der FOSTA, der Ingenieur- und der Architektenkammer Sachsen, dem Verband Beratender Ingenieure (VBI), dem Verlag Ernst & Sohn und der Baukammer Berlin. Herr Dr. Gregor Nüsse von der FOSTA - Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V. - moderierte sachkundig die Fachtagung.

Dr. Gregor Nüsse (links) und Dr.-Ing. Yannik Sparrer (rechts)
Die Veranstaltung wurde von Herrn Prof. Dr. Richard Stroetmann von der Technischen Universität Dresden mit einer Begrüßung aller Teilnehmenden und Dankesworten an die Referenten eröffnet. Anschließend sprach Herr Dr. Yannik Sparrer von der Wirtschaftsvereinigung Stahl über die Einführung von Leit- oder Pioniermärkten für emissionsarmen Stahl und deren Förderung durch die Low Emission Steel Standards (LEES). Die Umsetzung kann durch die Verwendung geeigneter Produktkennzeichnungen erfolgen, mit denen eine Vergleichbarkeit und Transparenz der ökologischen Eigenschaften geschaffen wird. Darüber hinaus müssen ökologische Anforderungen an Produkte verbindlich festgelegt und durch die öffentliche Hand im Vergabeprozess von Bauleistungen gefördert werden.

Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann (links) und Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann (rechts)
Der anschließende Eröffnungsfachvortrag wurde von Herrn Prof. Stroetmann gehalten. Er thematisierte die Stabilitätsnachweise nach der neuen DIN EN 1993-1-1 und dem CEN/TR 1993-1-103. Zu Beginn erläuterte er den Zeitplan zur Einführung der zweiten Generation der Eurocodes und die paketweise Einführung in Deutschland. Anschließend ging er auf die Grundlagen der Tragwerksberechnung, die Modellannahmen zur Berücksichtigung von Anschlussverformungen sowie die abgestuften Berechnungsverfahren und Imperfektionsannahmen ein. Es werden neue Knicklinien für das Drill- und Biegedrillknicken eingeführt und Stähle bis S700 berücksichtigt. Einfachsymmetrische Querschnitte werden nach Anhang C nachgewiesen, die teilplastische Ausnutzung von Klasse-3-Querschnitten ermöglicht eine wirtschaftlichere Auslegung der Bauteile. Der CEN/TR 1993-1-103 beinhaltet Biegeknick-, Drillknick- und Biegedrillknicklasten von Stäben und gibt Hinweise zur Annahme von Lagerungsbedingungen.
Den zweiten Fachvortrag hielt Herr Prof. Dr. Peter Schaumann (ehem. Leibnitz-Universität Hannover) von der SKI Ingenieurgesellschaft über die brandschutztechnische Bemessung von Stahl- und Verbundtragwerken. Im neuen Eurocode 3 Teil 1-2 wurden neben der Ergänzung von höherfesten Stählen und deren Verhalten im Brandfall auch Bemessungsvorschriften für feuerverzinkten Bauteile erarbeitet, die sich unbekleidet langsamer erwärmen als organisch beschichteter Stahl. Bei Verbundkonstruktionen (Eurocode 4, Teil 1-2) wurde die Wärmeleitfähigkeit von Beton angepasst, indem zwischen 140 und 160°C ein Wechsel von der oberen zur untere Grenze berücksichtig wird. Die Membrantragwirkung von Verbunddecken im Brandfall kann durch geeignete Berechnungsmodelle (Anhang G) berücksichtigt werden. Verbundstützen aus betongefüllten Stahlhohlprofilen mit kreis-, ellipsen- und rechteckförmigem Querschnitt werden im Anhang F der Norm neu geregelt. Ferner erfolgten auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse Anpassungen der Muster-Garagen- und Stellplatzverordnung.

Prof. Dr.-Ing. Bertram Kühn (links) und Prof. Dr.-Ing. Max Spannaus (rechts)
Mit seinem Vortrag zur Stahlsortenwahl zur Vermeidung von Sprödbruch eröffnete Herr Prof. Dr. Bertram Kühn von der Technischen Hochschule Mittelhessen den zweiten Vortragsblock. Die Überarbeitung des Teil 1-10 erfolgte unter Berücksichtigung der Neuerungen in den übrigen Teilen des Eurocode 3, technische Inhalte in Verbindung mit der Werkstoffwahl, wie die Stahlgüten in kaltumgeformten Bereichen und deren Schweißbarkeit, wurden im Zug der Harmonisierung neu zugeordnet und überarbeitet. Höherfeste Stähle bis S700 und Referenztemperaturen bis -120°C wurden bei der Bestimmung der zulässigen Blechdicken im Regelungsumfang aufgenommen. Wesentlich für die Stahlgütewahl ist auch die Differenzierung zwischen vorwiegend ruhend und ermüdungsbeanspruchten Konstruktionen, für die aufgrund der Rissannahmen sehr unterschiedliche Werkstoffanforderungen bestehen. Zusätzlich wurden Hochlagenkriterien eingeführt, mit denen die Zähigkeitsanforderungen durch die Konstruktion und Beanspruchung (Spannungsmehrachsigkeit) bei Raumtemperatur berücksichtigt werden.
Die Abnahmekriterien im Stahlbau waren Thema des Vortrags von Prof. Dr. Max Spannaus von der Universität der Bundeswehr in München. Dabei geht es häufig um die Qualität von Schweißverbindungen, die in der DIN EN ISO 5817 über die Bewertungsgruppen definiert sind. Viele der dort aufgeführten Kriterien orientieren sich nicht an die technischen Anforderungen, die sich aus der Funktion einer Schweißkonstruktion ergeben. Eine weitere grundlegende Problematik liegt auch in der Definition der vereinbarten Leistungen, die häufig in überhöhte oder fehlerhafte Anforderungen resultieren. Aufgrund fehlender Erfahrungen führt dies oft zu juristischen Auseinandersetzungen. Zudem ist der Begriff „Mangel“ nicht einheitlich definiert. Das Prinzip „Fitness for Purpose“ berücksichtigt, dass technische Perfektion in der Regel nicht erforderlich und die Funktionalität trotz Fehlstellen häufig gewährleistet ist. Hierzu wird aktuell in verschiedenen Einrichtungen geforscht. Dabei sollten Handlungsempfehlungen und eine Richtlinie erarbeitet werden, wie ein sachgerechter Umgang mit Nichtkonformitäten erfolgen kann.
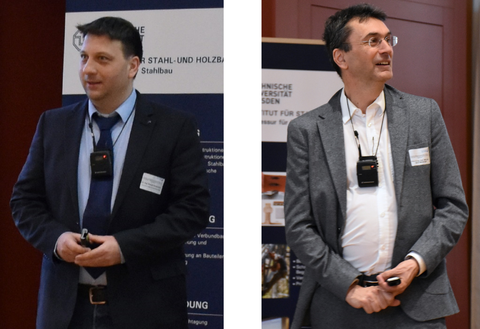
Dr.-Ing. Ronald Schwuchow (links) und Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger (rechts)
Der folgende Vortrag wurde von Dr. Ronald Schwuchow vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zum Thema der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) mit dem Fokus auf den Stahlbau gehalten. Ein Aufgabenbereich des DIBt ist es, einheitliche bundesländerübergreifende Regeln für eine wirtschaftliche Umsetzung zu fördern und die Diskrepanz zwischen dem Stand der Forschung und den geltenden normativen Regeln zu verringern. Grundlage der anzuwendenden Technischen Baubestimmungen auf Länderebene ist die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), die in den meisten Bundesländern nahezu unverändert übernommen wird. Eine wesentliche Grundlage bei der Entwicklung von technischen Baubestimmungen ist die GruSiBau, in der Grundlagen zur Festlegung von Sicherheitsanforderungen für bauliche Anlagen definiert sind und die in aktueller Fassung 2025 vorliegt. Beim Stahl- und Verbundbau wird an der paketweisen Einführung der zweiten Generation der Eurocodes gearbeitet. Die meisten Bauprodukte für den Stahlbau werden in harmonisierten Europäischen Normen (hEN) geregelt, für Stahl- und Aluminiumtragwerke steht die bauaufsichtliche Einführung der neuen EN 1090 (2024) an.
Im Anschlussvortrag thematisierte Prof. Dr. Martin Mensinger von der Technischen Universität München die Begutachtung historischer Stahlgusslager am Beispiel des Chemnitzer Viaduktes. Dabei ging er zunächst auf die Vor- und Nachteile von zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfmethoden ein. Mit Hilfe von Gusssimulationen konnte beim Chemnitzer Viadukt die Fertigung von Lagerteilen nachgebildet werden. Hieraus konnten dann Schlüsse für die Verortung möglicher Gussfehler aufgrund des Erstarrungsprozesses gezogen und die gezielte Prüfung der Lager veranlasst werden. Weitere Themenschwerpunkt waren die numerische Nachrechnung und die Durchführung von Sprödbruchnachweisen unter Berücksichtigung des Risswachstums bei zyklischer Beanspruchung durch den Schienenverkehr. Wesentlich für den maximalen Erhalt der Lagerkonstruktionen beim Chemnitzer Viadukt war das Zusammenspiel der verfügbaren Prüf-, Berechnungs- und Nachweismethoden.

Dr.-Ing. Thomas Klähne (links) und Dominik Nimführ M. Sc. (rechts)
Den letzten Vortragsblock eröffnete Herr Dr. Thomas Klähne von KLÄHNE BUNG Ingenieure mit seinem Vortrag über die Extradosed-Brücke am Nürnberger Kreuz, dem sogenannten Fly Over. Für das Überführungsbauwerk mit einer Gesamtlänge von 567 m wurden im Ergebnis mehrere Entwürfe kombiniert. Nach einer Studie möglicher Entwurfsvarianten fiel die Entscheidung zugunsten einer Stahlverbundkonstruktion kombiniert mit der Extradosed-Brückenbauweise. Diese robuste Lösung ermöglichte eine schnelle Herstellung bei einem hohen Vorfertigungsgrad. Während der Montage mit Hilfe des Einschiebens kam es zu keinen Verkehrsbeeinflussungen. Über den V-förmig ausgeführten Pfeilern sind schrägstehende abgestufte Stahlhohlkastenpylone angeordnet, die monolithisch mit dem Brückenüberbau verbunden sind. Neben der konstruktiven Gestaltung des Überbaus, der Pylone und Pfeiler ging Dr. Klähne auf die Tragwerksplanung, Montage und Details der Bauausführung ein.
Der Abschlussvortrag wurde von Herrn Dominik Nimführ von der Werner Sobek AG zum Projekt Stuttgart 21 gehalten. Er thematisierte hierbei insbesondere den Stahlbau vom unterirdischen Bahnhofsgebäude mit den sogenannten Verteilerstegen, Lichtaugen und Gitterschalen. Im Bahnhof wurden drei 81 m lange Verteilerstege mit variierenden Breiten errichtet, über die der Zugang zu den Bahngleisen erfolgt. Die sogenannten Lichtaugen werden in einer speziellen Bauform zur natürlichen Belichtung und Belüftung des Bahnhofsgebäudes ausgeführt. Dabei werden Dreieckhohlprofile verwendet, die eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig schlankem Erscheinungsbild aufweisen. Die Lichtaugen sind überwiegend antiklastisch gekrümmt, werden mit viereckigem Gittermaschennetz ausgeführt und stützen sich auf der Stahlbetonschalenkonstruktion des Bahnhofdaches ab.
Das vielfältige Programm der Dresdner Stahlbaufachtagung 2025 lud zu Fachdiskussionen der Teilnehmer und Referenten in den Pausen ein und bot eine ausgezeichnete Plattform für den fachlichen Austausch. Ergänzt wurde die Tagung von verschiedenen Fachausstellern, die an ihren Ständen über aktuelle Entwicklungen und neue Produkte informierten. Die kommende Stahlbaufachtagung für das Jahr 2026 befindet sich bereits in der Planung. Über Details wird zur gegebenen Zeit an gewohnter Stelle informiert.
Bericht: Dipl.-Ing. Malte Homeyer (TU Dresden)