30.04.2025
Der Schlafschalter: Wie ein einzelnes Signal im Gehirn Schlaf an- und ausschaltet
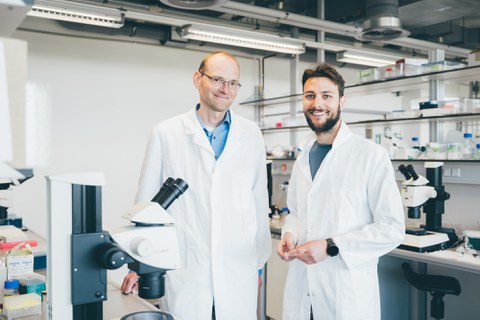
Prof. Henrik Bringmann und Lorenzo Rossi.
Wir Menschen verbringen rund ein Drittel unseres Lebens schlafend. Überraschend ist, dass wir aber immer noch recht wenig darüber wissen, wie unser Gehirn das Einschlafen und Aufwachen steuert. Nun hat ein Forschungsteam um Prof. Henrik Bringmann am Biotechnologischen Zentrum (BIOTEC) der TU Dresden ein weiteres Teil dieses Puzzles entdeckt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigten, dass ein einzelnes Signal im Gehirn wie ein biologischer Schalter wirkt – es kann sowohl den Schlaf einleiten als auch beenden. Ihre im Fachjournal „Current Biology“ veröffentlichten Ergebnisse wurden durch die Untersuchung eines winzigen Fadenwurms namens C. elegans ermöglicht, einem bedeutenden Modellorganismus in der Biologie.
„Einzuschlafen ist wirklich wichtig, aber genauso wichtig ist es, wieder aufzuwachen!“, betont Prof. Bringmann, Forschungsgruppenleiter am BIOTEC und Leiter der Studie. „Wir wissen, dass das Ein- und Aufwachen von einer speziellen Gruppe von Gehirnzellen gesteuert wird, den sogenannten Schlafneuronen. Allerdings verstehen wir noch nicht genau, wie diese die nachgeschalteten molekularen Prozesse kontrollieren, die uns einschlafen und wieder aufwachen lassen.“
Um diese Fragen zu beantworten, wandte sich die Bringmann-Gruppe C. elegans zu, einem winzigen Fadenwurm. Im Gegensatz zu Menschen, die Tausende von Schlafneuronen zur Steuerung des Schlafs besitzen, benötigt C. elegans nur ein einziges Neuron für diese Aufgabe. Diese Einfachheit macht ihn zu einem idealen Modellorganismus, um die grundlegenden molekularen Mechanismen des Schlafs zu untersuchen.
Diese Forschung wirft Licht auf eine der grundlegenden Fragen der Biologie: wie Organismen Schlaf und Wachheit regulieren. Durch das Verstehen der elementaren molekularen Maschinerie hinter dem Schlaf können Forschende Schlafstörungen wie Narkolepsie und Insomnie, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, besser verstehen. Die Ergebnisse tragen auch zu der wachsenden Zahl von Beweisen bei, dass selbst einfache Modellorganismen grundlegende Mechanismen des Lebens offenbaren können.
Ein Molekül, zwei Aufgaben
Das Team konzentrierte sich auf einen chemischen Botenstoff namens FLP-11. Wenn ein Schlafneuron aktiv wird, setzt es FLP-11 frei. Solche Botenstoffe funktionieren wie molekulare „Notizen“, die zwischen Gehirnzellen ausgetauscht werden, um verschiedene Befehle zu übermitteln. „Wir wussten, dass FLP-11 für den Schlaf unerlässlich ist, aber wir kannten weder die genaue Botschaft noch den Empfänger“, erklärt Prof. Bringmann.
Durch genetisches Screening identifizierten die Forschenden einen Schlüsselrezeptor namens DMSR-1, an den FLP-11 bindet, um seine Botschaft zu übermitteln. Fehlte dieser Rezeptor im Gehirn, beobachteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Würmer deutlich weniger schliefen. Es stellte sich heraus, dass DMSR-1 in verschiedenen Arten von Neuronen vorhanden ist. Je nachdem, welches Neuron die Botschaft empfing, waren die Auswirkungen dramatisch unterschiedlich.
„Wir haben entdeckt, dass FLP-11 DMSR-1-Rezeptoren in zwei völlig verschiedenen Arten von Neuronen aktiviert“, sagt Lorenzo Rossi, ein Doktorand, der die Experimente im Labor von Prof. Bringmann durchführte.
„Wir fanden den Rezeptor in Neuronen, die Wachheit fördern. Wenn er durch FLP-11 aktiviert wird, schaltet der Rezeptor die Wachheitsneuronen ab. Dies wiederum hilft dem Wurm, einzuschlafen. Andererseits ist der Rezeptor auch im Schlafneuron selbst vorhanden. Hier schaltet er es ebenfalls ab, was letztendlich das Tier wieder aufweckt“, erklärt Lorenzo Rossi.
Mit anderen Worten: Derselbe chemische Stoff, der den Wurm einschlafen lässt, hilft ihm auch wieder aufzuwachen, indem er einfach verschiedene Zellen im Gehirn anspricht. „Es ist ein effizienter Mechanismus, der den Beginn des Schlafs steuert und gleichzeitig seine Dauer kontrolliert“, fügt Prof. Bringmann hinzu.
Ein universelles Prinzip?
„Im Gegensatz zu Menschen haben C. elegans viel kürzere Schlafphasen, die nur etwa 20 Minuten dauern. Schlaf ist jedoch ein so grundlegender biologischer Prozess, dass viele am Schlaf beteiligte Moleküle und Mechanismen über verschiedene Arten hinweg ähnlich sind“, sagt Prof. Bringmann. „Wir wissen noch nicht, ob derselbe Schlafschalter auch beim Menschen existiert, aber er liefert einen vielversprechenden Hinweis bei der Suche nach Mechanismen, die den Schlaf in unserer Spezies steuern.“
Originalveröffentlichung
Lorenzo Rossi, Kenneth Amoako, Inka Busack, Luca Golinelli, Amy Courtney, Judith Besseling, William Schafer, Isabel Beets, Henrik Bringmann: FLP-11 RFamide neuropeptides induce and self-inhibit sleep through the Gi/o protein-coupled receptor DMSR-1. Current Biology (Mai 2025)
Link: https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.03.039
Über das Biotechnologisches Zentrum (BIOTEC)
Das Biotechnologische Zentrum (BIOTEC) wurde 2000 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dresden mit dem Ziel gegründet, modernste Forschungsansätze in der Molekular- und Zellbiologie mit den in Dresden traditionell starken Ingenieurwissenschaften zu verbinden. Seit 2016 ist das BIOTEC eines von drei Instituten der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung Center for Molecular and Cellular Bioengineering (CMCB) der TU Dresden. Das BIOTEC nimmt eine zentrale Position in Forschung und Lehre im Forschungsschwerpunkt Molecular Bioengineering ein und verbindet zellbiologische, biophysikalische und bioinformatische Ansätze miteinander. Es trägt damit entscheidend zur Profilierung der TU Dresden im Bereich Gesundheitswissenschaften, Biomedizin und Bioengineering bei.
www.tud.de/biotec
www.tud.de/cmcb
Bildmaterial:
Medienkontakt:
Dr. Magdalena Gonciarz
Public Relations Officer
Tel.: +49 (0) 351 458 82065
E-mail: cmcb_press@tu-dresden.de
Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Prof. Henrik Bringmann
Biotechnology Center (BIOTEC) of TU Dresden
Tel: +49 (0) 351 463 40330
Email:
Webpage: https://tud.link/uxep
