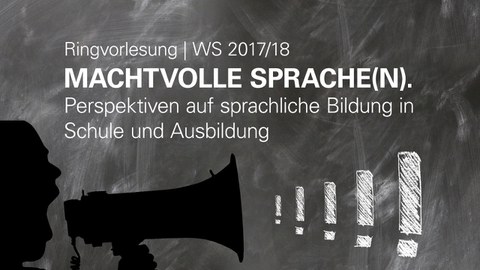Oct 10, 2017; Talk
Ringvorlesung: Machtvolle Sprache(n). Perspektiven auf sprachliche Bildung in Schule und AusbildungWer ist 'deutsch', wer nicht? Monolingualer Habitus und Neo-Linguizismus als Herausforderungen für die Schule
01069 Dresden
ABSTRACT
Weltweit gesehen ist Mehrsprachigkeit der Normalfall, und auch Deutschland ist ein mehrsprachiges Land. Dies zeigt sich auch im Bildungsbereich: In Kindergarten, Schule und Ausbildung sind viele Lernende mehrsprachig und besitzen nicht nur Kompetenzen im Deutschen, sondern auch noch in anderen Sprachen, z.B. in sogenannten „Heritage-Sprachen“, die Teil des kulturellen Erbe der Familie sind und im Rahmen von Zuwanderung nach Deutschland gelangt sind, etwa wenn Eltern oder Großeltern aus der Türkei, Russland, einem arabischen Land o.ä. stammen. Bei SprecherInnen, die in Deutschland geboren sind oder hier schon länger leben, ist das Deutsche typischerweise die dominante Sprache, nicht nur als Umgebungssprache, sondern oft auch in der Kommunikation innerhalb der Familie. Mehrsprachige können dabei auf Ressourcen in ihren verschieden Sprachen zugreifen, wechseln oft virtuos zwischen Sprachen hin und her und mischen sie kreativ. Wie psycho- und neurolinguistische Studien zeigen, bringt Mehrsprachigkeit eine Reihe kognitiver Vorteile mit sich, die sich unter anderem in Bereichen von geistiger Flexibilität, kognitiver Kontrolle und dem Arbeitsgedächtnis zeigen. Trotz dieser positiven kognitiven Effekte und der mehrsprachigen Normalität in unserer Gesellschaft herrschte im Bildungsbereich lange eine Perspektive vor, die von einer grundsätzlichen „Förderbedürftigkeit“ Mehrsprachiger ausging. In meinem Vortrag untersuche ich die Basis solcher Vorurteile und diskutiere die Herausforderungen, die sich hieraus für den Bildungsbereich ergeben. Ein Schwerpunkt wird auf „wir-/sie“-Dichotomien im Kontext von Mehrsprachigkeit liegen, die auf einen verbreiteten monolingualen Habitus beruhen und zu neo-linguizistischen Praktiken führen können. Ich analysiere unter anderem Benennungspraktiken, die Ius sanguinis-Restriktionen von „Deutsche/r“ wiederspiegeln, und Daten zu sprachlichen Einstellungen und Sprachideologien, die Mehrsprachigen die Eigentümerschaft für das Deutsche und seine Dialekte absprechen und mehrsprachige Praktiken im Bildungsbereich pathologisieren. Vor diesem Hintergrund stelle ich ein Interventionsprogramm vor, das multimediale Materialien für die Aus- und Fortbildung von ErzieherInnen und Lehrkräften umfasst sowie Bausteine für Anwendungen in vorschulischer Bildung, Primar- und Sekundarstufe bietet (www.deutsch-ist-vielseitig.de).
Moderation: Prof. Dr. Dorothee Wieser (TU Dresden)