Mar 14, 2023
Episode 03: It's all a question of genes. The chance of limitless possibilities?
Our podcast series you ask we explain - Berührungsängste in der Medizin started in January and is published monthly. In the 3rd episode, we discussed the topic: It's all a question of genes. The chance of limitless possibilities?
We wanted to discuss with you and answer your questions. Didn't have time to join us? No problem: just listen to our podcast on the go - on Spotify, Apple Music, Deezer or here.
Person 1: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem COSMO Wissenschaftsforum und den Städtischen Bibliotheken Dresden.
Konstantin Willkommen: (...) Ja, genau. Erst mal ein bisschen Applaus. (...) Herzlich willkommen heute Abend hier zu unserer neuen Folge von YOU ASK we explain, dem Podcast der Medizinischen Fakultät Dresden, bei dem wir Berührungsängste mit medizinischen Themen, aber auch mit medizinwissenschaftlichen Themen ausräumen wollen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir nehmen das Ganze an einem besonderen Ort auf. Nicht irgendwo, sondern genau hier im Dresdner Hygienemuseum. Und zwar in einer besonderen Ausstellung von Genen und Menschen. Denn das soll heute auch an diesem Abend unser Thema sein. Alles eine Frage der Gene. Die Chance auf unbegrenzte Möglichkeiten. Wir kennen vielleicht alle ein bisschen so dieses Szenario. Man sieht einen Menschen, der sehr erfolgreich ist im Sport und dann wird immer gesagt ‚Das sind die Gene.‘ Oder vielleicht leidet jemand an einer sehr schweren Krankheit und man sagt ‚Das sind die Gene.‘ Oder aber ein Kind wurde geboren und es ist wirklich sehr schön. Dann sagt man ‚Das sind die Gene.‘ Und trotzdem gibt es auch das Sprichwort, das jetzt ein freies Zitat: ‚Wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen.‘ Und das sind nicht immer unbedingt alles mit uns Verwandte, was das Ganze bedeutet und was es damit auf sich hat, damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wir, das sind meine Gäste. Heute zu meiner Rechten Professor Frank Buchholz, Professor für den Fachbereich Medizinische Systembiologie an der Medizinischen Fakultät Dresden und Leiter der translationalen Forschung am Universitätskrebszentrum Dresden. Jetzt dürfen Sie gerne klatschen. (...) Ein Platz weiter sitzt Professor Dr. Andreas Lob-Hüdepohl. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates, Geschäftsführer des Berliner Instituts für Christliche Ethik und Politik und Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. (...) Und ganz rechts Professor Dr. Alexander Strobl. Er ist Professor für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der TU Dresden mit den Forschungsschwerpunkt in Neurogenetik, individueller Unterschiede in Temperament und Emotionen, Kognition, Motivation und Sozialverhalten. (...) Mein Name ist Konstantin Willkommen und ich darf Sie heute Abend hier durch diesen Abend geleiten. Und wir steigen mit einer ganz einfachen Frage ein ‚Was sind denn eigentlich Gene?‘ Professor Buchholz, Sie haben drei Sätze dafür. Kein Stress.
Professor Buchholz: Ja. Was sind Gene? Gene sind im Prinzip Erbmerkmale, die wir weitergeben an unsere Nachkommen. Das ist also im Prinzip die Information, die in der in der DNA steht. Vielleicht die wichtigsten Aspekte, Gene sind die Gene, die für Proteine kodieren. Also für alles das, woraus dann unsere Zellen gebaut werden. Diese Gene haben wir ungefähr 20.000 in allen unseren Zellen, fast in allen unseren Zellen. Und die steuern im Prinzip ziemlich viele Prozesse. Zum anderen auch, wie wir uns entwickeln als Mensch und wie die reguliert und gesteuert werden, entscheidet praktisch, wie wir aussehen und auch teilweise, wie wir uns verhalten.
Konstantin Willkommen: Vielen Dank für diese kleine Einführung, Herr Professor Strobl. Neurogenetik, was kann man sich darunter vorstellen?
Professor Strobel: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein prätentiöser Begriff für das, was wir tatsächlich machen. Es geht uns einfach darum, Unterschiede in den Genen mit Unterschieden im Verhalten in Verbindung zu bringen und das auch über dazwischen liegende Beschreibungsebenen, also den Pfad von genetischer Variation hin zu Variation im Verhalten eben auch über dazwischen liegende Ebenen, zum Beispiel neuronale Funktionen oder so ein klein wenig zu beschreiben. Muss man eher sagen als zu ergründen, würde ich mal meinen.
Konstantin Willkommen: Ja, Herr Professor Lob-Hüdepohl, Sie haben mir gesagt, Sie sind kein Naturwissenschaftler. Warum wenden sich trotzdem Menschen mit diesem Thema an Sie?
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, weil wir auf diese Gene wie auf vieles einwirken können. Und die Frage stellt sich, ob wir nicht nur können, sondern ob wir das, was wir können, auch dürfen, sollen oder auch müssen. Beispielsweise die Gentherapie, die somatische Gentherapie ist das eine, und das andere ist eben die Einwirkung auf die Keimbahn. Und damit haben wir uns im Deutschen Ethikrat sehr intensiv beschäftigt, ob das denn auch alles so sein soll, was man machen kann. Und das ist eine Frage der Ethik.
Konstantin Willkommen: Vielen Dank. Da haben Sie jetzt schon ein paar Stichpunkte genannt, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Professor Buchholz, wo stehen wir denn jetzt eigentlich, dass wir darauf Einfluss nehmen wollen?
Professor Buchholz: Ja, wir haben ja zur Jahrtausendwende ziemlich genau gefeiert. Die Entschlüsselung des Humangenoms wurde sogar als Buch des Lebens häufig bezeichnet. Natürlich, wo die Basenabfolge, also das sind ja im Prinzip sind ist ja die DNA kodiert von vier Basen und diese vier Basen beschreiben dann im Prinzip, wie die Ausprägungen dann im Prinzip ist. Jeder von uns hat ungefähr 700.000 DIN A4 Seiten an Informationen, die da im Prinzip drin steht. Und das haben wir gefeiert, haben gedacht, dass wir daraus erklären und wissen, wie es abläuft. Das hat sich zum großen Teil, würde ich sagen, leider nicht so eingestellt. Also das war ein ganz wichtiger Meilenstein in der Genetik, würde ich sagen, wie praktisch die menschliche DNA Abfolge aussieht. Im Moment sind wir gerade wieder an einem ganz wichtigen Umbruch. Also wir haben gelernt, wie man die DNA lesen kann und im Moment sind wir gerade an dem Umbruch, dass wir tatsächlich jetzt dann auch die Werkzeuge haben, wo wir gezielt darauf eingreifen können und die DNA verändern können. Das heißt, wir haben gelernt zu lesen und im Moment sind wir gerade dabei zu lernen, wie wir schreiben, also wie wir im Prinzip das Genom auch gezielt verändern können. Und das kommt natürlich mit sehr vielen Möglichkeiten, aber vielleicht auch Risiken, die dann beurteilt und genau analysiert werden müssen.
Konstantin Willkommen: Dann fangen wir mal mit dem ersten Schritt an, mit dem Lesen. 700.000 Seiten. Wie viel haben Sie davon schon gelesen?
Professor Buchholz: Lesen bringt ja nicht viel in dem Sinne. Man kann sich das natürlich anschauen. Und es gibt Webseiten, wo man nach bestimmten Stellen suchen kann, zum Beispiel. Also das machen wir wirklich tagtäglich, dass wir zum Beispiel ein bestimmtes Gen anschauen wollen und gucken, wie ist da die Sequenzabfolge und was gibt es da vielleicht für Mutationen dafür. Und dafür gibt es heutzutage Tools, so online Tools, wo man dann im Prinzip danach suchen kann. Aber man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass man das. Also es würde nichts bringen. Man liest ja nur ATG und C in einer bestimmten Abfolge. Man kann das also nicht lesen, sondern man muss dann das übersetzen und dann genau schauen, wo zum Beispiel die proteincodierenden Gene zum Beispiel sind. Das ist ganz interessant. Nur eine kleine Auswahl dieser 700.000 Seiten codiert wirklich zum Beispiel für Proteine, also nur ganz wenig. Von dem ist im Prinzip dann dafür da, um Enzyme und solche Sachen herzustellen.
Konstantin Willkommen: Und was ist mit dem Rest?
Professor Buchholz: Ja, das ist lange Zeit als Junk DNA bezeichnet worden, auch weil man am Anfang nicht wusste, was ist das? Da hat man gedacht ja, das ist wahrscheinlich irgendwelcher Müll, der da dann so drin steht und den tragen wir mit uns rum. Ich glaube, mittlerweile sehen viele Wissenschaftler das aber auch ein bisschen anders, weil festgestellt worden ist, dass viele dieser nicht codierenden Sequenzen tatsächlich trotzdem auch abgelesen werden. Also es wird trotzdem eine RNA davon hergestellt und viele dieser Transkripte scheinen tatsächlich doch auch eine Funktion zum Beispiel zu haben. Also von daher war man da vielleicht ein bisschen voreilig zu sagen, der Rest ist Abfall und Müll. Vieles davon ist sicherlich kein Müll, sondern reguliert tatsächlich dann auch, wie die Gene abgelesen werden zum Beispiel.
Konstantin Willkommen: Professor Strobl, Sie beschäftigen sich ja dann auch mit dem Verhalten, auch wenn Sie sagen, Neurogenetik ist vielleicht eher das Thema. Trotzdem so eine allgemeine Frage, dann je nachdem das, was man da lesen kann, kodiert für Proteine oder nicht, aber hat immer einen Einfluss. Wie groß ist dieser Einfluss?
Professor Strobel: Also der Einfluss ist sehr, sehr klein und wenn ich sage, sehr, sehr klein, dann ist das wirklich absurd klein, also kleiner 1 % ist vermutlich eine massive Überschätzung. Wenn wir jetzt uns wirklich komplexe Trades anschauen, die psychologisch relevant sind. Das ist sicherlich anders, wenn es um biologische Funktionen geht. Da kann man vielleicht auch stärkere Effekte finden, aber wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass vielleicht bei einer Erblichkeit von Persönlichkeitseigenschaften von so 30 bis 60 % wir so 100-200 Gene vielleicht irgendwann mal identifizieren können, die diese 30 bis 60 % aufklären. Und weil die ersten Studien halt nahegelegt haben, dass so die Aufklärung der Varianz, also wie viel der Unterschiedlichkeit eine Eigenschaft wird erklärt durch Unterschiede in den bestimmten zugrundeliegenden Faktoren, dass die so bei 1 bis 2 % läge.
Konstantin Willkommen: (...) Vielen Dank für diesen ersten Teil. Ich musste aber noch mal nachhaken. Sie sagen zum einen unser Verhalten erklärt sich nur zu einem geringen Anteil aus unseren Genen. Aber es erscheint dann natürlich für Menschen, die an genetischen Krankheiten erleiden, scheint dieser kleine Anteil natürlich einen sehr großen Einfluss auf deren Lebensrealität zu haben. Wie ist das miteinander vereinbar?
Professor Strobel: Das ist die Frage, um welche Unterschiede es sich handelt, also was solche monogenetischen Erkrankungen wie eine einzelne Mutation jetzt zum Beispiel zu Ausbruch der Erkrankung führt. Da ist natürlich dann der Einfluss massiv. Aber wir sprechen ja von so Dingen wie Ängstlichkeit oder Neugierde, die durch sehr, sehr viele Gene nicht beeinflusst werden, sondern die sozusagen die Basis bilden, Ausgangsmaterial, wo dann Umweltfaktoren ansetzen können in Interaktion mit den Genen, dann halt eben sehr komplexe Ausprägungen von Verhalten in Gang bringen können. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte als monogenetische Erkrankungen wie was weiß ich. Was fällt mir jetzt gerade ein? Huntington zum Beispiel. Chorea Huntington wäre so eine Erkrankung oder Mukoviszidose, wo dann halt das Gen schon einen entscheidenden Faktor darstellt und damit auch kausal letzten Endes wirkt, was er bei den anderen Variationen, die wir so untersuchen, ja nicht wirklich sagen kann. Es ist kein einzelner der Variationen, die wenn überhaupt, zum Zustandekommen von Ausprägung und Ängstlichkeit beitragen, ist jetzt wirklich streng genommen notwendig, sondern trägt halt vielleicht bei der einen Person was bei, bei der anderen nicht.
Konstantin Willkommen: Das heißt, in diesem Fall spielen auch immer Umwelteinflüsse eine Rolle. Wo ist denn da unser Wissensstand aktuell? Inwiefern die Umwelt einen Einfluss darauf hat, nach welchem Ausmaß?
Professor Strobel: Wenn wir von Erblichkeitsstudien ausgehen, dann informieren wir uns ja darüber, wie viel der Unterschiede in einer Eigenschaft auf unterschiedlichen Genen zurückgehen und damit aber auch gleichzeitig immer die Informationen enthalten ist: Wie viel geht denn dann auf die Umwelt zurück? Und dann können wir die Umwelteinflüsse noch zergliedern in Einflüsse der geteilten Umwelt, beispielsweise zwischen Geschwistern, der Familie oder der spezifischen Umwelt der Freunde. Sie sagten vorhin, es müssen nicht unbedingt verwandte Personen sein, die Einfluss auf das Verhalten nehmen. Und so kann man ungefähr Pi mal Daumen sagen in den allermeisten Fällen ist es halt irgendwie 50:50. Aber selbst das ist vermutlich vereinfacht ausgedrückt, weil ja immer auch noch die Interaktion der beiden Faktoren eine Rolle spielt. Ein Gen an sich wirkt halt einfach nie losgelöst von der Umwelt und die Umwelt kann auch nichts auswirken auf Verhalten, ohne dass irgendwie eine Basis da ist, dass überhaupt ein Organismus da als sozusagen.
Konstantin Willkommen: Herr Professor Buchholz, wenn Sie dann oder wenn man dann diesen Code liest, ist das dann somit also immer nur die halbe Wahrheit, Weil in gewisser Weise, wenn wir uns nur die Basen anschauen, wissen wir ja nicht, was auf die Basen eingewirkt hat.
Professor Buchholz: Ja, das könnte man so sehen. Also ich glaube, man muss tatsächlich noch mal klar unterscheiden. Wir kennen bestimmte Mutationen, die dann unausweichlich praktisch zu einer Erkrankung führen. Also wenn man die Mutation hat, eine monogenetische Erkrankung, wenn diese eine Base einfach anders ist als das, was sie eigentlich sein sollte, wie es in allen anderen in Anführungszeichen normalen Menschen ist, dann kann sich eine Krankheit unausweichlich auch ausprägen. Sagen wir mal, wir haben ja schon einige genannt Bluterkrankheit, Hämophilie ist eine andere, das wird vererbt. Und wenn man diesen Gendefekt hat, dann wird man diesen einen Korrelationsfaktor nicht machen können. Und dieser Mensch wird unausweichlich immer vorsichtig sein müssen, es sei denn, er wird behandelt. Da gibt es heute schon Therapien, aber in der Zukunft dann vielleicht sogenannte Gentherapien.
Professor Lob-Hüdepohl: Vielleicht darf ich noch mal nachfragen, damit ich das auch richtig verstehe. Ich habe bislang verstanden, dass wenn etwas monogenetisch angelegt ist, dann ist dem Grunde nach einer Anlage da. Aber wann sie ausbricht, eine Erkrankung beispielsweise, in welcher Schwere, Das lässt sich doch, wenn ich das richtig verstanden habe, bislang nur schwer vorhersagen, oder irre ich mich da?
Professor Buchholz: Es kommt, es kommt schon darauf an, also wenn zum Beispiel eine Mutation, bleiben wir mal bei dem bei der Hämophilie Faktor VIII, da kennt man bestimmte Mutationen, wo man dann vorhersagen kann, diese Person wird gar keinen Faktor VIII bilden können. Dann wird es eine schwere Form der Hämophilie sein. Es kann natürlich irgendwo eine andere Mutation sein, die dazu führt, dass das Faktor VIII Gen nicht stark genug produziert wird. Und dann hat man vielleicht eine milde Form der Hämophilie also. Aber wenn man die Mutation kennt, dann kann man im Prinzip genau sagen Ist das eine schwere Form, Wird es eine schwere Form sein oder ist es eher eine milde Form?
Konstantin Willkommen: Also wenn wir den Code lesen und sehen diese Mutation, wie wir vorhin gesagt haben, dann ist es ja schon so, dann wissen wir nicht mehr, was vielleicht vorgeschaltet war. Konnten wir schon in der Forschung, in der Vergangenheit vielleicht Faktoren aus der Umwelt identifizieren, die solche Mutationen provozieren.
Professor Buchholz: Also wir alle sind ständig mutagenen Substanzen ausgesetzt. Also auch in unseren Körpern verändert sich die DNA eigentlich ständig, täglich. Das fängt mit der UV Strahlung an, aber nicht nur. Also ganz unausweichlich entstehen Radikale, die die DNA auch schädigen können. Oder es gibt natürlich auch Gifte und wenn man halt höherer UV Strahlung zum Beispiel ausgesetzt ist, dann wird der Anteil der Mutationen in der DNA dadurch auch höher sein. Das kann man natürlich sagen. Also von daher hat die Umwelt natürlich einen klaren Einfluss darauf, aber man kann sich im Prinzip auch nicht wirklich vollständig davor schützen. Das gehört dazu. Und unser Körper hat sich darauf eingestellt, dass im Prinzip immer wieder DNA Schädigungen auftreten können. Unsere Zellen können solche DNA Schädigungen reparieren und damit ist es in den meisten Fällen dann auch okay. Es passiert nichts weiter. Aber wenn man Unglück hat, dann ist vielleicht ein Gen geschädigt worden und die Zelle hat es dann so repariert, dass zum Beispiel dann auch so kann zum Beispiel Krebs entstehen. Wenn dann bestimmte Gene zufällig mutiert sind, die einfach eine Zelle entarten lassen, dann ist das eigentlich der Mechanismus zum Beispiel, wie Krebs entsteht. Denn auch Krebs ist zum ganz großen Teil eine genetische Erkrankung.
Konstantin Willkommen: In die Richtung gehen wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich möchte noch einmal eine Frage an Sie richten, Herr Professor Lob-Hüdepohl. In Anschluss daran jetzt mal ausgeklammert die Diskussion um unsere aktive Manipulation unserer Gene und die Diskussion darum. Dann noch mal die Frage: Gibt es auch Diskussionen darüber, dass wir versuchen, uns vor solchen Mechanismen, die unsere DNA schädigen können, zu schützen. Also dass unsere Gesetzgebung die generelle. Wie können wir unsere Umwelt so schaffen, dass wir ungewollte Mutationen oder ungewollte Manipulation unserer Gene vermeiden?
Professor Lob-Hüdepohl: Na ja, zunächst mal gibt es keine Diskussion. Und dann gibt es welche. Es gibt keine Diskussion darüber, dass wir permanenten Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, die faktisch unsere Mutationen in Gang bringen oder am Laufen halten. Wenn es dagegen beispielsweise Mutationen, die eben anthropogen Natur sind, also durch bestimmte Umweltvergiftungen und dergleichen. Wenn sie befördert werden sollten, Und da kennen wir ja eine ganze Reihe Faktoren, die auf uns einwirken, also durch Schadstoffe in der Luft und dergleichen. Dann gibt es in der Tat Grundsatzdiskussionen - Wie lassen sich Risiken minimieren? Dass sich Risiken minimieren lassen müssen, ist unstrittig. Die Frage ist nur: Was gehört zu einem alltäglichen Risiko dazu, das wir schlicht leben? Also das Abwägen von Chancen und Risiken gehört natürlich als ethische Aufgabe dazu. Und je eingriffstiefer und je schadhafter solche Umwelteinflüsse sind, die beispielsweise unerwünschte Effekte auf unsere genetische Disposition oder Präfiguration auswirken, dann sollte man sie natürlich abstellen. Umgekehrt, wenn ich weiß, dass also die Eingriffstiefe nur relativ gering ist oder ich nur sehr schwer es fassen kann, dann gehört es zu einem allgemeinen Lebensrisiko dazu, dass ich mich auch anthropogenen Effekten aussetze.
Konstantin Willkommen: (...) Dann noch gleich eine weitere Frage an Sie. Wir sind immer noch bei dem Punkt, dass wir Gene lesen und uns anschauen, was da ist oder sein könnte. Und dann noch mal die Frage, was ja immer wieder auch mit hineinspielt ist: Wollen wir das überhaupt wissen?
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, also grundsätzlich sind wir hätte ich schon fast gesagt, von Natur aus wissensbegierige, Neugierige, ja Wesen. Das gehört zu unserer Verfassung als Menschen. Und da ist erst mal gar nichts einzuwenden, dass wir also etwas genauer verstehen wollen. Die Frage ist nur mit welchen Mitteln wollen wir dieses Wissen generieren? Also gibt es da ethisch problematische Methoden, beispielsweise um Wissensbestände zu erhöhen? Und wenn man bestimmte humane Experimente machen wollte, beispielsweise. Gibt es da Grenzen? Weil ich eben halt Menschen nicht einfach zerlegen kann, als ob sie Objekte wären? Ja, und es gibt natürlich auch die Frage Was sind die Ziele eines solchen Wissens? Will ich sie tatsächlich beispielsweise einsetzen, um was weiß ich Krankheiten zu heilen, möglicherweise frühzeitig zu erkennen. Also eine Prävention zu machen? Aber es gibt auch Wissensbestände, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, in der Diskussion im Rahmen der sogenannten prädiktiven Diagnostik. Also wenn ich frühzeitig weiß, dass ich an einer dementiellen Erkrankung ein hohes Risiko habe, dann kann es auch gefährlich sein, weil ich nämlich nicht weiß, ob überhaupt und wenn ja, wann. Und wenn ich also schon mit 20 weiß, dass ich möglicherweise mit 70 einer demenziellen Erkrankung unterliegen werde, dann kann das eine massive Beeinträchtigung nicht erst im 70. Lebensjahr sein, sondern schon im 20. . Und dann entscheidet man sich möglicherweise für das Nichtwissen. Deshalb gibt es auch im Rahmen der medizinischen Diagnostik auch das Recht auf Nichtwissen oder auch das Nichtwissen von meinem Geschwisterkind und dergleichen, um genau diese negativen Auswirkungen von Wissenspotenzialen auch einzuschränken.
Konstantin Willkommen: Herr Professor Strobl, da können wir vielleicht gleich ein bisschen den Bogen zu Ihnen schlagen. Gibt es denn da auch schon Daten dazu, wie das Wissen über so etwas zu einer Veränderung führt?
Professor Strobel: Also wir vermeiden typischerweise, dass überhaupt rückzumelden, wenn wir Untersuchungen durchführen, zu bestimmten Untersuchungen meistens sehr spezifische genetische Variationen und nicht einfach ins Blaue hinein, weil das die Information, ob nun jemand ein A- oder T-Allel an einer bestimmten Stelle hat, für die Person überhaupt keinen Informationsgehalt hat. Wenn wir die Hypothese hätten, Personen mit einem T-Allel an einer bestimmten Stelle wäre, im Schnitt 2 % ängstlicher, sag ich jetzt mal sehr vereinfacht. Und die Person ist jetzt tatsächlich ängstlich und sie hat dieses T-Allel heißt das meines Erachtens noch lange nicht, dass das nun daran läge, sondern es kann auch einfach eine Koinzidenz sein. Und deswegen würde das jetzt meines Erachtens eher ähnliche Effekte mit sich bringen, wie Sie jetzt gerade sagten. Was anderes wäre, wenn wir jetzt wirklich, sagen wir mal so eine Art Risiko Score bilden würden. Über dutzende, hunderte von genetischen Variationen, die vielleicht mit einer bestimmten Störung in Verbindung stehen, dann würde das natürlich schon einen gewissen Informationsgehalt besitzen. Und dann ist die große Frage ‚Was macht man dann?‘ Wenn es etwas wäre, wogegen man durch präventive Maßnahmen etwas tun kann, dann wäre es natürlich meines Erachtens schon angezeigt, das auch ruhig zu melden, zum Beispiel im Falle von Depressionsrisiko. Zu sagen, es wäre gut, wenn Sie vielleicht jetzt schon anfangen, in irgendeiner Form Stressbewältigungstraining-Kurse zu besuchen. Was weiß ich, kann ja viele Dinge tun, Dinge, die auch niemandem was schaden. Selbst wenn es also im Stressbewältigungstraining kann auch ohne das Risiko von Depressionen keine schlechte Sache sein. Außer halt die Zeit, die dann vielleicht sinnloserweise dafür draufgeht. Aber ich denke, das wäre maximal angezeigt, wenn man wirklich so gute Erkenntnisse hätte. Aber die haben wir halt und das muss ich dann halt einschränkend hinzufügen der Psychologie überhaupt gar nicht. Also in der Psychologie stochern wir nach wie vor sehr im Dunkeln. Es gibt wenige Lichtblicke oder gab, die dann kurz darauf auch wieder zunichte gemacht wurden oder zumindest es erhebliche Stimmen gibt, die sagen das ist eine tolle Geschichte, die er seit zehn Jahren in den Zeitschriften ausbreitet. Aber ehrlich gesagt sind da erhebliche Zweifel angebracht. Und offenbar glauben nicht mal die Wissenschaftler mehr dran, weil die Zitationsraten für genau diese Geschichte gegen das Massiv im Keller. Also insofern sind wir noch lange nicht so weit, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob wir rückmelden oder nicht, sondern wir müssen erstmal Wissen besitzen.
Professor Buchholz: Ich glaube, es ist aber vielleicht ein bisschen was anderes wie bei bestimmten Risikofaktoren die die ziemlich bekannt sind. Es gibt so ein Brustkrebsgen, was man kennt, dass das eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass man erkrankt. Für Demenz gibt es ein paar andere Marker, die relativ stark darauf hindeuten, dass man dann ein sehr hohes Risiko hat. Und ich glaube, es ist dann natürlich ich, ich kann das auch total verstehen. Also vielleicht ist es dann besser, es nicht zu wissen. Und das muss man glaube ich, jedem einzelnen selber überlassen. Also manche sind wirklich glaube ich leben dann besser damit, wenn sie es nicht wissen und das müssen sie auch selber entscheiden. Andere sagen ich möchte es gerne wissen, weil man kann ja teilweise vielleicht auch dann doch was dagegen tun. Also bestimmte Sachen, Herz Kreislauf Erkrankungen gibt es ja auch bestimmte Risikofaktoren, bestimmtes Cholesterin oder sowas wird ja häufig auch gemessen heutzutage. Da kann man sich dann natürlich auch drauf einstellen, aber wenn man es weiß, dass man da einen Risikofaktor hat, dann hilft einem das vielleicht auch zu sagen. Nee, also seinen eigenen Schweinehund zu bekämpfen, und sagen nee, ich weiß, das sollte ich nicht machen und da mache ich es auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es muss also jeder selber für sich entscheiden, ob er das wissen will oder nicht. Und die Freiheit muss da sein.
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, dem kann ich in dem Grundsatz völlig zustimmen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass es natürlich auch eine gewissen ein Nudging Effekt oder eine bestimmte Sogwirkung natürlich auswirkt. Das wissen wir schon. Hochinteressant für mich war, dass in einer breit angelegten Studie der Medizinischen Fakultät in Göttingen vor einigen Jahren - ich habe da mitgewirkt als Mitwirkender, der auch viel mit Menschen im Altersstadium auch zu tun hat - die raten eigentlich sehr stark davon ab, diese Form von prädiktiver Diagnostik vorzunehmen, weil die Nachteile überwiegen könnten. Ja, und Sie haben recht, ich kann mich zwar frei entscheiden, aber kann ich mich auch tatsächlich frei entscheiden? Oder gibt es nicht einen Druck, dass ich mich auch diesem Wissen aussetze? Und ich weiß, es gibt bestimmte Risikofaktoren, die kann ich auch unabhängig meines präzisen Wissens sozusagen auch schon vorbeugend praktizieren. Also ich finde es wichtig, dass man auch auf diese Faktoren natürlich hinweist.
Konstantin Willkommen: Das ist schon ein bisschen auch die Frage. Jetzt in diesem sehr medizinischen Kontext, ob man da jetzt unterscheidet habe ich einen Risikofaktor oder tatsächlich eine, ich nenne es jetzt mal verdächtige Erbanlage.
Professor Buchholz: Ja, das. Und da ist die Abgrenzung manchmal wahrscheinlich gar nicht so ganz leicht. Wie gesagt, wir haben ja die Beispiele schon genannt, wo es einfach gar keine andere Möglichkeit gibt. Wenn man eine bestimmte Mutation in einem Gen hat, dann prägt sich das Aus Ende aus. Und wir haben von anderen Sachen gehört, wo es noch darauf ankommt. Also selbst bei diesem Brustkrebsgen. Da hat man eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt aber nicht zu 100 %, dass man an Brustkrebs erkranken wird. Viele Sachen spielen miteinander und da kennen wir im Moment noch nicht genügend Details, warum jetzt bei dem einen das ausbricht oder vielleicht auch früher ausbricht und bei einem anderen erst später. Gene interagieren halt sehr stark miteinander und da jeder unterschiedlich ist, können wir das eigentlich gar nicht so genau sagen, welche Kombination jetzt was am Ende des Tages auslöst. Von daher ist das relativ kompliziert. Also es gibt Sachen, die prägen sich immer aus. Wenn das so monogene Erkrankungen zum Beispiel sind, über die wir gesprochen haben. Da gibt es kein Ja oder Nein. Aber es gibt auch andere, wo es dann im Prinzip ein Zusammenspiel gibt und erst dann sich das ausprägt, wenn wahrscheinlich die richtigen Kombinationen zusammenkommen.
Professor Strobel: Bei uns in der Psychologie ist es auch häufig einfach die Diskussion. Wir untersuchen ja keine Mutationen in dem Sinne, dass wir sehr, sehr seltene Genvariationen untersuchen, sondern Genvariationen, wo sagen wir mal, die Hälfte der Bevölkerung hat eher eine Variante und die andere hat die andere Variante oder zwei von dem einen und keins von der Variante. Und da sage ich zumindest erscheint nicht plausibel, wenn das nicht auch vielleicht sogar einen gewissen Nutzen hätte, in bestimmten Umwelten oder unter bestimmten Bedingungen halt eben günstiger, wäre die eine Variante aufzuweisen und in anderen die andere Variante. Eine genetische Variation, die zum Beispiel ursprünglich mit Depression in Verbindung gebracht wurde, scheint nur dann das Risiko zu erhöhen, wenn Personen in einer ungünstigen Umwelt aufgewachsen sind, zum Beispiel Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Und je mehr von ungünstigen Lebenserfahrungen auftreten, desto stärker sind die anfällig. Gleichzeitig in positiven Umwelten, sicheren Umwelten scheinen die sogar ein geringeres Depressionsrisiko aufzuweisen. Das ist allerdings eine von den Geschichten, von denen ich vorhin sagte, dass die auch in jüngerer Zeit sehr stark in Zweifel gezogen werden. Aber zu den grundlegenden Gedanken erscheint mir das sehr plausibel, dass es bestimmte Variationen schon gibt, die jetzt nicht Risikovarianten darstellen, sondern eher die Plastizität innerhalb der Population erhöhen. Je nach Umweltfaktoren halt eben mal einen evolutionären Vorteil darstellen oder eben auch nicht.
Konstantin Willkommen: Das ist ja sehr spannend, weil das ist ungefähr die Richtung, in die ich vorhin auch mal gehen wollte, um zu fragen - Machen wir aktiv unsere Umwelt so, dass sie unsere Gene schützt? Und das wäre ja ein Punkt. (...) An dieser Stelle noch mal ein Hinweis auch an unser wunderbares Publikum heute hier eine Teilidee von YOU ASK we explain ist natürlich auch der ‚you ask‘. Also zum einen die Fragen, die ich hier heute stelle. Diese habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben viel schlauere Leute getan, die dann ins Internet gegangen sind, nachdem sie unseren QR Code gescannt haben und dann haben sie uns die Frage zugeschickt. Wir haben uns bisher erst einmal mit dem Lesen beschäftigt, von den Genen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen mehr in die Richtung gegangen ‚Wie können wir das Ganze beeinflussen, manipulieren?‘ Herr Professor Buchholz, welche Optionen stehen uns da denn schon zur Verfügung?
Professor Buchholz: Es gibt seit langer Zeit Bestrebungen von Forschern, natürlich die DNA verändern zu können. Und wir können auch im Kleinen war das auch vorher schon möglich. Also alle Genetiker, die arbeiten, haben es geschafft, Genstücke zusammenzubauen in Bakterien und dann im Prinzip neue Abfolgen dadurch herzustellen. Es war nur bis jetzt nicht wirklich, bis vor kurzem nicht wirklich möglich, in diesen 700.000 Seiten. Man möge sich vorstellen in 700000 Seiten Irgendwo ist ein Fehler und man braucht jetzt ein Werkzeug, was diesen Fehler findet und genau an der Stelle dann das Ganze repariert sozusagen. Und das hat also doch sehr lange gebraucht. Und da gab es einen langen Vorlauf, dass Leute geforscht haben, das hinzubekommen. Und das hat auch so halbwegs geklappt. Der große Durchbruch, glaube ich, der dann ja gekommen ist, wo viele Leute auch schon gehört haben, ist diese Technologie der CRISPR/CAS Systeme und die haben, glaube ich wirklich noch mal eine Lawine losgetreten, weil sie einfach so effizient und leicht zu programmieren sind. Das ist im Prinzip also diese Enzyme kann man sich vorstellen wie eine molekulare Schere. Die kriegen praktisch einen Postal-Code, also die kriegen Zip-Code sozusagen, also eine Postleitzahl, damit sie wissen, wo sie hingehen oder wo sie hin sollen. Die finden dann diese Sequenz im Genom und können dann an einer ganz genauen Position dann diese DNA in unseren Zellen schneiden. Und das ist halt was, was im Prinzip die Funktionsweise von diesen Enzymen ist und dadurch sind sie sehr, sehr nützlich.
Konstantin Willkommen: Man kann diese CRISPR/CAS Schere nehmen und findet dann auf Seite 300.074 dritte Absatz unten links. Kann diese Schere wirklich so präzise einschneiden?
Professor Buchholz: So ist es. Ja, genau.
Konstantin Willkommen: Wenn man das so hört, klingt das wahnsinnig toll. Alle Probleme gelöst, oder? Wie geht es weiter?
Professor Buchholz: Ja, Es sind nicht wirklich alle Probleme gelöst. Also wir hatten ja schon gesprochen, dass auch ständig in unserer DNA Schädigungen auftreten, auch sogenannte Doppelstrangbrüche im Prinzip. Und die müssen natürlich dann repariert werden. Und das macht CRISPR/CAS selber zum Beispiel nicht. Also wenn man jetzt so eine Schere programmiert hat, dass sie genau an der Stelle schneiden soll, dann macht sie das auch. Aber die Zelle muss das natürlich reparieren. Irgendwie. Und die Zelle hat verschiedene Mechanismen, das zu reparieren. Die sind aber ziemlich ungenau. Das heißt, da entstehen dann häufig kleine Veränderungen, genau da, wo der Schnitt gewesen ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass das nützlich ist, aber dadurch, dass man es nicht genau vorhersagen kann, kann es auch sein, dass das vielleicht Nebenwirkungen hat, die ungewollt sind. Und von daher ist vielleicht diese molekulare Schere noch nicht unbedingt so das Ultima ratio in den Genwerkzeugen, die wir haben wollen. Es gibt aber andere Enzyme und andere Werkzeuge, die entwickelt worden sind, zum Beispiel sogenannte Base Editoren. Die schneiden dann die DNA nicht mehr, sondern die verändern genau an einer Position die Base. Oder eine Technologie, an der wir arbeiten, das sind sogenannte Designer-Rekombinasen. Die brauchen im Prinzip die zelluläre Reparatur nicht und können an der Stelle genau die DNA so verändern, dass es, wie man es vorhersagen kann. Also die rekombinieren sozusagen, also die, die verändern die DNA, binden daran und machen den Austausch von DNA Strängen in einer ganz präzisen Art und Weise. Und auch diese Werkzeuge sind, glaube ich insbesondere gut einsetzbar für Therapien. Ich glaube, dass diese Schere selber ist sehr nützlich, zum Beispiel in der Pflanzenzucht oder sowas in der grünen Biotechnologie. Da kann man dann hinterher auswählen. Bei menschlichen Therapien ist es natürlich so, dass wir den einen Menschen nur haben, wenn da dann irgendwas falsch gelaufen ist, dann ist es für dieses Individuum nicht so gut. Von daher müssen da einfach diese Werkzeuge noch sehr viel präziser sein.
Konstantin Willkommen: Daran stellt sich natürlich dann trotzdem auch angeschlossen die Frage Wir finden Werkzeuge, was ändern wir dann damit?
Professor Buchholz: Ja. Gehen wir mal wieder zurück zu einer monogenen Erkrankung. Sagen wir mal, da ist ein Buchstabe ist falsch und der löst diese Krankheit aus. Dann können wir mit diesen Werkzeugen hingehen und die so programmieren, dass sie diesen Fehler ganz genau wieder zurück reparieren. Und das funktioniert tatsächlich. Und da laufen auch erste klinische Studien, jetzt wo genau das probiert wird. Sichelzellanämie ist so ein Beispiel. Ne schreckliche Krankheit gibt keine wirkliche Therapie. Im Moment ist eine Mutation in einem Gen, was dann dazu führt, dass die roten Blutkörperchen so eine andere Form annehmen und dadurch praktisch kleine Äderchen verstopfen können. Und für diese Mutation gibt es tatsächlich jetzt schon in Richtung von CRISPR eine Möglichkeit, diese Mutation ganz genau in den hämatopoetischen Zellen in den Blutzellen zu verändern, so dass es korrigiert wird. Und die Ergebnisse, die man bis jetzt da kennt, das sind natürlich klinische Studien, sehen aber sehr, sehr vielversprechend aus, dass das wirklich zu einer Heilung führen kann. Und das ist für solche Patienten natürlich ein Segen.
Konstantin Willkommen: Das ist eine Möglichkeit an Dingen, die wir ändern. Wie wäre es dann aber auch damit, dass ich vielleicht eine andere Augenfarbe haben möchte oder größer sein möchte? Also die Frage an Sie, Professor Lob-Hüdepohl Diskutieren wir auch schon darüber, was wir alles ändern wollen? Oder sind wir noch nicht an diesem Punkt.
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, natürlich. Also, wobei ich das jetzt so verstanden habe, dass es eine somatische Gentherapie ist. Und da gelten die ganzen Regeln wie was weiß ich bei pharmakologischen Produkten und dergleichen. Sie müssen ausreichend sicher sein. Ja, sie dürfen eben halt ein erträgliches Maß an Off Target Effekten nicht überschreiten. Man hat immer auch Nebenwirkungen und dergleichen. Und wenn das sichergestellt ist, dann ist das also eine vorzügliche Form, hier die Gentherapie vorzunehmen. Eine andere Frage ist, ob ich jetzt gezielt die Keimbahn eines zukünftigen Lebens verändere hinsichtlich nicht nur der Ausscheidung eines Risikofaktors zur Erkrankung Mukoviszidose und dergleichen, sondern wenn ich etwas verbessern will, also Enhancement, das ist das Stichwort. Und da stellt sich grundsätzlich die Frage Ist das sinnvoll, dass wir ganz gezielt vorausgesetzt, wir könnten das überhaupt? Da ist ja, glaube ich, noch extrem viel Zukunftsmusik und Visionen, die man, glaube ich, vielleicht nie erreichen kann. Aber selbst wenn man sie könnte, wollen wir beispielsweise, dass jemand nur mit blauen Augen oder auf gar keinen Fall wie ich früher mit roten gelockten Haaren, weil man rot gelockte Haare furchtbar findet und dergleichen. Ich benutze bewusst dieses Beispiel und dann kommen wir tatsächlich zu etwas wie ein Designerbaby. Und vor allen Dingen es ist ja nicht derjenige Mensch, der in Zukunft damit lebt, der entscheidet, sondern es sind diejenigen, die Eltern beispielsweise bzw. die eine Keimbahnintervention führen. Und sie haben eine Vorstellung von einem gelingenden Leben, das aus ihrer Perspektive günstig ist. Aber wir wissen überhaupt gar nicht, ob das auch der zukünftig lebende Mensch so will. Also keine rote Haare haben zu müssen oder hervorragend Klavier zu spielen, aber nicht Flöte spielen zu dürfen. Ich überspitze das jetzt mal und da würde ich sagen, das darf auf gar keinen Fall sein. Und zwar grundsätzlich nicht. Selbst wenn wir es könnten, dürfte es nicht sein. Und zwar, weil es ein - Da mache ich gleich weiter.
Konstantin Willkommen: (...) Sie dürfen den Punkt gerne noch zu Ende bringen.
Professor Lob-Hüdepohl: Gerne, aber ich lasse mich gerne unterbrechen von dieser schönen Musik. Ja, weil es, wie das Jürgen Habermas mal formuliert hat, unser gattungsethisches Selbstverständnis zerstört. Dass wir nämlich nicht einander wechselseitig in unserer grundlegenden Disposition machen, also gestalten. Denn das würde eine Schieflage bringen zwischen denen, die Gestalten und denen, die gemacht worden sind nach diesen Plänen und so was nicht. Und dann würden wir uns nicht mehr als wirklich Gleiche auch respektieren und anerkennen können mit unseren Chancen und auch mit unseren Fehlern. Sondern wenn ich dann also eine schlechte Ausstattung hätte, als Kind würde ich dann meine Eltern verantwortlich machen. Wie konntet ihr nur zulassen, dass ich so wurde und nicht anders? Und das trägt wirklich, das zerstört eine humane Form des Zusammenlebens. Und das wäre hochgefährlich.
Professor Buchholz: Wobei bei der Reproduktionstechnologie natürlich heute auch schon viele Sachen einsetzbar sind, wo genau das auch passiert. Nicht in Deutschland unbedingt, aber in anderen Ländern ist es durchaus machbar, dass man natürlich dann Embryonen auswählen kann, die ein bestimmtes Krankheitsgen oder vielleicht sogar auch ein Geschlecht oder so, dass dann nicht haben. Da muss man leider sagen, nicht bei uns, aber in anderen Ländern gibt es das.
Professor Lob-Hüdepohl: Ja aber ich mache mich auch nicht zum Anwalt der Regelung in anderen Ländern. Also dass in der Tat haben Sie das in dem gesamten Horizont diskutiert. Das hat etwas Grundsätzliches mit einer Fortpflanzungsmedizin zu tun. Und da ist das deutsche Embryonenschutzgesetz noch vor, dass es genau hier verbietet, eine geschlechtsspezifische beispielsweise Selektion vorzunehmen und dergleichen. Aber Sie haben völlig recht Meine Skrupel beziehen sich keinesfalls nur auf die Frage von Keimbahnintervention, sondern beziehen sich insbesondere aber auf alle Formen von reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, die genau dieses zum Ziel haben, nämlich mir genau zu überlegen ‚Will ich jetzt einen Jungen habe und Mädchen haben und dergleichen.‘ Momentan sind Mädchen aktuell, habe ich gelesen, also werden ja übermorgen vielleicht Jungs wieder nicht, aber dann merken sie das. Das finde ich sozusagen ihren Folgewirkung verheerend.
Konstantin Willkommen: Die bisherigen Beispiele waren ja auf Phänotypebene, also diese Ausprägung einer Krankheit oder nicht? Professor Strobel, gibt es da auch Ideen, wie Sie zukünftiges Verhalten manipulieren könnten?
Professor Strobel: Also da sehe ich den Zeithorizont doch deutlich weiter, weil ich ja schon sagte, es sind ja immer sehr, sehr viele Variationen beteiligt und man kennt ja noch nicht mal durch genomweite Assoziationsstudien kann man mittlerweile annähernd in den Bereich der Prozentzahlen an aufgeklärter Varianz kommen, die eigentlich durch genetische Faktoren beim Zustandekommen von Verhaltensunterschieden beitragen sollte. Aber da greift dann aber auch wieder das, was ich vorhin schon sagte. Das, was uns interessiert, sind ja jetzt nicht irgendwelche krankheitsverursachende Mutationen, sondern Dinge, die zum Guten wie zum Schlechten wirken können. Wenn wir das ausschalten, weil wir denken, wir wollen jetzt keine Menschen haben, die depressiv sind, also schneiden wir mal überall die Basenpaare raus oder die Sequenzen, die da irgendwie bisher damit in Verbindung gebracht wurden. Dann beschneiden wir uns ja total und senken unsere Fitness insgesamt gegenüber veränderlichen Bedingungen, die dann vielleicht in der Welt irgendwann künftig mal auftreten oder nicht in der Welt, sondern wenn wir irgendwann mal doch dereinst zu den Sternen aufbrechen und dort ganz, ganz andere Bedingungen wieder vorfinden. Also wir sollten da die Variationen so breit wie möglich halten, auch wenn das vielleicht für das einzelne Individuum hier und da mal dazu beitragen kann, dass es eben nicht so gut geht. Aber es sind ja andere Dinge, als wenn wir wirklich von Krankheiten sprechen, sondern es geht ja eben darum, wo man auch durch Psychotherapie, durch Prävention sehr viel machen kann und jetzt nicht verdammt ist dazu dann halt eben irgendwie in den Suizid zu laufen, nur weil man irgendwo hier und da mal ein paar unglückliche Variationen aufgeschnappt hat. Das ist einfach nicht unausweichlich, sondern nur mit beeinflusst und viel stärker, wenn es um Verhaltensänderungen geht. Greifen wir dann in der Psychologie, an der Umwelt an? Durch Prävention, durch Aufklärung, durch Psychotherapie, durch was weiß ich alle möglichen auch selbst. Ja, man kann es jetzt abschätzig Selbstoptimierung nennen. Aber vieles von dem, was Menschen halt so tun, tun sie nicht einfach damit sie, damit sie nach außen hin besser dastehen, sondern damit es ihnen besser geht. Einfach persönlich. Yoga macht man nicht, weil es schick ist, sondern weil es einfach gut tut.
Konstantin Willkommen: Aber Sie eröffnen da eine sehr spannende Perspektive, mit dem Argument zu sagen Wir wollen da noch nicht zu viel manipulieren, weil wir uns die Breite, die Varianz eigentlich offenhalten wollen. Herr Professor Buchholz, wie wird das denn in, ich sage jetzt mal in Ihrer Sparte diskutiert diese Ansicht.
Professor Buchholz: Also ich glaube, das sind wir gar nicht auseinander. Also ich denke, dass die Varianz natürlich immer in der Population eine ganz wichtige Rolle spielt und dass ein Genpool ist. Wenn wir alle gleich wären, alle optimiert, dann würde es ja keinen Unterschied mehr geben. Das will ja niemand, das ist ganz klar. Deshalb glaube ich, das ist eine gesellschaftliche Frage auch wo will man da die Grenzen im Prinzip genau setzen? Also das muss breit gesellschaftlich diskutiert werden und es muss im Prinzip dann die Politik muss dann die Rahmenbedingungen dafür setzen und das muss erlauben, dass man möglichst frei forschen kann, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite muss die Gesellschaft davor geschützt werden, dass damit irgendwie Schindluder getrieben wird. Und deshalb müssen die Rahmenbedingungen da ganz klar gesetzt werden. Das ist meine Meinung dazu.
Konstantin Willkommen: Wie werden denn die Rahmenbedingungen gesetzt? Also wer diskutiert das und wo?
Professor Buchholz: Wir haben ja jemanden aus dem Ethikrat. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Gremium. Da werden ja auch Politiker, ich weiß auch häufig beraten dazu, wie Gesetze gemacht werden sollen usw. Also das ist sicherlich eines der ganz wichtigen Gremien, die wir haben.
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, also das ist eins, aber von vielen anderen. Wir haben die Nationale Akademie Leopoldina, die beispielsweise vier Fachgruppen haben. Dann gibt es diese Diskussionen, die dummerweise vielleicht eher wissenschaftsimmanent ist, nämlich die entsprechenden Ausschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die über diese Fragen gehen. Und dann gibt es nahezu alle Fachgesellschaften, die sogenannte forschungsethische Standards etabliert. Ich stimme Ihnen zu, die Forschungsfreiheit ist ein extrem hohes Gut, grundgesetzlich geschützt innerhalb natürlich der Bedingungen, die das Grundgesetz selber wieder setzt. Und das sind natürlich auch Fragen der Menschenwürde, des Menschenwürdeschutz. Also ich sagte ja eben, wir arbeiten mit Menschen an Menschen. In diesem Fall, also wenn wir die rote Gentechnologie hier haben, dann muss es den gewöhnlichen Standards natürlich genügen. Was ich wichtig finde, ist es auch. Das haben Sie noch mal stark gemacht. Eine breite öffentliche Debatte. Wir reden im Deutschen Ethikrat immer davon, dass wir zwar vielleicht eine gewisse Expertise haben, aber wir möchten im engen Sinne des Wortes auch eine Politisierung dieser Fragen. Also Politisierung heißt jetzt nicht Parteipolitik, sondern in den öffentlichen Raum hinein Impulse geben, mit der Öffentlichkeit diskutieren, das wieder rückübersetzen und dann in Richtung Politik. Und auch das ist wichtig Nicht Expertengremien dürfen hier eine Entscheidung treffen. Die müssen beraten, aber sie dürfen niemals entscheiden. Der Souverän über diese Fragen zu entscheiden, über Gesetze zu beschließen, sind nicht Expertengremien, sondern in diesem Fall der Deutsche Bundestag. Der hat ein Mandat von der Bevölkerung durch Wahlen und nicht irgendwelche Expertengremien. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die unterschiedlichen Rollen hier auseinanderzuhalten, durchaus die Bedingungsgefüge im Blick zu nehmen, das ist ganz wichtig, aber auch genau sagen. Der Deutsche Ethikrat beispielsweise kann Empfehlungen formulieren, aber ob sie triftig sind, ob sie überzeugend sind und ob sie auch in die Politik umgesetzt werden müssen, das muss ein Parlament entscheiden und nicht ein Ethikrat.
Konstantin Willkommen: Professor Buchholz, wie empfinden Sie den bisherigen Diskussionsstand von der Öffentlichkeit, der bei Ihnen ankommt? Hilft Ihnen das bei Ihren Entscheidungen?
Professor Buchholz: Relativ wenig, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, was wirklich breit in der Öffentlichkeit angekommen ist. Das ist vielleicht auch nicht verwunderlich, aber ich glaube, man muss nicht wirklich ein Hellseher sein, um zu verstehen, was diese Technologien bedeuten könnten. Also zum Guten, aber auch zum Schlechten. Ich glaube nicht, dass es breit öffentlich erkannt worden ist, was es bedeutet. In der Medizin zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wenn man die rosarote Brille aufsetzt, sagen könnte, dass viele, viele, viele Erkrankungen damit wirklich heilbar sind. Die meisten Krankheiten, die wir heute haben, werden ja therapiert mit irgendwelchen Medikamenten. Die gehen aber nicht an die Ursache heran. Gerade wenn es irgendwie genetisch bedingt ist, sondern die lindern dann im Prinzip nur die Sachen. Hier ist tatsächlich ein Instrument potenziell, weil es wirklich mal eine Heilung geben könnte. Und ich glaube nicht, dass das wirklich klar angekommen ist. Auf der anderen Seite ist es glaube ich, auch nicht klar angekommen, was vielleicht mal damit möglich sein könnte.
Konstantin Willkommen: (...) Also müssen wir schlussendlich sagen mehr Diskussion, mehr öffentliche Diskussion, mehr Fragen, um dann bessere Antworten finden zu können in Zukunft. Und ich hoffe, dass wir mit dem heutigen oder…
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, wenn ich vielleicht noch. Wir haben im deutschen Ethikrat diese lange Stellungnahme gemacht, aber vor allen Dingen haben wir Entscheidungsbäume etabliert, wo man sehr gut die unterschiedlichen Pro und Kontra Argumente nachvollziehen kann. Mittlerweile ist dieser Entscheidungsbaum sogar in einem Schulbuchverlag gelandet, das heißt, es wird sozusagen für die Auseinandersetzung in Schulen oder auch an Hochschulen umgesetzt. Und das finde ich ausgesprochen wichtig. Davon müsste es viel mehr geben, um genau diese sogenannten öffentlichen Diskurs-Projekte auch zu unterstützen. Das ist ein ganz entscheidender Beitrag auch von dem, was Sie ja machen, beispielsweise durch Ihren Podcast. Also das ist Transfer in die öffentliche Diskussion und davon kann es nicht genug geben.
Konstantin Willkommen: Und ich finde es sehr schön, dass wir heute dazu auch einen Beitrag leisten konnten. Vielen Dank an Sie drei für Ihre Antworten. Vielen Dank an unser Publikum. Vielen Dank für die Musik. Vielen Dank an unsere Gastgeber, das Deutsche Hygienemuseum für diesen Ort. Und ich möchte gerne schließen, indem ich nun Ihnen dreien, die bisher hier Antwort gestanden oder gesessen haben, auch die Chance geben, vielleicht noch eine Frage in den öffentlichen Diskurs zu werfen zu diesem Thema.
Professor Strobel: Also ich habe jetzt keine Frage für den öffentlichen Diskurs, sondern ich frage mich, wann wir tatsächlich zumindest in der Psychologie, wo wir ja, wie ich vorhin schon sagte, noch sehr im Dunkeln tappen, wann wir denn tatsächlich dann mal mehr darüber gelernt haben werden, wie es denn zu dieser erheblichen genetischen Varianz an der Gesamtvarianz im Verhalten und Erleben kommt, was da jetzt wirklich passiert. Denn der Weg, den wir bisher beschritten haben, scheint offenbar in die Irre zu führen und ich hoffe sehr, dass ich das mal noch miterleben werde, da ein kleines bisschen mehr Aufschluss darüber zu erlangen.
Konstantin Willkommen: Vielen Dank.
Professor Lob-Hüdepohl: Ja, meine Frage Wollen wir wirklich, wenn Wir könnten einen perfekten Menschen haben?
Professor Buchholz: Ja. Meine Frage wäre ist, wie lange dauert es, bis wir viele Erbkrankheiten heilbar machen können? Wie viel Zeit wird dafür gebraucht werden?
Konstantin Willkommen: Vielen Dank. Diese drei Fragen dürfen nun gerne alle, die uns heute oder auch in Zukunft zuhören, mit nach Hause nehmen und sich damit weiter beschäftigen. Und wenn Sie vielleicht dann eine Antwort gefunden haben, melden Sie sich einfach bei uns bei unserem Podcast. YOU ASK we explain Bis zum nächsten Mal. Und bei Fragen einfach fragen. Dankeschön.
Give us your feedback - simply, quickly and anonymously.
Here are a few impressions of our event.

Musikalische Unterstützung durch Jo Aldinger © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

v.l.n.r. Referent: Alexander Strobel, Referent: Andreas Lob-Hüdepohl, Referent: Frank Buchholz, Moderator: Konstantin Willkommen © André Wirsig

© André Wirsig

v.l.n.r. Referent: Alexander Strobel, Referent: Andreas Lob-Hüdepohl, Referent: Frank Buchholz, Moderator: Konstantin Willkommen © André Wirsig

Referent: Frank Buchholz © André Wirsig

Referent: Frank Buchholz © André Wirsig
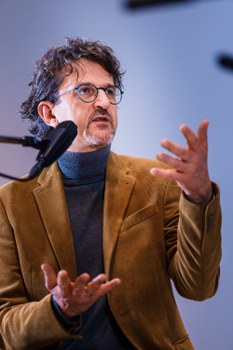
Referent Alexander Strobel © André Wirsig

Referent Frank Buchholz und Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Referent Frank Buchholz und Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

Referent: Frank Buchholz © André Wirsig

Referent Alexander Strobel © André Wirsig

Musikalische Unterstützung durch Jo Aldinger © André Wirsig

Referent Alexander Strobel © André Wirsig

Referent Alexander Strobel und Andreas Lob-Hüdepohl © André Wirsig

© André Wirsig

Referent Andreas Lob-Hüdepohl © André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

© André Wirsig

Referent Andreas Lob-Hüdepohl und Frank Buchholz © André Wirsig

Referent Andreas Lob-Hüdepohl, Frank Buchholz und Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig

v.l.n.r. Referent: Alexander Strobel, Referent: Andreas Lob-Hüdepohl, Referent: Frank Buchholz, Moderator: Konstantin Willkommen © André Wirsig

Moderator Konstantin Willkommen © André Wirsig
Our Advisors:
- Prof. Dr. Frank Buchholz - Professor for the Department of Medical Systems Biology at the Carl Gustav Carus Faculty of Medicine at TU Dresden and Head of Translational Research at the University Cancer Center Dresden
- Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl - Member of the German Ethics Council, Managing Director of the Berlin Institute for Christian Ethics and Politics and Professor of Theological Ethics at the Catholic University of Applied Sciences Berlin
- Prof. Dr. Alexander Strobel - Chair of Differential and Personality Psychology at TU Dresden with core research areas in neurogenetics of individual differences in temperament and emotion, cognition and motivation and social behavior
Moderator
© TUD
Konstantin Willkommen - Graduate of the Carl Gustav Carus Faculty of Medicine
Musical accompaniment:
- Jo Aldinger jochenaldinger.de
- and Patrick Neumann www.patrickneumann.net
This project is funded by the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF) and the Free State of Saxony as part of the Excellence Strategy of the
Federal and State governments.


























