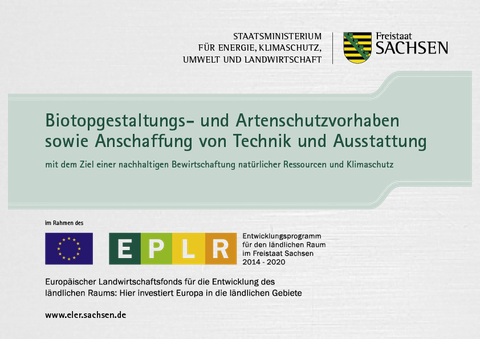Artenschutzprojekt zur Sicherung und zum Erhalt heimischer Pflanzenarten Sachsens
Table of contents
Das Projekt
Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie fördert ein Artenschutzprojekt im Botanischen Garten der TU Dresden nach der Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014 im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2014-2020 (EPLR).
Im Projektzeitraum von Juli 2019 bis Februar 2024 wurden im Botanischen Garten Erhaltungs- und Vermehrungskulturen von 17 ausgewählten seltenen sächsischen Wildpflanzenarten eingerichtet. Mit Nachzuchten aus diesen Kulturen sollen die wenigen noch vorhandenen Vorkommen der Arten gestärkt sowie geeignete neue Standorte besiedelt werden.
Die Pflanzenarten
Ackerwildkräuter

Erhaltungskultur des Sommer-Adonisröschen im Botanischen Garten Dresden
Zu den Pflanzenarten, deren sächsische Vorkommen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sind, gehören einige Ackerwildkräuter, sogenannte Segetal-Arten. Zwei davon wurden in das Projekt aufgenommen: das Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis L.) und die Breitblättrige Wolfsmilch (Euphorbia platyphyllos L.). Die Intensivierung der Landwirtschaft hat die beiden einjährig wachsenden Arten in Sachsen auf wenige Standorte zurückgedrängt.
Die Erhaltungskultur des Sommer-Adonisröschens im Botanischen Garten befindet sich noch im Aufbau. Über die gesamte Projektlaufzeit zeigten die an den Reliktstandorten geernteten Samen sehr geringe Keimungsquoten. Jährlich wuchsen deshalb nur einzelne Exemplare zur Fruchtreife heran. Es ist damit zu rechnen, dass weitere ausgesäte Samen in den Folgejahren keimen und die Erhaltungskultur genetisch stabilisieren werden. Erst dann kann Samen daraus gewonnen und wieder auf geeigneten Äckern ausgebracht werden.
Die Breitblättrige Wolfsmilch hat sich hingegen gut in unserer Erhaltungskultur etablieren können. Mit den im Botanischen Garten geernteten Samen wurden kleine Populationen auf ökologisch bewirtschafteten Äckern in Dresden und bei Brand-Erbisdorf initiiert, die in den kommenden Jahren mit weiteren Nachsaaten unterstützt werden.
Arten der Magerrasengesellschaften

Erhaltungskultur des Kahlen Ferkelkrauts im Botanischen Garten
Ähnlich selten sind viele konkurrenzschwache Arten, die auf Magerrasen wachsen. Für das Projekt wurden aus dieser Gruppe der Langgestielte Mannsschild (Androsace elongata L.), das Kahle Ferkelkraut (Hypochaeris glabra L.), der Zwerg-Schneckenklee (Medicago minima (L.) Bartal.) und der Steppen-Sesel (Seseli annuum L.) ausgewählt. Von ihnen sind in Sachsen nur noch jeweils ein oder zwei Standorte bekannt, vom Kahlen Ferkelkraut gar keiner mehr.
Letzteres Beispiel unterstreicht die Bedeutung von Erhaltungskulturen: Projektmitarbeiter greifen beim Kahlen Ferkelkraut auf Material aus der Oberlausitz zurück, das vor dem Verlust der letzten Wildpflanzen gesammelt und seit 1996 im Botanischen Garten kultiviert wird. Wenn sich an geeigneter Stelle mit Hilfe des im Garten gewonnenen Saatguts neue und stabile Wildpopulationen etablieren lassen, kann es gelingen, das endgültige Aussterben der einjährigen Art in Sachsen abzuwenden. Im Rahmen des Projekts wurde Saatgut an mehreren Stellen in der Kleinraschützer Heide bei Großenhain und im Naturschutzgroßprojekt "Lausitzer Seenland" ausgebracht.
Ebenfalls sehr produktiv ist die Erhaltungskultur des Langgestielten Mannsschilds. Von dieser einjährigen Art wurde Saatgut in der Kleinraschützer Heide ausgebracht.
Auch der konkurrenzschwache Zwerg-Schneckenklee ist in Kultur erfreulich unkompliziert. Im Projekt erfolgen Aussaaten auf der Bosel nahe Meißen und am Elbhang bei Meißen-Rottewitz, um die Art dort wieder anzusiedeln.
Die gut etablierte Erhaltungskultur des kurzlebigen Steppen-Sesels erbrachte Jungpflanzen und Saatgut zur Initiierung neuer Vorkommen bei Schönau-Berzdorf auf dem Eigen nahe der polnischen Grenze. Weitere Aussaaten in den nächsten Jahren sollen die Zahl der Pflanzen vergrößern und stabilisierend wirken.
Waldarten

Pracht-Nelke vor der Ausbringung
Auch an warmen, trockenen bis wechselfeuchten Standorten in Wäldern und Waldsteppen kommen einige in Sachsen inzwischen sehr seltene Pflanzenarten vor, wie z. B. die Pracht-Nelke (Dianthus superbus L.), das Immenblatt (Melittis melissophyllum L.), die Filz-Segge (Carex tomentosa L.) und die Erbsen-Wicke (Vicia pisiformis L.). Die Gründe für ihr Verschwinden hängen oft mit einer Aufgabe der traditionellen Flächennutzung an den Ausgangsstandorten zusammen, wodurch sich die Konkurrenzverhältnisse an den Standorten zuungunsten der seltenen Arten verschieben. Ausweichflächen, die noch geeignete Bedingungen bieten, können ihnen neuen geeigneten Lebensraum bieten.
Unsere Erhaltungskulturen von Immenblatt und Filz-Segge haben im Projektzeitraum leider noch nicht genügend Nachwuchs erzeugt, um Ausbringungen in Angriff zu nehmen.
Von der an lichte Eichenwälder angepassten Form der Pracht-Nelke wurden mehrere Standorte entlang der Freiberger Mulde mit im Botanischen Garten angezogenen Jungpflanzen bestückt, die teilweise inzwischen zur Blüte und Frucht gelangt sind.
Das gefährdete Restvorkommen der Erbsen-Wicke bei Tharandt wurde durch Auspflanzung einer größeren Zahl von Jungpflanzen aus der Erhaltungskultur stabilisiert. Diese befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wildstandort, sind im Gegensatz du diesem aber keinen negativen menschlichen EInflüssen ausgesetzt.
Uferbegleitende Arten

Sächsisches Reitgras am Wildstandort
An Flussufern wachsen das Liegende Büchsenkraut [Lindernia procumbens (Krock.) Borbás], das Fluss-Greiskraut (Senecio sarracenicus L.), das geschützte Gottes-Gnadenkraut (Gratiola officinalis L.) und das Sächsische Reitgras (Calamagrostis rivalis H. Scholz).
Das zuletzt Genannte kommt nur in Sachsen vor und ist daher als Rarität besonders schützenswert. Von ihm wurde im Botanischen Garten eine Erhaltungskultur aufgebaut, die mehrere Fundstellen entlang der Zschopau repräsentiert. Bei Bedarf, z. B. bei Verlusten durch extreme Hochwasser, lassen sich damit die natürlichen Bestände stützen.
Das Liegende Büchsenkraut wurde 1989 erstmals in Sachsen nachgewiesen. Die Art keimt auf periodisch überschwemmten Schlammböden an der Elbe, sobald diese bei warmem Wetter trockenfallen. Bevor das Wasser wieder von den Flächen Besitz ergreift, müssen die Pflanzen in kurzer Zeit ihre komplette Entwicklung bis zur Samenreife durchlaufen. Im Rahmen des Projekts ist es gelungen, eine stabile Erhaltungskultur der Art zu etablieren.
Das Fluss-Greiskraut und das Gottes-Gnadenkraut, zwei uferbegleitende Stauden, haben den Großteil ihrer Vorkommen an der Elbe durch Standortveränderungen der ursprünglichen Uferbereiche verloren. Alle vier Arten werden jetzt im Botanischen Garten gezielt vermehrt und anschließend wieder auf Flächen ausgebracht, die ihnen geeignete Lebensbedingungen bieten. Beide Arten werden jetzt im Botanischen Garten gezielt vermehrt und konnten Im Rahmen des Projekts wieder auf Flächen ausgebracht werden, die ihnen geeignete Lebensbedingungen bieten.
Gesetzlich geschützte Arten

Blühende Jungpflanze des Gottesgnadenkrauts in der Erhaltungskultur im Botanischen Garten
Zu den nach der Bundesartenschutzverordnung gesetzlich geschützten Arten im Projekt zählen neben dem Gottes-Gnadenkraut auch der Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe L.), die Trollblume (Trollius europaeus L.) und das Froschkraut [Luronium natans (L.) Raf.]. Alle diese Arten entwickeln sich in der Erhaltungskultur im Botanischen Garten gut. Während sich die Ausbringung von Lungen-Enzian am natürlichen Standort wie auch an einem alternativen Ersatzstandort als schwierig erweist, wurden von Trollblume und Froschkraut vielversprechende Ausbringungsaktionen durchgeführt. Wenn sich deren bisherige positive Entwicklung fortsetzt, können wir uns über mehrere neue Vorkommen des Froschkrauts in Teichen des Landkreises Meißen und der Trollblume auf feuchten Bergwiesen im Landkreis Mittelsachsen freuen. Die enge Kooperation mit den Naturschutzbehörden und Grundstückseignern wird über das Projektende hinaus fortgesetzt: Bei Bedarf steht auch in Zukunft Material aus den Erhaltungsulturen im Botanischen Garten zur Verstetigung positiver Entwicklungen an den Ausbringungsorten zur Verfügung.