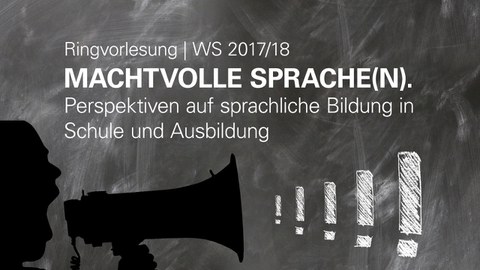Oct 10, 2017; Talk
Ringvorlesung: Machtvolle Sprache(n). Perspektiven auf sprachliche Bildung in Schule und AusbildungDas Primat des Native Speaker und linguizismuskritische Professionalität in der Migrationsgesellschaft
01069 Dresden
ABSTRACT
In der Kolonialzeit wurden nicht nur physiognomische Merkmale wie die sogenannte „Hautfarbe“ herangezogen, um die Unterwerfung von (konstruierten) Gruppen zu legitimieren. Auch sprachliche Unterschiede wurden eingesetzt, um die Über- und Unterlegenheit von verschiedenen Gruppen zu begründen. Linguizismuskritik ist eine spezielle Richtung der Rassismuskritik, deren Ziel es ist, aufzudecken, inwiefern in der heutigen postkolonialen Zeit in kolonialer Denktradition in sozialen Machtbeziehungen mit Verweis auf Sprachen, Dialekte, Soziolekte, „Akzente“ und anderen sprachliche Merkmalen Menschen linguizistisch kategorisiert und an der Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen gehindert werden (können). Im Vortrag werden zunächst zentrale Begriffe und historische Entwicklungen sowie gegenwärtige Verwicklungen in die Geschichte des Linguizismus dargestellt, um dann am Beispiel der Kategorien Native und Native Speaker zu zeigen, wie diese bedeutsam gemacht werden, um Ausgrenzungen in migrationsgesellschaftlichen (Bildungs-)Kontexten zu legitimieren. Damit wird sich auch zeigen, dass es nicht allein darauf ankommt, ein Bewusstsein für die negative Bewertung einiger Sprachen zu schaffen, um das Problem der Diskriminierung zu bekämpfen, sondern, dass „Sprache“ eine FLEXIBLE symbolische Ressource darstellt und dass prinzipiell jegliche Sprache herangezogen werden könnte, um Ausschlüsse zu begründen. Also erscheint es für eine linguizismuskritische Professionalität wichtig, etwas über benachteiligte Gruppen und deren Sprachen zu erfahren, aber auch die Funktionsweise des Rassismus bzw. Linguizismus, um zu verstehen, dass die hegemoniale Gruppe immer neue Merkmale ausfindig machen und diese instrumentalisieren kann, um ihre Macht zu zementieren, so auch jüngst die Kategorie des Native Speaker. Abschließend wird die Frage diskutiert, welches linguizismuskritische Reflexionswissen (zukünftige) Lehrpersonen brauchen, um ihre sprach(en)bezogenen Vorgehensweisen zu gestalten, ohne Schülerinnen und Schüler gegeneinander zu hierarchisieren und symbolische sowie faktische Ausschlüsse zu erzeugen.
Moderation: Prof. Dr. Dorothee Wieser (TU Dresden)