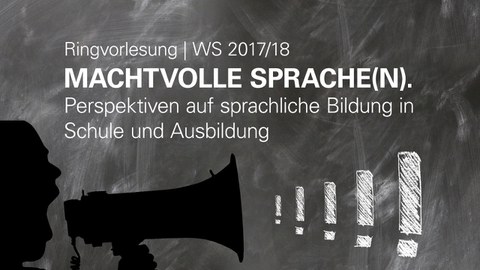Dec 05, 2017; Talk
Ringvorlesung: Machtvolle Sprache(n). Perspektiven auf sprachliche Bildung in Schule und AusbildungPersuasive Macht und aggressive Argumentation aus der Perspektive der Kulturwissenschaftlichen Linguistik
01069 Dresden
ABSTRACT
Der Begriff der Persuasion kann in zweifacher Weise verstanden werden, zum einen im Sinne von Überzeugen, zum anderen als Überreden. Es handelt sich in beiden Fällen um indirekte Interessensrealisierungen eines Proponenten gegenüber den Rezipienten sprachlicher Handlungen, denen direkte sprachliche oder außersprachliche Formen der Durchsetzung von Interessen, etwa durch Befehl oder physische Gewalt gegenüberstehen (Kopperschmidt, Überzeugen – Problemskizze zu den Gesprächschancen zwischen Rhetorik und Argumentationstheorie 1977). Während jedoch Überzeugen auf die aktive Teilnahme des Rezipienten am persuasiven kommunikativen Prozess angewiesen ist, kann Überreden ohne den Willen des Rezipienten geschehen und sich sogar gegen dessen Interessen richten. Im zweiten Fall stellt die Persuasion einen aggressiven Akt gegen ihre Rezipienten dar.
Argumentieren ist der Standardfall der überzeugenden Persuasion, während die überredende aggressive Persuasion leicht als Gegenteil von Argumentieren aufgefasst werden kann. Diese klare Gegenüberstellung wird jedoch der faktisch sehr beweglichen Grenze zwischen Überzeugen und Überreden oder gar Manipulieren und auch dem offenen Übergang von nicht aggressivem zu aggressivem kommunikativen Handeln nicht gerecht. Wird Argumentation nicht nur als rationales, wahrhaftiges Begründen und Rechtfertigen mit dem Ziel des Abbaus von Dissens, sondern als jede Form, Gründe für Behauptungen oder zur Rechtfertigung von Handlungen vorzubringen (Klein, Die konklusiven Sprechhandlungen 1987), verstanden, lassen sich Formen der aggressiven persuasiven Argumentation aufzeigen, die im Alltag ebenso wie in den institutionellen Diskursen der Politik, der Religion, des Rechts, der Wirtschaft oder auch der Wissenschaft verwendet werden.
Aggressive Argumentation in verschiedenen kommunikativen Kontexten zu untersuchen und darzustellen, leistet die Kulturwissenschaftliche Linguistik, deren Gegenstand alle Formen der Sprache-Kultur-Beziehung sind (Kuße, Kulturwissenschaftliche Linguistik 2012). Mit dem besonderen Fokus auf den politischen Diskurs und mit einigen Seitenblicken auf Wissenschaft und Unternehmenskommunikation werden im Vortrag Argumentationen mit aggressiver, das heißt auf die Bemächtigung (und in der Regel Schädigung) anderer zielender Intention vorgestellt. Dazu gehören Formen der Abwertung (bis hin zur ‚Hassrede’) ebenso wie die betrügerische Lobrede (‚Sie sind der Beste für diese Aufgabe’ – um jemand in eine für ihn schlechte Situation zu bringen) und die Rechtfertigung von aggressiven Handlungen (Gewalt) mit moralischen (‚Wir sind es dem Volk schuldig, Volksverräter zu entsorgen’), metaphysischen (‚Die Krim ist unser heiliges Land’) oder auch nur funktionalen Argumenten (‚Um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, geht es leider nicht anders’). Von besonderer Qualität sind totalitäre Sprechhandlungen, die dem Gegenüber keine Möglichkeit zum adäquaten Widerspruch lassen (‚Sie wollen doch auch nur das Beste für ihr Kind’), und diffuse Argumentationen, die die Rezipienten über die Intentionen eines Proponenten im Unklaren lassen (‚Wir werden alles tun, damit unsere Region stabil bleibt’), sie zumindest verwirren oder sogar bewusst in die Irre führen (‚Uniformen kann man doch in jedem Geschäft kaufen’).
Beispiele kommen vor allem aus dem russischen politischen Diskurs der Gegenwart, u. a. in Bezug auf den Ukrainekonflikt.
Moderation: Dr. Michael Dobstadt (TU Dresden)