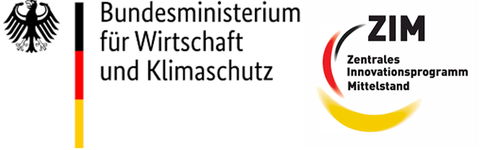abgeschlossene Forschungsprojekte an der Professur für Formgebende Fertigungsverfahren
Erweiterung der Auswertegrenzen zur Ermittlung von Fließkurven im einachsigen Zugversuch über die Gleichmaßdehnung hinaus
Die neue Methode zur Auswertung von Zugversuchen ermöglicht es, die Messdaten bei höheren Umformgraden im Vergleich zur konventionellen Auswertemethode für die Ermittlung von Fließkurven zu nutzen. So lässt sich das Werkstoffverhalten in Form der in die Simulation eingehenden Fließkurve genauer beschreiben, ohne den erhöhten Kosten- und Zeitaufwand komplexer Charakterisierungsmethoden. Durch den hier verfolgten innovativen Auswertungsansatz kann also die Aussagekraft der virtuellen Prozessbeschreibung beispielsweise in FEA deutlich erhöht werden, ohne erheblichen versuchstechnischen Mehraufwand in die Werkstoffcharakterisierung zu investieren. Dies führt konkret zu einer kostengünstigen und schnelleren Prozessauslegung als wichtigste Grundlage für eine ressourceneffiziente Bauteil- und Prozessgestaltung. Darüber hinaus können in erheblichem Maße Kosten bei der Werkzeuggestaltung von Umformprozessen eingespart werden, da sich durch die bessere Abbildungsgenauigkeit Nacharbeit vermeiden und die Einarbeitungsphase verkürzen lässt.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Entwicklung eines deterministischen Prozessmodells zur Ermittlung der Leistungsgrenzen und Schnittparameter für nano-polykristallinn Diamanten als Scheid-/Abrichtwerkstoff – nanoPD
Ziel ist die Entwicklung neuer Ultrapräzisionswerkzeuge mit ultraharten nano-polykristallinen Diamanten als innovativer Schneidwerkstoff. Diese aus Graphit unter Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen ohne Zugabe von Binder oder Sinterhilfsmitteln direktsynthetisierte Form des Diamanten übertreffen durch hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften die herkömmlichen Diamanten deutlich. Darauf aufbauend werden technische und technologische Entwicklungen zur Herstellung von Dreh- und Abrichtwerkzeugen mit dem Ziel getätigt, Ultrapräzisionswerkzeuge mit einer deutlich längeren Standzeit und höherer Schneidkantenschärfe zu realisieren. Mit der Entwicklung zu einem deterministischen Prozessmodell sollen die geeignetsten technologischen Parameter für verschiedene Anwendungen mathematisch und wissenschaftlich fundiert für die neuen Werkzeuge ermittelt werden, um am Ende Werkzeug und Technologie anbieten zu können.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
AeroCut 4.0 - Entwicklung eines intelligenten Analyse- und Optimierungssystems auf Basis eines digitalen Prozess-Zwillings zur Steigerung der Produktivität bei der Fräsbearbeitung komplexer Bauteile aus Hochleistungswerkstoffen für die Luft- und Raumfahrt
Teilprojekt: Applikationen zur Analyse und Optimierung von Zerspanprozessen auf Basis von Zerspanmodellen und eines digitalen Prozess-Zwillings
Ziel ist die Entwicklung eines intelligenten Analyse- und Optimierungssystems, dass die Vorgabe von realitätsnahen Fertigungsparametern erlaubt. Kern des neuen Systems sind digitale Prozess-Zwillinge, die für jedes real gefertigte Bauteil erzeugt werden und damit die jeweiligen bauteilindividuellen Fertigungsprozesse möglichst gut abbilden sollen. Dieses digitale Abbild beruht auf Prozessdaten, die aus dem spanenden Bearbeitungsprozess resultieren und in Verbindung mit Planungsdaten zur Prognose für verbesserte Fräsbearbeitungsprozesse zu LuR-Bauteilen aus Hochleistungswerkstoffen eingesetzt werden.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
BNNCut - "Entwicklung innovativer Zerspanungswerkzeuge aus nanokristallinem, binderfreien Bornitrid ("Bornitrd Nanocomposite" - BNNC) zur Verbesserung der Oberflächenqualität und Erweiterung der Verfahrensgrenzen
Teilprojekt: Technologische Untersuchung zur Ermittlung der Leistungsgrenzen und Schnittparameter von Werkzeugen mit BNNC als Schneidwerkstoff
Entwicklung eines Werkzeugsystems bestehend aus BNNC-Blank und Werkzeughalter für das Längs-Runddrehen und das Quer-Plandrehen. Für den BNNC-Schneidwerkstoff ist eine Schnittdatenempfehlung mit daraus abgeleiteten Standzeit- und Qualitätsangaben für unterschiedliche Werkstoffe zu erarbeiten. Ziel ist die Integration eines neuen Schneidwerkstoffes vom Halbzeug bis zum Produkt für verschiedene Drehverfahren zur Präzisionsbearbeitung.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
KennSpan - "Entwicklung einer Software zur intelligenten Zerspanungskennwertermittlung als Grundlage für Planungs- und Simulationssysteme zur Erschließung von Leistungsreserven"
Teilprojekt: Entwicklung eines intelligenten Verfahrens zur Ermittlung von Zerspanungskennwerten
Kraftmodellbasierte Planungs- und Simulationssysteme können ihr Leistungsvermögen aufgrund fehlender Kennwerte häufig nicht voll ausschöpfen. Die hierfür erforderlichen Kennwerte stehen als Datenbasis nicht zur Verfügung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Entwicklung eines Verfahrens zur möglichst schnellen und flexibel anpassungsfähigen Kennwertermittlung zur Versorgung der vorhandenen Planungs- und Simulationssysteme.
Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer automatisierten Ermittlung von Kennwerten für Zerspanungsprozesse unter Einbeziehung eines intelligenten Verfahrens. Die „Intelligenz“ wird über die Methode maschinelles Lernen mit Künstlichen Neuronalen Netzen erreicht. Die Entwicklung soll als Softwareprodukt KennSpan umgesetzt, getestet und validiert werden.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
modAK - Entwicklung und Einsatz neuartiger Werkzeugkonzepte zur Produktivitätssteigerung der robusten Schwerzerspanung unter Berücksichtigung der Rohteilgeometrie und deren Auswirkungen
Teilprojekt: Erarbeitung der theoretischen Grundlagen und experimentelle Unterstützung bei der Umsetzung einer sensorgestützen Aufspannlagenkorrektur und neuartiger Werkzeugkonzepte für die Drehbearbeitung
Zielstellung des Projektes ist die Produktivitätssteigerung der Schwerzerspanung in der GWS GmbH im Bereich der Drehbearbeitung. Mit diesem Bearbeitungsschritt wird bei Guss- und Schmiedeteilen eine erste spanende Bearbeitung zur Erzielung einer für Folgeschritte geeigneten Werkstückgeometrie realisiert. Zur Verbesserung der problematischen Zerspanung ist der Einsatz neuartiger Unterstützungswerkzeuge und Werkzeugkonzepte erforderlich. Zuerst wird eine Aufspannlagenkorrektur mit sensorgestützter Rohteilerfassung zur Unwuchtreduzierung erarbeitet und umgesetzt. Einen weiteren Aspekt stellen modular aufgebaute aktorische Werkzeuge dar. Das entstehende mehrschneidige Gesamtwerkzeug integriert im Schnitt gesteuert verstellbare Zustellachsen. Durch eine automatisierte Erfassung der Unrundheit des Rohteiles soll eine angepasste Schnitttiefeneinstellung erreicht werden. Als dritter Ansatz werden im Projekt aktiv schwingungsgedämpfte Drehwerkzeuge für die Schwerzerspanung entwickelt. Firma GWS GmbH überführt die Ergebnisse in die Fertigung und entwickelt diese weiter. Diese Ansätze sollen die Zerspanung um mindestens 10 Prozent effektivieren.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
ProViLK- Prozesskettenvirtualisierung in der Planung zur Entwicklung eines durchgängigen Lehr- und Lernkonzeptes
Ziel ist die Verknüpfung von fertigungstechnischen Grundlagen der Fertigungsplanung und -durchführung. Dafür ist ein studienbegleitendes Konzept für komplexe Lern- und Arbeitsaufgaben zur spanenden Fertigung zu entwickeln. Eine konzipierte modulare Struktur, gestützt durch Simulationssoftware, ermöglicht die Umsetzung eines selbstgesteuerten und fächerübergreifenden Kompetenzerwerbes. Die virtuelle Lernumgebung ist durch starke Praxisorientierung und langfristige Einsetzbarkeit charakterisiert.
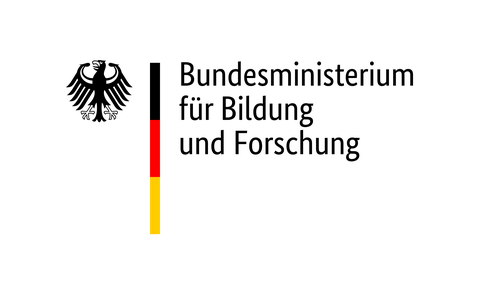
Das Projekt wird über das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen im Rahmen des Verbundantrages „Lehrpraxis im Transfer. Hochschulübergreifende fachspezifische Hochschul- und Mediendidaktik an sächsischen Universitäten“ durch das BMBF gefördert
Ansprechperson: Assistenz der Professur
ProKI Dresden - Demonstrations- und Transferzentrum für Künstliche Intelligenz in der Umformtechnik
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert ab 1. Oktober 2022 bis Ende 2024 die Sichtbarkeit und Erschließung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Produktionseinsatz. Im Verbund mit anderen Partnern im „ProKI-Netz“ ist das gemeinsame Ziel, fertigenden kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) den Einstieg in den Einsatz von KI-Anwendungen zu erleichtern. Am Zentrumstandort Dresden liegt der Schwerpunkt im Bereich Umformtechnik.
Weiter Informationen finden Sie auf der ProKI-Webseite
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Mechanische Oberflächenverfestigung von Wellen und Achsen
Zur Steigerung der dynamischen Tragfähigkeit werden in der Industrie oberflächenverfestigende Maßnahmen ergriffen. So werden die Bauteile gezielt lediglich in der hochbeanspruchten Randschicht ertüchtigt. Neben den (chemisch-)thermischen bieten hierfür auch Verfahren der mechanischen Oberflächenverfestigung immenses Potential. Diese Studie widmet sich einer Grundlagen- und Anwendungsrecherche zum Thema mechanische Oberflächenverfestigung, insb. dem Festwalzen und Kugelstrahlen. Enthalten ist eine internationale Literaturrecherche, eine Anwenderumfrage innerhalb der FVA, eine Patentrecherche sowie ausgewählte Vor-Ort-Besichtigungen. Ziel ist, das Grundlagenwissen zum Themenfeld innerhalb der FVA aufzubereiten und weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Entwicklung einer verwertungsfähigen Gleitziehbiegeanlage zur flexiblen Herstellung von geraden und definiert gekrümmten Profilen in einem Prozess
Die Professur entwickelt in Kooperation mit der FAD GmbH eine Gleitziehbiegeanlage zur flexiblen Herstellung von geraden und definiert gekrümmten Profilen. Ziel ist es, eine Anlagentechnik zu entwickeln, die es erstmals ermöglicht, reproduzierbar über den Querschnitt veränderliche Profile in nahezu beliebiger Länge und Form in einem Prozessschritt herzustellen. Dabei soll die modular, im Baukastenprinzip, geplante Anlage durch kurze Umrüstzeiten flexibel einsetzbar sein und kann damit schnell auf kundenspezifische Bedürfnisse angepasst werden. Aufgrund der geplanten Größe erfordert die Gleitziehbiegeanlage nur einen geringen Platzbedarf und eignet sich auch für den mobilen Baustelleneinsatz, wodurch kurzfristig benötigte Sonderprofile direkt vor Ort herstellbar werden. Durch die variable Beschickung, sowohl einer Einzelplatine als auch von einem Coil, sind beliebige Stückzahlen effektiv herstellbar. Das geplante Baukastenprinzip ermöglicht weiterhin die Herstellung vielfältiger Profilfamilien und bietet daher ein breites Anwendungsspektrum.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Entwicklung einer Fertigungstechnologie zur Herstellung permanentmagnetischer Ringe - HypR
Die Elektromobilität ist ein maßgeblicher Baustein für nachhaltige Mobilitätsstrategien der Zukunft und bietet große Chancen für die deutsche Industrie. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Fertigung von Lagerringen für Gleitlager mit verbesserten Eigenschaften und bereits erzielte Ergebnisse zur umformtechnischen Herstellung von hybriden Ringen aus verschiedenen Werkstoffkombinationen (z.B. Lagermessing und Wälzlagerstahl) bilden zusammen mit den Leichtbauanforderungen der Elektromobilität die Grundlage für das ZIM-Kooperationsprojekt.
Mit dem zu entwickelnden Verfahren sollen Verbundringe mit permanent-magnetischen Eigenschaften für den Einsatz als Rotor in elektromagnetischen Antrieben hergestellt werden. Die Entwicklung unterteilt sich dabei in die grundsätzlichen Schwerpunkte Weiterentwicklung des Verbundringwalzens mit Permanentmagneten sowie die Werkstoffcharakterisierung und Prozessmodellierung. Qualitätskriterium ist dabei vor allem eine hohe Verbundfestigkeit sowie Einstellung der Toleranzen und Unwucht des Rings als Bauteil sowie die Positionierung der Permanentmagneten im Verbundring. Ziel ist eine Prozesskette mit möglichst wenigen Prozessschritten und dadurch verbesserter Ressourceneffizienz vom Rohling (Schmiedeteil) zum fertigen Hybridring.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Experimentelle Untersuchung und Modellierung des Wärmeübergangs beim Presshärten
Wachsendes Umweltbewusstsein und gesetzliche Vorgaben zum CO2-Ausstoß haben in den letzten Jahrzehnten zu einer stetig steigenden Bedeutung des Leichtbaus in der Automobilindustrie geführt. Das Presshärten höchstfester Bor-Mangan Stähle hat sich dabei zu einem Standardverfahren bei der Fertigung sicherheitsrelevanter Karosseriekomponenten entwickelt. Bei diesem Prozess werden die Halbzeuge zunächst oberhalb der werkstoffspezifischen AC3-Temperatur vollständig austenitisiert. Nach der Wärmebehandlung erfolgt ein direkter Transfer des glühenden Blechs in das Werkzeug. Parallel zur anschließenden Umformung wird das Werkstück im Werkzeug abgeschreckt. Sofern bei diesem Prozessschritt eine kritische Abschreckgeschwindigkeit überschritten wird, bildet sich ein vollständiges martensitisches Gefüge, wodurch Zugfestigkeiten von mehr als 1500 MPa erreicht werden können. Wesentlich für die finalen mechanischen Eigenschaften der pressgehärteten Bauteile ist somit der Temperaturverlauf in der Prozesskette und insbesondere im Abschreckprozess.
Das Ziel des Forschungsvorhabens ist die Erarbeitung eines grundlegenden Verständnisses der beim Presshärten vorkommenden Mechanismen des Wärmetransports sowie deren Modellierung.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Erweiterte, flexible Fertigungs- und Logistikplanung auf Grundlage von Volumenpixeln und agiler Transportlastermittlung - FeLoVox
Als eine der Hauptursachen für die wachsenden Planungsaufwände steht die zunehmende Verflechtung von Fertigung und Logistik im Fokus. Um hier den Interaktionen zwischen Intralogistik und Fertigung bei der Produktionsplanung gerecht zu werden, ist Expertenwissen (sowohl hinsichtlich der Ablaufsteuerung, als auch bezüglich des Umgangs mit Software und ggf. Hardware) bzw. Erfahrung aus Forschung und Industrie erforderlich. Dies führt tendenziell zu höheren Personal- und Softwarekosten und möglicherweise längeren Planungsphasen. Diesen Herausforderungen und Gefahren will das F&E-Projekt FeLoVox entgegentreten und durch die Entwicklung eines automatisierten, integrierten Ansatzes die Planungsaufwände senken, die Ergebnisqualität erhöhen und damit einen breiten Lösungsraum für KmU ermöglichen.
Ansprechperson: Assistenz der Professur
Experimentelle Charakterisierung und numerische Analyse der schwingfestigkeitssteigernden Wirkung von Eigenspannungen in quergewalzten Bauteilen
Die Herstellung von Bauteilen durch Umformung führt zu Eigenspannungen, welche die Bauteileigenschaften nachhaltig beeinflussen. Solche inneren Beanspruchungen können beispielsweise Auswirkungen auf die Herstellbarkeit sowie die Lebensdauer besitzen. In der Regel wird angestrebt, Eigenspannungen zu vermeiden bzw. zu verringern, da ihnen vornehmlich negative Eigenschaften zugewiesen werden. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Eigenspannungen auch gezielt eingesetzt werden können, um beispiels-weise die statische und die Betriebs- bzw. Schwingfestigkeit zu verbessern, wenn sie entgegen der Richtung der Betriebsbeanspruchung wirken. Eigenspannungen werden bei herkömmlichen Fertigungsstrategien als qualitätskritisch angesehen. Hier setzt das DFG-Schwerpunktprogramm 2013 an und untersucht stattdessen die Chancen und Möglichkeiten, die Eigenschaften von Bauteilen durch gezielte Nutzung von Eigenspannungen zu verbessern.
Ansprechperson: Assistenz der Professur