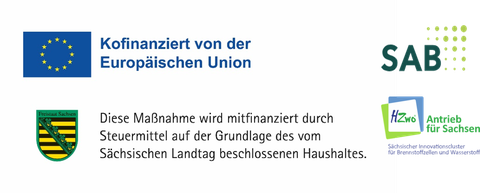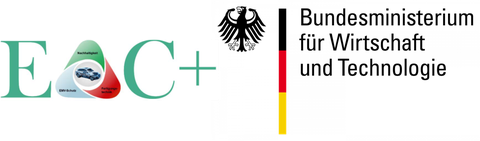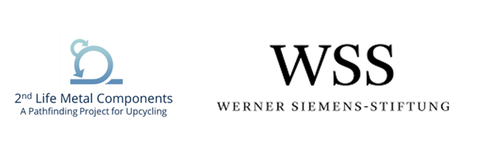laufende Forschungsprojekte an der Professur für Formgebende Fertigungsverfahren
Fertigung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen durch laserunterstütztes Hohlprägewalzen „BiPwalz“
Die nationale Wasserstoffstrategie des BMWK prognostiziert bis 2050 eine Nachfrage von über 25 TWh H₂. Um Importe zu vermeiden und die Energieversorgung unabhängig zu machen, müssen Produktion und Kosten von Brennstoffzellen (FC) und Elektrolyseuren (EC) gesenkt werden. Ein wesentlicher Kostentreiber sind Bipolarplatten (BiP), die 20–30 % der Gesamtkosten ausmachen. Aufgrund geringer Blechdicken (75–100 μm) und strenger Toleranzen ist ihre Fertigung besonders anspruchsvoll.
Im Vorhaben wird die Bipolarplatte (BiP) einer PEM-Niedrigtemperaturzelle untersucht, die sowohl Energie aus (grünem) Wasserstoff erzeugen als auch Wasser aufspalten kann. Entwickelt wird ein neuer Prozess aus Hohlprägewalzen und Laserbehandlung zur Reduktion der Rückfederung. Ziel ist eine kontinuierliche, präzise Fertigung im industriellen Maßstab mit ca. 120 BiP/min, geringeren Werkzeugkosten, weniger Nacharbeit und guter Einbindung in Rolle-zu-Rolle-Prozesse.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Automatisierte Treibhausgasbilanzierung für den Mittelstand - Auto THG-Bilanz
Im Rahmen des Green Deal fordert die EU ihre Mitglieder dazu auf, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ein wesentliches Instrument zur Erreichung dieses Ziels stellt die Erfassung der Treibhausgas-(THG-)Bilanz von Großunternehmen (>1000 Mitarbeiter*innen) dar. Folglich ist diese aufwändige Bilanzierung für KMUs nicht verpflichtend, wird jedoch indirekt durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (kurz Lieferkettengesetz) an sie weitergeleitet. Das Ziel des Projekts besteht in der Automatisierung der THG-Bilanzierung, um KMUs in der metallverarbeitenden Industrie wirtschaftlich und personell zu entlasten. Das angestrebte Projektergebnis ist eine innovative Technologie, die in der Lage ist, automatisch produkt- und unternehmensspezifische THG-Bilanzen zu kalkulieren. Zunächst wird die Technologie für den 3D-Metalldruck (3DMD), das Drehen und das Fräsen genutzt. Durch diese Auswahl an Fertigungsverfahren werden zunächst circa 50% der gesamten Metallverarbeitung abgedeckt. Die Möglichkeit der Anwendungserweiterung auf weitere Fertigungsverfahren ist durch die Modularität der Technologie gegeben. Die Technologie wird als Demonstrator in ein selbstentwickeltes Software-Tool überführt. Das Software-Tool erstellt aus dem CAD-Modell eines Bauteils einen validen Fertigungsplan und errechnet die dazugehörigen Plandaten. Für jeden Fertigungsschritt wird der entsprechende THG-Wert kalkuliert. Dadurch können Unternehmen, denen die Ressourcen oder das Know-how für eine THG-Bilanzierung fehlen, entlastet werden.
Ansprechperson: Sebastian Langula
Experimentelle und numerische Analyse umforminduzierter Eigenspannungen zur gezielten Schwingfestigkeitssteigerung hochzyklisch belasteter Reinstkupferbauteile
Bauteilversagen infolge zyklischer Belastung spielt in nahezu allen industriellen Anwendungen eine entscheidende Rolle. Um Ausfälle zu vermeiden, muss das Verhalten unter zyklischen Lasten im Dimensionierungsprozess berücksichtigt werden. Aufbauend auf methodischen Erkenntnissen eines DFG-Vorhabens welches gemeinsam von den Antragstellern im Rahmen des DFG-SPP 2013 bearbeitet wurde, soll in Kooperation mit der ZF Friedrichshafen AG (ZF) eine systematische Untersuchung von umformend hergestellten Bauteilen aus Reinstkupferblech erfolgen. Beispielhaft werden dazu durch Biegeprozesse hergestellte Stromschienen genutzt. Die Auswirkungen des Umformprozesses auf den Eigenspannungszustand sowie die lokalen Werkstoffeigenschaften und die daraus resultierende Schwingfestigkeit des Bauteils bilden den Kern des Vorhabens. Der Fokus liegt auf der gezielten Einstellung des Eigenspannungszustandes zur Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Umform- und Schweißtechnologie für energieeffizientes und ressourcenschonendes Fertigen metallischer Bipolarplatten – UmKE
Der Erfolg der CO2-neutralen Wasserstoffwirtschaft hängt wesentlich von den Herstellkapazitäten und Kosten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure ab. Metallische Bipolarplatten (BPP) verursachen 70-80 % der Herstellungskosten eines Brennstoffzellen-Stacks. Neben den Materialkosten (ca. 55 %) sind die Aufwände für die Fertigung, zusammen mit den Werkzeugherstellkosten, ein wesentlicher Faktor. Die Entwicklung robuster, hochratefähiger, automatisierbarer und skalierbarer Fertigungstechnologien für metallische BPP ist Ziel dieses Projektes. Die Schwerpunkte der Forschung liegen auf der Formgebung, dem Fügen und der Prozessmodellierung. Das Umformen der dünnen Folien stellt eine sehr große Herausforderung dar, die durch zusätzliche Anforderungen aus der fügegerechten Gestaltung erhöht wird. Der Umformprozess soll durch schwingungsüberlagertes Prägen prozesssicher realisiert werden. Das Schweißen der 50 μm dünnen Halbschalen ist ebenso herausfordernd und soll durch das robuste Kondensatorentladungsschweißen innerhalb weniger Millisekunden erfolgen. Da so nur punktförmige elektrisch leitende Schweißverbindungen hergestellt werden können, wird das Thermische Direktfügen für das Abdichten der BPP in einem weiteren Teilprojekt erforscht. Im Vergleich zum bisher eingesetzten Laserschweißen ergeben sich wirtschaftliche (deutlich verringerte Fertigungszeiten bei viel geringeren Anlagenkosten) und technische Vorteile (weniger Wärmeeintrag und damit geringer Verzug und geringe Oberflächendegradation).
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Verfahrenstechnologie und Gerät zur Automatisierung der Fügestellenvorbereitung von Kunststoffmantelrohren (KMR) für den effizienten Ausbau von Fernwärmenetzen - KMR-VerA
Fernwärmenetze leisten einen wesentlichen Beitrag zur effizienten Energieressourcennutzung und sollen beschleunigt ausgebaut werden. Die ca. 350 Unternehmen, die in Deutschland das Fernwärmenetz ausbauen und warten können den Bedarf nicht ansatzweise decken. Die jährlichen Zuwachsraten von 9% und mehr sind nur durch eine höhere Produktivität bei gleichbleibender oder höherer Qualität zu erreichen, um Wartungsbedarfe langfristig zu verringern. Die wichtigste Komponente beim Netzausbau sind die Kunststoffmantelrohre (KMR), welche durch hohen manuellen Aufwand auf der Baustelle zum Verbinden vorbereitet werden müssen. Mit einer (teil)automatisierten Fügestellenvorbereitung wollen wir die aktuelle Zeit für die Vorbereitung auf die Hälfte verkürzen. Dies erhöht in gleichem Maße die Produktivität und erlaubt eine Einsparung im Gesamtbauvolumen für Deutschland von bis zu 3 Mio. € pro Jahr. Mit unserem Gerät zur (teil)automatisierten Fügestellenvorbereitung von Kunststoffmantelrohren möchten wir pro Firma jährliche Einsparpotentiale von min. 5.000 € erreichen. Ziel dieses Projektvorhabens ist die dafür notwendige Verfahrens- und Produktentwicklung.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
SPP2476 - Methodenentwicklung zur multikriteriellen Optimierung einer Prozesskette zur Herstellung hybrider Leichtbaukomponenten
Untersuchungsgegenstand des Projektes ist eine vierstufige Prozesskette zur Herstellung eines Leichtbauhelmes aus einer Al/Mg/Al Sandwichstruktur. Die in technologisch relevanten Grenzen einstellbaren, im Zuge einer rückwärtsgerichteten Auslegung relevanten Eigenschaften sind das Bauteilgewicht, die Steifigkeit, die Form- und Maßhaltigkeit sowie der resultierende CO2-Fußabdruck. Infolge der Vielzahl an direkt beeinflussbaren Parametern entlang der Prozesskette zur Einstellung der genannten vier Bewertungskriterien und der gegenseitigen Parameter-Wechselwirkungen, ist die Prozesskette „Walzplattieren-Platinenzuschnitt-Tiefziehen-Laserschnitt“ hervorragend geeignet für die rückwärtsgerichtete Auslegung bzw. die übergreifende Prozesskettenoptimierung.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Sustainable Electric Architecture Casings: EAC+
Ziel des EAC+ Projekts ist es: kreislauffähige, nachhaltige, ökonomisch und technisch konkurrenzfähige Gehäusestrukturen zu entwickeln, die ein hohes Potential haben, in verschiedensten Branchen Anwendung zu finden und gleichzeitig den hohen elektromagnetischen Anforderungen der Elektromobilität gerecht werden. Demonstriert werden soll dies an einer der technologisch anspruchsvollsten Komponenten elektrischer Fahrzeuge, dem Gehäuse des Traktionsinverters. Langfristig ist es geplant, die Technologie auch auf die Gehäuse von DC/DC Wandlern, Ladegeräten, Batteriegehäusen etc. zu übertragen. Mit den EAC+ Projektpartnern wird eine neue Art des hybriden Spritzgusses entwickelt. Die EAC+ Technologie ermöglicht es, übliche Aluminiumgehäuse durch wirtschaftlich attraktive und gleichzeitig nachhaltige Bauteile mit einem intelligenten Werkstoffmix zu ersetzen.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
2nd Life Metal Component – Upcycling by Remanufacturing
Während Themen rund um die Ressource Energie in jüngerer Vergangenheit hohe Aufmerksamkeit genießen, bleibt die Ressource Werkstoff häufig unbeachtet, obwohl beide Ressourcenarten für eine nachhaltige Fertigungstechnik essentiell sind. Insbesondere Industrienationen weisen einen sehr hohen Werkstoffbedarf – speziell an Metallen – auf, der allein mit der energieintensiven Herstellung neuer Werkstoffe oder mit den bisherigen Verwertungsstrategien wie dem Recycling nicht zu decken ist. Daher müssen zukünftig die in Gebrauch befindlichen Güter direkt als Rohstoff genutzt werden. Der Energie-aufwändige Recyclingschritt über die Rückführung in eine Schmelze entfällt hierbei und wird durch eine direkte Weiternutzung des Werkstoffs ersetzt. Aktuell ist die Produktionstechnik allerdings auf diese neuartige Rohstoffgewinnung nicht eingerichtet, sodass keine adäquaten Prozessrouten oder -ketten existieren, die eine Verarbeitung dieser Ressourcen ermöglichen. Hier setzt das Forschungsvorhaben an, um für den größten Anteil der metallischen Komponenten – den Blechbauteilen – eine praktikable Prozessroute zu entwickeln, bei denen die Bereiche Laserbearbeitung, Werkstoffcharakterisierung, Umformung und Planung komplementär zusammenwirken. Als Ergebnis soll es somit ermöglicht werden, ein neues Bauteil mit einem Anteil von 75% aus bereits mindestens einmal verwendeten Werkstoffen ohne klassischen Recyclingschritt nachhaltig zu fertigen:
¾ bereits genutztes Bauteil + ¼ neues Halbzeug ⇨ 2nd Life Metal Component
Ansprechperson: Christina Guilleaume
Automatisierte Entfernung von 3D-Metalldrucksupports durch Fräsbearbeitung - AutoSupport
Das EU-geförderte Projekt ist ein Kooperationsprojekt mit der H+E Produktentwicklung GmbH. Das Ziel dieses Projekts besteht in der gemeinsamen Entwicklung einer innovativen Technologie zur automatisierten Entfernung von Support in 3D-Metalldruckbauteilen durch 5-Achs-Fräsen um die Automatisierung der Produktionskapazität zu erhöhen und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken. Im Projekt sollen die neuesten Erkenntnisse der Forschung zur Lösung eines bisher unüberwindbaren Problems von großer wirtschaftlicher Bedeutung herangezogen werden.
Ansprechperson: Sebastian Langula
Transregio TRR285 - Methodenentwicklung zur mechanischen Fügbarkeit in wandlungsfähigen Prozessketten
Mit der Erforschung wissenschaftlicher Methoden auf dem Gebiet der Fügetechnik, die zur Etablierung effizienter und ressourcenschonender Prozessketten bei Produktvielfalt, unterschiedlichen Werkstoffen und Bauweisen führen, wendet sich der SFB/Transregio einer spannenden und aktuellen Thematik zu. Angesichts volatiler Bedarfe von Industrie und Verbrauchern sowie sich beschleunigender Entwicklungszyklen in der globalisierten Welt ist die Wandlungsfähigkeit eines der zentralen Themen der modernen Produktionstechnik
Weitere Informationen finden Sie auf der TRR285-Webseite
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Thermomechanisches Ringwalzen mit prädiktiver Eigenschaftsregelung
Das thermomechanische tangentiale Profilringwalzen (TMR) stellt ein Verfahren zur Herstellung endkonturnaher Ringgeometrien bei gleichzeitig gezielter Beeinflussung der Mikrostruktur und Härte durch eine geregelte Prozessführung hinsichtlich Umformung und Temperatur dar. Hierfür kommt ein kombinierter Ansatz aus PID und prädiktiven Modellen zum Einsatz, der es ermöglicht das vorhandene Prozessfenster so auszunutzen, dass die Sollwerte für Endgeometrie, Mikrostruktur und Härte gleichzeitig erreicht werden können. Nach der Validierung auf der realen Maschine wird es möglich sein, die Kontrollstrategie für Geometrien und Konfigurationen auf Fälle zu übertragen, die nicht auf der vorhandenen Walzanlage realisierbar sind. Eine Analyse des Prozesses und der Systemleistung soll die Ableitung von Gestaltungsprinzipien und -regeln hinsichtlich der Systemarchitektur (Aktoren, Sensoren, Modellierung und Steuerung) für die Implementierung des thermomechanisch geregelten Ringwalzens ermöglichen.
Weiter Informationen finden Sie auf der SPP2183-WebseiteSPP2183-Webseite
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Komplementäre Datenbasiserzeugung für das maschinelle Lernen zur Qualitätsprognose am Beispiel des Ringwalzens
Zur Verwendung von maschinellem Lernen für Fertigungsprozesse wie dem Radial-axial Ringwalzen müssen Datenbestände von Gut- und Ausschussteilen aufgenommen werden. Hierbei sind ausgeglichene Datensätze hinsichtlich des Verhältnisses von Gut- zu Ausschussteilen notwendig. Dies ist bei industriellen Daten jedoch nicht der Fall, weshalb innerhalb des Projektes die Methode der Datenvermehrung durch synthetische Daten via Simulation verwendet wird. Innerhalb des Bereichs des Radial-axial Ringwalzen gibt es keine schnelle, analytische Simulation, durch welche eine hinreichend große Anzahl an synthetisch hergestellten Datensätzen mit „form- oder prozessfehlerbehafteten Walzungen“ erzeugt werden kann. Aus diesem Grund wird der Forschungsfrage nachgegangen, inwiefern ein artgleicher Prozess für den Transfer zum Radial-axial Ringwalzen untersucht werden kann.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Entwicklung eines Verfahrens zur Umformung von Aluminiumblechwerkstoffen bei kryogenen Temperaturen
Leichtbauwerkstoffe wie Aluminiumlegierungen spielen eine wichtige Rolle bei der Gewichtsreduzierung. Ihre eingeschränkte Umformbarkeit bei Raumtemperatur stellt jedoch eine große Herausforderung dar und schränkt ihren Einsatz ein. Signifikante Verbesserungen der Umformbarkeit lassen sich zwar beispielsweise durch Erholungsglühen oder Warmumformung mit mehreren Prozessschritten erzielen. Diese Verbesserung der Umformbarkeit geht jedoch auf Kosten diverser positiver Eigenschaften wie Festigkeit, Bauteilqualität oder Kosten. Um dies zu vermeiden, können Aluminiumbleche bei kryogenen Temperaturen umgeformt werden, wobei die Grenze zum Einstellen der positiven Eigenschaften Gegenstand der hier beantragten Forschung sein soll. Im Projhekt wird die Kombination der kryogenen Blechumformung mit der Makrostrukturierung von Matrize und Niederhalter beim Tiefziehen behandelt. Durch eine spezielle, wellenartige Geometrie der formgebenden Werkzeuge wird die Kontaktfläche zwischen Blech und Werkzeug minimiert, um den Wärmestrom und damit die Erwärmung des Blechs zu unterdrücken. Darüber hinaus ist die lokale Grenztemperatur des Blechs zu ermitteln, ab welcher die Vorteile der kryogenen Werkstoffeigenschaften von Aluminiumlegierungen zum Tragen kommen.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Resilientes Tiefziehen durch makrostrukturierte Werkzeuge
Der Ansatz, eine Makrostrukturierung im Flanschbereich zur Stabilisierung des Tiefziehprozesses und zur Steigerung der Robustheit gegen veränderliche Eingangsgrößen einzusetzen, ist in allen blechverarbeitenden Branchen und im zugehörigen Werkzeugbau von Nutzen. Das zentrale Ziel liegt darin, die im Grundlagenbereich erzielten Ergebnisse in vollem Umfang für industrielle Anwender verfügbar zu machen. Die bereitgestellte Methodik weist ein extrem hohes Potenzial zur Umsetzung im herausfordernden industriellen Umfeld auf, da sie zwei der Hauptprobleme von Unternehmen adressiert. Zum einen ist die Robustheit von Tiefziehprozessen von hoher Relevanz, weil sich durch sie der Ausnutzungsgrad von Werkstoffen verbessert sowie die Produktion von Aus-schuss minimiert und Schäden an kostenintensiven Werkzeugen verhindert werden. Zum anderen ist es bei einem hohen Kostendruck und immer kürzeren Zeiträumen zwischen Evolutionen und Neuentwicklungen von Produkten kritisch, diese schnell und zuverlässig in sichere Prozesse zu überführen.
Ansprechperson: Christian Steinfelder
Automatisierte Fertigungskalkulation- AFK
Das Ziel des FuE-Kooperationsprojekts ist die Entwicklung einer Technologie zur Automatisierte Fertigungskalkulation um Aufwände für die in der spanenden Fertigung stets erforderliche Kalkulation von Planzeiten und Fertigungskosten drastisch zu reduzieren. Hierzu wird eine vollständig automatisierte Fertigungskalkulation angestrebt. Die Technologie soll eine wirtschaftliche, verlässliche und hocheffiziente Planung der spanenden Fertigung ermöglichen. Der Ansatz verzichtet auf die bisher üblichen manuellen Methoden der Fertigungskalkulation und ermittelt aus ohnehin verfügbaren CAD-Daten der Bauteile, direkt und vollautomatisiert Fertigungsaufwände. Das geplante F&E-Projekt digitalisiert hierzu vorhandenes fertigungstechnischen Wissen und wendet diese automatisch auf die vorhandene Datengrundlage (CAD-Daten) an. Die gebotene Lösung befähigt Unternehmen, ohne eigene Abteilung für die Fertigungskalkulation, auf fertigungstechnisches Know-How zurückzugreifen.
Ansprechperson: Sebastian Langula
Entwicklung einer automatisierten konstruktionsbegleitenden Fertigbarkeitsanalyse auf Basis von CAD-Daten - Fertigbarkeitsanalyse
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten und konstruktionsbegleitenden Bereitstellung von Informationen für den Konstrukteur, die ihn in die Lage versetzen, bereits während des Konstruktionsprozess die Aufwände einer spanenden Fertigung des von ihm konstruierten Bauteils zu reduzieren. Dem Konstrukteur kommt im Produktentstehungsprozess (PEP) eine besondere Rolle zu, da in der Konstruktionsphase ca. 85% aller späteren Kosten festgelegt werden. Eine frühzeitige Erkennung von einer nicht fertigungsgerechten Konstruktion, reduziert nachhaltig und aufwandsarm die Kosten für das gesamte Produkt.
Ansprechperson: Sebastian Langula