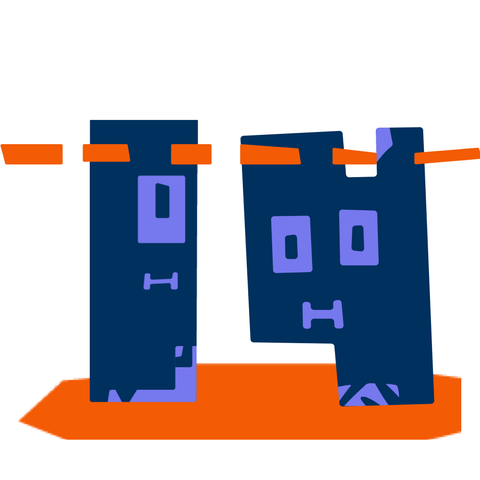"Bestehen reicht denen..."
Elia ist Fachdozent an einer Universität. In seinen Lehrveranstaltungen sitzen dutzende Studierende. Da kann er nicht auf alle Lernenden Rücksicht nehmen. Vor allem die Lehramtsstudierenden, so scheint es Elia, fordern oft eine Extrabehandlung. Sie fragen beispielsweise wiederholt nach Prüfungsleistungen, Modulnummern und Abgabeterminen. Elia beobachtet außerdem, dass Lehramtsstudierende nicht immer anwesend sind und dann nicht wissen, was in der Zwischenzeit besprochen wurde. Elia hat keine Zeit für Ausreden, warum dieses oder jenes nicht bekannt ist. Der Stoff muss geschafft werden. Er hätte gern eine Vorauswahl, damit alle Studierenden die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Denn Elia findet, selbst die Lernenden, die bei allen Lehrveranstaltungen anwesend waren, können am Ende oft nicht genug. Er meint, sie lernen alle höchstens für das Bestehen in der Prüfung. Von Interesse am Thema würde Elia kaum noch sprechen.
Kim ist Lehramtsstudentin und studiert somit neben den Erziehungswissenschaften auch zwei spätere Unterrichtsfächer mitsamt deren Fachdidaktiken (gilt für Lehramt an Oberschulen, Gymnasien und Berufsbildende Schulen, Grundschullehramt ähnlich). Für die fachwissenschaftlichen Inhalte besucht Kim Vorlesungen und Seminare, die auch Bachelor- und Masterstudierende belegen. Kim findet, Lehramtsstudierende haben vor allem in diesen Lehrveranstaltungen mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Zum einen kommt es selten vor, dass die besonderen Studienumstände der Lehramtsstudierenden bekannt sind oder berücksichtigt werden. Häufig fühlt sich Kim aufgrund dessen nicht gesehen oder als Studentin zweiter Klasse. Zum anderen gab es auch schon beleidigende Bemerkungen von Fachdozierenden gegenüber Lehramtsstudierenden. Es kam beispielsweise vor, dass Kim und Kommiliton*innen als Halbwissenschaftler*innen bezeichnet wurden. Außerdem zeigen Lehramtsstudierende demnach nicht genug Engagement und sind nicht intelligent genug, um das entsprechende Fach im Bachelor und Master zu studieren. Denn sie würden stets die schlechteren Noten schreiben. In einer Vorlesung wurden Lehramtsstudierende sogar extra rot als Durchgefallene in einer Statistik der Durchschnittsnoten hervorgehoben.
Fragen die sofort hier beantwortet werden:
- Warum haben Lehramtsstudierende scheinbar oft Extrawünsche?
- Warum sind Lehramtsstudierende nicht immer regelmäßig in den Lehrveranstaltungen anwesend?
- Kann eine Vorauswahl z. B. durch eine fachliche Eignungsprüfung die Lösung sein?
- Warum geht es vielen Studierenden scheinbar nur um das Bestehen?
- Wo bleibt das Interesse der Studierenden?
Fragen die an anderer Stelle beantwortet werden:
- Welchen Einfluss haben Fachstudierende auf das Verhalten der Lehramtsstudierenden und wie wirken sie Vorurteile emotional aus?
Mehr dazu erfahren Sie im Fall Student*in zweiter Klasse
Warum haben Lehramtsstudierende scheinbar oft Extrawünsche?
Wenn eine recht große und heterogene Studierendengruppe signifikant negativer wahrgenommen wird als andere, dann sollte man sich die Frage stellen, ob dies systemische Gründe hat. Tatsächlich sind die üblichen Herausforderungen eines Studiums durch die spezifischen Strukturen des Lehramtsstudiums (an der TU Dresden) noch einmal potenziert.
Beispielsweise durch eine Unklare Lage: Aufgrund unterschiedlicher Studienordnungen besuchen Lehramtsstudierende zwar gemeinsam mit Bachelor- oder Master-Studierenden einige Lehrveranstaltungen, teilweise sind die Prüfungsleistungen nichtsdestotrotz unterschiedlich. Häufig wird in den Lehrveranstaltungen diese Lage nicht transparent dargestellt, sodass es zu Unsicherheiten oder Frust auf Seiten der Studierenden kommen kann.
Zusätzlich zu den systemischen Bedingungen, haben Lehramtsstudierende mit Vorurteilen zu kämpfen. 2016 hat im Rahmen der ersten Förderphase von TUD-Sylber eine Datenerhebung unter Dozierenden, Mittelbauvertreter*innen und Lehramtsstudierenden der TU Dresden stattgefunden. Diese hat unter anderem folgendes ergeben:
-
Lehramtsstudierende haben die Erfahrung gemacht, als Halbwissenschaftler*innen bezeichnet zu werden.
-
Lehramtsstudierenden sind Situationen ausgesetzt, in denen sie als weniger fachlich geeignet als Bachelor- und Masterstudierende hervorgehoben werden.
-
Fachdozierende nehmen Lehramtsstudierende als weniger engagiert sowie minder interessiert wahr.
-
Laut einigen Fachdozierenden sind Lehramtsstudierende zudem nicht um Ausreden verlegen, wenn etwas terminlich oder inhaltlich daneben geht.
-
Lehramtsstudierende fühlen sich in fachwissenschaftlichen Veranstaltungen seltener adressiert und weniger respektiert als ihre Bachelor-, Masterkommiliton*innen und daher häufig als Studierende zweiter Klasse.
Zum letztgenannten Punkt passen auch neuere Ergebnisse einer ZLSB-Lehramtsstudierenden-Befragung vom Sommersemester 2021. Dort wurde unter anderem abgefragt, ob sich die Lehramtsstudierenden in fachwissenschaftlichen Veranstaltungen als solche wahrgenommen fühlen. Zwar differieren die Ergebnisse stark von Fach zu Fach, jedoch fühlen sich auch im besten Fall nur 80% der Lehramtsstudierenden in fachwissenschaftlichen Veranstaltungen entsprechend zur Kenntnis genommen. Im Extremfall haben nur knapp über 20% mit "trifft zu" oder "trifft eher zu" geantwortet.
Warum sind Lehramtsstudierende nicht immer regelmäßig in den Lehrveranstaltungen anwesend?
Keine Überschneidungsfreiheit: Da Lehramtsstudierende sowohl Veranstaltungen der Erziehungswissenschaften, der zwei Fachwissenschaften sowie der je dazugehörigen Fachdidaktiken besuchen, kommt es leider immer wieder zur zeitlichen Überschneidung von Veranstaltungen.
Profession: Die Datenerhebung von 2016 hat außerdem gezeigt, dass sich Lehramts- studierende häufig eher als Pädagog*innen sehen, denn als Fachwissenschaftler*innen. Bei Doppelbelegungen in ihrem Stundenplan sind sie daher häufig eher geneigt, bei den didaktischen Formaten anwesend zu sein. Wenn sie dann noch das Gefühl bekommen, in den Fachwissenschaften nicht willkommen zu sein oder zu stören, wird der Fluchteffekt in die Didaktiken sowie die Erziehungswissenschaft zusätzlich verstärkt. Der Fall "Keine Praxisrelevanz!?" führt die Gedanken dazu noch weiter aus.
Aufwand: Durch drei selten aufeinander abgestimmte Studienbereiche (Erstes Fach, Zweites Fach, Erziehungswissenschaft), müssen Lehramtsstudierende ungleich mehr Zeit für Studienorganisation aufwenden. Der Vergleich einiger Studienordnungen zeigt außerdem, dass auch der zeitliche Aufwand für Vor- und Nachbereitung in einigen Fachdisziplinen ungleich höher angesetzt wird als für Fachstudierende.
Kann eine Vorauswahl z. B. durch eine fachliche Eignungsprüfung die Lösung sein?
Nein, und dies nicht nur, weil das Format von Eignungsfeststellungsprüfungen aufgrund des druck- und stresserzeugenden Settings fragwürdig ist. Solange sich an den hier mit Fettdruck hervorgehobenen Rahmenbedingungen des Lehramtsstudiums (an der TU Dresden) nichts ändert, werden auch vermeintlich "fachlich geeignetere" Studierende nicht mit besseren Leistungen, engagierter oder interessierter an Lehrveranstaltungen teilnehmen können.
Warum geht es vielen Studierenden scheinbar nur um das Bestehen?
Wenn man als Lehrperson das Gefühl hat, den Studierenden ginge es nur ums Bestehen, dann kann es ebenso gut sein, dass Bestehen den Lernenden genügen muss. Denn nicht selten erschweren die Studienbedingungen, finanzielle und familiäre Zwänge sowie weitere Aspekte das Erbringen besserer Leistungen. Das Bild von faulen Studierenden, denen es nur um Bestehen geht, ist daher häufig nicht mehr als ein Vorurteil, welches die Umstände außer Acht lässt. Es ist klar, dass so keine lernförderliche Beziehung zustande kommen kann. Noch mehr zu diesem Thema bietet der Fall "Es geht nur noch um die Noten".
Wo bleibt das Interesse der Studierenden?
Opportunitätskosten: Wollen die Studierenden ihr Studium trotz Überschneidungen möglichst in der Regelstudienzeit absolvieren, sind sie zu bestimmten Aufwand-Nutzen-Abwägungen gezwungen. So werden häufig Seminare gewählt, die noch irgendwie in den Stundenplan integrierbar sind, aber deren thematische Ausrichtung nicht ganz den persönlichen Interessen entspricht.
- Habe ich negative Gedanken oder Vorurteile gegenüber Studierenden und schon einmal reflektiert, welche Gründe die Lernenden für das mich störende Verhalten haben könnten?
Zur Reflexion und Anregung eines Perspektivwechsels bietet der Fundus Inklusion weitere Informationen zu den besonderen Umständen des Lehramtsstudiums. - Gehe ich per se davon aus, dass sich Studierende, wenn sie nicht in der Lehrveranstaltung anwesend sind, auch in für sie passenden Zeitfenstern nicht mit den Lerninhalten auseinandersetzen?
- Ist mir bewusst, dass unterschiedliche Studierende in meiner Veranstaltung sitzen, seien es nun Studierende verschiedener Fachwissenschaften im Hauptstudium oder Ergänzungsbereich oder Lehramtsstudierende?
Im Fundus Inklusion werden auch verschiedene Kennenlernangebote vorgestellt. -
Kenne ich die spezifischen Prüfungsleistungen, Modulnummern und Abgabetermine dieser verschiedenen Studienrichtungen und mache ich diese in meiner Veranstaltung transparent?
Die Studienordnungen für das Lehramt können Sie bei Bedarf nachschlagen. - Adressiere ich alle Studierenden oder könnte der Eindruck entstehen, dass ich bestimmte Studierendengruppen bevorzuge?
Auch hier könnten die Hinweise zur Beziehungsgestaltung hilfreich sein. - Kann ich meine Veranstaltungen inhaltlich und/oder methodisch (z. B. asynchrone Lehre, Flipped Classroom, Open Space/Projektmethode etc.) offener gestalten, damit eher die Studierenden "teilnehmen", die sich für das Thema interessieren, statt die, denen es am besten in den Plan passt?
Der Fundus Inklusion hält hier Einblicke in verschiedene offene Lernmethoden bereit.
Alle Stolperfallen auf einen Blick finden Sie im Bereich Reflektieren.
Etikettierungsfalle
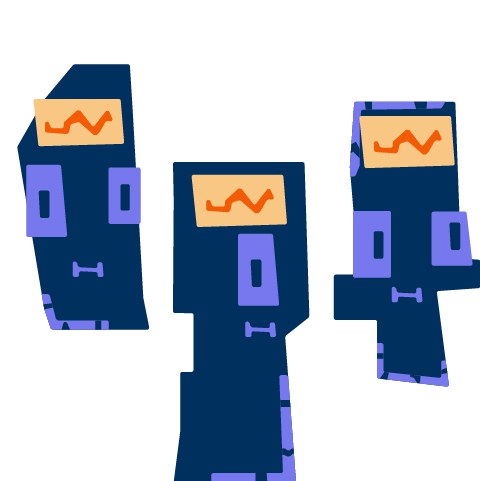
Etikettierungsfalle
Elia ist voreingenommen sowohl gegenüber Lehramtsstudierenden als auch gegenüber Studierenden im Allgemeinen. Er geht davon aus, dass alle Lehramtsstudierenden eine Extrabehandlung brauchen und das Studierende im Allgemeinen nur noch für das Bestehen lernen. Diese Vorurteile reduzieren alle Individueen auf ihre Gruppenzugehörigkeit als (Lehramts-)Studierende. So verdrängen Zuschreibungen die Einzigartigkeit und individuelle (Lern-)Bedürfnisse.
Homogenisierungsfalle
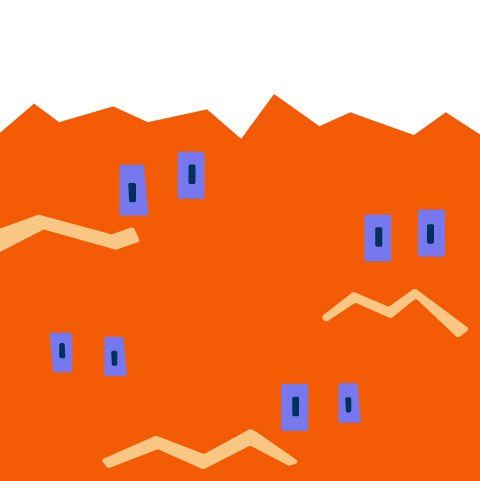
Homogenisierungsfalle
Es kommt vor, dass Lehrende von einer homogenen Masse Lernender ausgehen und annehmen, alle bräuchten und könnten dasselbe.
Deshalb kommt es Elia nicht in den Sinn, dass es Gründe dafür geben könnte, warum Lehramtsstudierende wiederholt nach Prüfungsleistungen, Modulnummern und Abgabeterminen fragen. Fach- und Lehramtsstudierende sind mit unterschiedlichen Studienrealitäten konfrontiert. Darauf müssen Lehrende eingehen, um gerecht zu sein.
Zuständigkeitsfalle
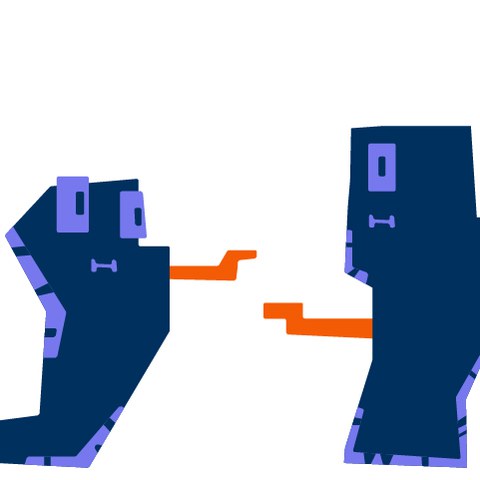
Zuständigkeitsfalle
Elias Hauptaugenmerk liegt auf der Vermittlung von Wissen. Das Missverständnis besteht darin, dass Elia sich nicht klarmacht, dass gute pädagogische Beziehungen einen wichtigen Beitrag zu Lernen und Entwicklung leisten.
Da er es jedoch nicht als seine Aufgabe ansieht, sich mit den Fragen und Bedürfnissen der Lernenden auseinanderzusetzen, verspielt er Potential für den Aufbau pädagogischer Beziehungen.