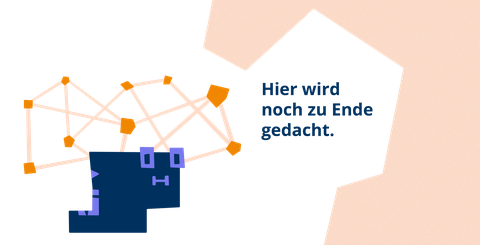Wiki - Zentrale Begriffe des Fundus Inklusion kurz erklärt
Auf dieser Seite werden die zentralen Begriffe des Fundus Inklusion versammelt und möglichst kurz erklärt. Der Anspruch ist dabei Wissenschaftlichkeit und eine barrierearme Sprache miteinander zu verbinden.
Sie suchen einen bestimmten Begriff?
Mithilfe der Websuche Ihres Browsers können Sie gezielt nach dem Begriff suchen, zu dem Sie nachlesen möchten.
Zur Websuche gelangen Sie unter Verwendung eines Windowsrechners, indem Sie die Tastenkombination Strg + f nutzen. Unter Mac OS hilft Ihnen die Tastenkombination command + f weiter. In das anhand der Tastenkombination aufgerufene Suchfenster können sie nun den Suchbegriff eingeben und mit den Pfeilen neben dem Eingabefeld innerhalb der Suchergebnisse nach oben und unten navigieren.
Sie wollen wissen, was wir unter folgenden Begriffen verstehen?
Klicken Sie sich gern durch die Begriffsliste und lassen Sie sich von den Verknüpfungen weiterleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Aneignung
- Anerkennung
- Bedürfnis
- Beziehung
- Bindung
- Diagnostik
- Differenz
- Emotionen
- Entwicklungspläne
- Exklusion
- Fall
- Fehler und Fehlerkultur
- Gleichheit
- Gruppe und Gruppenmerkmale
- Heimlicher Lehrplan (Hidden Curriculum)
- Heterogenität
- Inklusion
- Integration
- Interesse
- Isolation
- Kompetenz
- Konzepte
- Kooperation
- Leistung
- Lebenswelt
- Lerngegenstand
- Lernpfad
- Lernziele
- Macht
- Motivation
- Partizipation
- Perspektive
- Pygmalion-Effekt
- Reflexion
- Resilienz
- Restorative (Practice) Approach
- Selbstwirksamkeit
- Sinn und Bedeutung
- Sozialform
- Soziale Interdependenz
- Stereotyp
- Subjektorientierung
- Systemische Perspektive und Denkweise
- Teilhabe
- Themenzentrierte Interaktion (TZI)
- Unterrichtsstörung
- Verstehende Perspektive
- Verinnerlichung
- Vielfalt
- Vorurteil
- Zone der aktuellen Entwicklung
- Zone der nächsten Entwicklung
- Zone der vergangenen Entwicklung
- Zugang
Aneignung
"Lernen beim Menschen ist seinem Wesen nach Aneignung menschlicher Erfahrungen, gesellschaftlicher Kultur und führt zur Herausbildung bzw. Weiterentwicklung psychischer Funktionen und funktioneller Organe". (Lompscher 2004: 173f.)
Aneignung ist der Prozess der zunehmenden Verinnerlichung von Fähigkeiten und Wissen. Also das Erlernen gesellschaftlicher Bedeutungen eines Gegenstands sowie die notwendigen Techniken zur Anwendung (Zeichen/ Sprache etc.) (Ziemen 2018: 52). Da Lernen immer in einem Dialog stattfindet, erfolgt auch die Aneignung im Dialog (Ziemen 2018: 51). Dialog umfasst dabei jegliche Form des Austausches zwischen Menschen. Für Aneignung bedarf es demnach Austausch über den Gegenstand zwischen den Lernenden sowie die direkte oder indirekte Auseinandersetzung mit diesem (Ziemen 2018, 52).
Im Prozess der Aneignung wird der Mensch befähigt, den Gegenstand entsprechend der gesellschaftlichen Bedeutung und Nutzung anzuwenden. Dazu kann z.B. die Handhabung einer Kreissäge, Verhaltensregeln im Theater, der Schriftspracherwerb oder das mathematische Lösen von Problemen.
In Abgrenzung zum Begriff Lernen beschreibt Aneignung immer einen Prozess, in dem Neues langfristig aufgenommen und die Denk- und Handlungsstruktur eines Menschen integriert wird. Lernen hingegen kann auch nur die kurzfristige Aufnahme von (trägem) Wissen umfassen, welches nicht in die Denk- und Handlungsstruktur eines Menschen aufgenommen wird.
Anerkennung
Der Begriff der Anerkennung ist nicht leicht zu definieren. Da er sich über verschiedene Ebenen, Dimensionen und Sphären hinweg entfaltet (Balzer, Ricken 2010). Zudem hat er mit einigen Gegensätzlichkeiten zu kämpfen (z. B. Boger 2020 oder Balzer 2019). Vereinfacht kann man davon ausgehen, dass Anerkennung als "Voraussetzung und Triebwerk von Bildung" (Stojanov 2006: 168f) verstanden wird. Das meint, wenn ein wertschätzender Umgang in Lehr-Lern-Settings fehlt, sind Lernen und Entwickeln nur eingeschränkt möglich.
Es soll nicht tiefgründig auf den mehrdimensionalen Anerkennungsbegriff eingegangen werden. Aber mindestens zwei komplexere Punkte sind im Bezug auf Anerkennung wichtig.
Erstens: Jedes Handeln stellt beabsichtigt oder unbeabsichtigt auch ein Wahrnehmen, Bewerten oder Berechtigen dar (Balzer, Ricken 2010: 73). All dies sind Formen von Anerkennung, die jedoch selten als solche reflektiert werden.
Zweitens: Anerkennung ist nie nur positiv mit Wertschätzung gleichzusetzen (ebd.). Denn:
- Anerkennung kann verweigert werden.
- Der Anerkennungsprozess kann zu einem negativen Ergebnis und im Anschluss zu einem Ab- statt Wertschätzen führen.
- Anerkennung kann verkennen und das Gegenüber als etwas wahrnehmen, das es gar nicht ist oder sein will.
- Anerkennung ist immer mit Macht verbunden und kann daher statt Differenzen wahrzunehmen und wertzuschätzen, diese auch weiter in Selbst- und Weltverhältnisse einschreiben. (ebd.)
Im Fundus Inklusion ist Anerkennung als grundsätzliche Haltung zu verstehen, die mit der Verstehenden Perspektive einhergeht. Menschen sollten immer als Menschen mit unveräußerbarer Menschenwürde und Menschenrechten anerkannt werden. Das danach zueinander aufgebaute Verhältnis sollte auf einem ehrlichen Interesse sowie einer respektvollen Kommunikation gründen. Das Ziel sind gegenseitige Wertschätzung und die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe für jedes Individuum. Dies wird manchmal als "Kuschelpädagogik" fehlinterpretiert. Jemanden als Menschen anzuerkennen, bedeutet nicht, ihm alles durchgehen zu lassen. Ein wertgeschätzter Mensch kann nichtsdestotrotz Handlungen vollziehen, die abzulehnen und als solche z. B. anhand des Restorative Approaches zu verhandeln sind.
Im Fundus Inklusion können Sie anerkennende Ansätze überall wiederfinden. Aber vor allem ein Blick in die Fallbeispiele zu Beziehungen und Emotionen sowie die entsprechenden Materialseiten können zeigen, welche Rolle Anerkennung in Lehr-Lern-Settings spielt.
Bedürfnis
“Das Bedürfnis als eine immanente Kraft des lebenden Organismus verbindet das Lebewesen mit der Welt und fordert, dass eine bestimmte Handlung in der Welt ausgeführt wird, die für den Erhalt und die Entwicklung sowohl des Individuums als auch der Gattung notwendig ist.” (Leont’ev 2013: 192)
Bedürfnisse können demnach als grundlegender Motor für die Verbindung zwischen Menschen und Umwelt angesehen werden (Leont’ev 2013:187). Sie bestimmen unsere Interessen und motivieren zu Handlungen. Dabei beziehen sich Bedürfnisse nicht nur auf jene Handlungen, die der Aufrechterhaltung funktionaler Lebensbedingungen (Schlafen, Essen, Trinken) dienen. Auch Gefühle nach Verbundenheit, soziale Anerkennung in Gruppen, Selbstwirksamkeit und Entwicklung sind grundlegende menschliche Bedürfnisse (Deci/ Ryan 1993: 229).
Bevor Bedürfnisse jedoch konkrete Handlungen hervorrufen, existieren sie als “eine diffuse Form, als Verhaltensvorläufer [...] die noch weiter konkretisiert und kanalisiert werden muss” (Leont’ev 2013:187 mit Verweis auf Nuttin 1984: 65f.). Erst, wenn das Bedürfnis auf einen Gegenstand trifft, der zu dessen Befriedigung sinnvoll erscheint, konkretisiert sich das Bedürfnis und der Gegenstand wird zum Motiv der Handlung (Leont’ev 2013: 198).
“Ein Bedürfnis, das noch nicht auf ein Objekt bezogen ist, kann man nicht als echtes Bedürfnis bezeichnen. Es "findet" oder "trifft" sein Objekt erst noch in der Welt, und nach diesem Zusammentreffen und "Erkennen" wird das Objekt zum Motiv einer bewussten Handlung.” (Leont’ev 2023: 198)
Menschliches Verhalten ist dabei nicht nur von einem Bedürfnis bestimmt, sondern fußt meist auf mehreren Motiven (Leont'ev 2013:193). Das, was den Menschen antreibt, setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen (Werte, individueller Erfolg, Selbstwirksamkeit, Anerkennung in einer Gruppe) (ebd.). Die Orientierung des menschlichen Verhaltens entlang von Bedürfnissen ist angeboren (Leon’t 2013: 187 mit Verweis auf Nuttin 1984:78). In Abhängigkeit der Lebenserfahrungen, Lern- und Entwicklungsprozessen und Lebensumständen konkretisieren sich Bedürfnisse und die Objekte, die als sinnhaft wahrgenommen werden (ebd.). Das bedeutet, dass sich ähnliche Bedürfnisse aufgrund unterschiedlicher Lebensbiografien an unterschiedlichen Gegenständen konkretisieren und verändern können (ebd.; Steffens 2019: 40).
Für Lehr-Lern-Settings ergibt sich daraus zum einen, dass Bedürfnisse der Lernenden nur zu einem gewissen Grad antizipiert werden können, da nicht endgültig bestimmt werden kann, welcher Lerngegenstand ein Bedürfnis erfüllt. Zum anderen bedeutet es, dass verschiedenen Lernende verschiedene Zugänge zu einem Gegenstand benötigen, um die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung für sich individuell zu erkennen. Mit Hilfe einer Verstehenden Perspektive können mögliche Bedürfnisse identifiziert und entsprechende Zugänge entwickelt werden, damit Motivation und Sinn entstehen und Lernen und Entwicklung möglich wird. Dabei kann die erfolgreiche Bedürfnisbefriedigung als Übergang in die Zone der nächsten Entwicklung verstanden werden. Denn das Bedürfnis kann in der Zone der aktuellen Entwicklung nicht allein und ohne Hilfe befriedigt werden. Es bedarf dafür die Aneignung von Neuem mit Unterstützung von außen.
Beziehung
Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden werden meist als spezifische Beziehungsform gegenüber persönlichen Beziehungen abgegrenzt. Soziologische Argumentationen gehen häufig davon aus, dass das "Moment der personellen Unersetzbarkeit" (Lenz 2008: 688 Hervorhebung im Original), die "Fortdaueridealisierung" (ebd.: 689 Hervorhebung im Original), das persönliche Wissen, die gefühlsbegründete Bindung sowie die starke wechselseitige Abhängigkeit (ebd.) anders, schwächer oder gar nicht in Lehr-Lern-Beziehungen ausgeprägt sind (Diers 2016: 122ff).
Im Hinblick auf die "personell[e] Unersetzbarkeit" (Lenz 2008: 688 Hervorhebung im Original) muss festgehalten werden, dass die Beteiligten einer pädagogischen Beziehungen sehr wohl unersetzbar sind. Denn anhand der Verstehenden Perspektive muss davon ausgegangen werden, dass die Spezifik der Beziehung mit den konkreten beteiligten Personen einhergeht.
Der größte Unterschied zwischen persönlicher und pädagogischer Beziehung ergibt sich durch die Beständigkeit. Denn der Fortbestand der Lehrerenden-Lernenden-Beziehung ist auf die Dauer der Schulzeit (Diers 2016: 124) bzw. den Verbleib an der selben Institution festgeschrieben. Im Gegensatz zu persönlichen Beziehungen, denen eine Fiktion der Ewigkeit innewohnt (Lenz 2008: 688).
Persönliches Wissen und gefühlsbegründete Bindung sind in pädagogischen Beziehungen vorhanden, aber anders als in persönlichen Beziehungen geartet und oft hierarchisch geprägt. Prengel betont zudem die persönliche, lebensgeschichtliche Bedeutsamkeit von Lehr-Lern-Beziehungen (Prengel 2013b: 10). Diers betont jedoch, dass diese Bedeutsamkeit vor allem einseitig von den Lehrenden ausgeht (Diers 2016: 123). Somit wird die pädagogische Beziehung als spezifische Arbeitsbeziehung charakterisiert (Prengel 2013b: 19).
Der Einfluss von pädagogischen Beziehungen ist weitgehend unstrittig, denn Menschen "sind in ihrer Entwicklung auf Beziehungen angewiesen" (Baldus 2013: 285). Beziehungen "können uns zu größerer persönlicher Autonomie [...] verhelfen, aber auch Entwicklungsspielräume eingrenzen und Entfaltungsmöglichkeiten verhindern" (Prengel 2013b: 10), wenn sie negativ konnotiert sind. "Ein ernsthaftes Bemühen um eine gelingende, wertschätzende, nichtdiskriminierende Beziehung zu jedem [E]inzelnen [...], stellt deshalb [...] für das gesamte soziale Klima und Beziehungsgefüge einer Gruppe ein zentrales Merkmal pädagogischer Professionalität dar.“ (Baldus 2013: 288) Vielfach wird daher betont, dass gerade auf als störend wahrgenommenes Verhalten mit positiv konnotierten Beziehungsangeboten ausgehend von den Lehrpersonen reagiert werden muss (Hoffmann 2009: 232; Amrhein, Badstieber, Schroeder 2022: 264).
Lehr-Lern-Beziehungen haben sowohl eine individuelle, wie auch gesellschaftliche Tragweite, nicht nur in einzelnen Bildungssituationen, sondern auch weit über die Schulzeit hinaus (Prengel 2013b: 9). Der Reflexion dieser pädagogischen Beziehungen kommt daher eine wichtige Rolle "für die Entfaltung und Sicherstellung einer qualitativ orientierten, inklusiven Pädagogik" (Baldus 2013: 289) zu.
Mehr zur Rolle pädagogischer Beziehungen finden Sie im Fundus Inklusion in den Fallbeispielen zu Beziehungen sowie im Material Beziehungen gestalten.
Bindung
Das Bindungsbedürfnis ist eng mit der Bindungstheorie nach John Bowlby, James Robertson und Mary Ainsworth verbunden. Hinter dem Bedürfnis nach Bindung steckt der evolutionsbiologisch begründete Wunsch, eine enge und überdauernde emotionale Beziehung zu einer vermeintlich kompetenteren Person zu etablieren und zu bewahren (Bowlby 1975, 1976).
Bindungsbeziehungen ermöglichen neuronales Wachstum sowie das Erlernen von Strategien zum Umgang mit Emotionen (Grawe 2004: 196f). Daher sind Bindungen auch für Lern- und Entwicklungsprozesse zentral und werden diesbezüglich vielfach als zentrale Gelingensbedingung angesehen (Prengel 2013a: 176; Hoffmann 2009: 303).
Die Qualität früher Bindungen ist dabei "entscheidend dafür, was wir dann von anderen Menschen erwarten und für die Art, in der wir uns ihnen und unserer äußeren Umwelt annähern." (Prengel 2013b: 41) Die gemachten Erfahrungen können es somit erleichtern oder erschweren folgende Bindungs- und auch Bildungsangebote anzunehmen (Schuster 2020: 44ff; Hoffmann 2009: 232). Vielfach wird daher betont, dass gerade Lernende, deren Verhalten als störend wahrgenommen wird, auf positiv konnotierte Bindungs- und Beziehungsangebote durch die Lehrperson angewiesen sind (Hoffmann 2009: 232; Amrhein, Badstieber, Schroeder 2022: , 264). Dies kann helfen, "deren Verhalten durch positive Beziehungserfahrungen zu verändern und damit Bildung überhaupt erst zu ermöglichen." (Hoffmann 2009: 232)
Diagnostik
Der Begriff der “Diagnostik” kommt aus dem Griechischen und kann im weitesten Sinne als “Erkenntnisgewinnung” beschrieben werden. (Lanwer 2006: 8). Der Begriff wird von vielen verschiedenen Professionen verwendet, z. B. der Medizin, Psychologie oder Pädagogik. Je nach Profession und auch innerhalb einer Profession kann sich das Verständnis unterscheiden. So ist für die Pädagogik festzustellen, dass es ein pädagogisches und ein sonderpädagogisches Verständnis gibt. Ersteres ist eher geprägt duch die pädagogische Psychologie, letzteres orientiert sich an einem medizinisch und psychologischem Verständnis (Langner, Frank, Friebel et. al. 2022). Unterschiede in den Verständnissen zeigt sich bspw. in der Art der Datenerhebung, in der Auswertung so wie in den Ableitungen für die pädagogischen oder (mit einem medizinischen Verständnis) therapeutischen Maßnahmen (ebd.) So ist ein Unterschied darin auszumachen, ob ein Mensch in einem diagnostischen Prozess an einer Norm gemessen wird (medizinisch und auch psychologisches Verständnis) oder sich Diagnostik "im Sinne der Betroffenen [...] auf deren Bedürfnisse, Fähig- und Fertigkeiten und Potentiale" (Ziemen 2016: 40) bezieht, wie für die pädagogische Diagnostik festzuhalten ist. Für die pädagogische Diagnostik gilt ebenfalls:
„Pädagogische Diagnostik umfasst alle diagnostischen Tätigkeiten, durch die bei einzelnen Lernenden und den in einer Gruppe Lernenden Voraussetzungen und Bedingungen planmäßiger Lehr- und Lernprozesse ermittelt, Lernprozesse analysiert und Lernergebnisse festgestellt werden, um individuelles Lernen zu optimieren.“ (Ingenkamp, Lissmann 2008: 13)
Nach Ziemen (2016) ist die "Zone der vergangenen Entwicklung" (Ziemen 2003) sowie die "Zone der aktuellen Entwicklung" und die "Zone der nächsten Entwicklung" (Wygotski 1987) zu bestimmen.
So sind Methoden, die in der pädagogischen Diagnostik Anwendung finden sollten, nicht nur Tests, sondern auch (fokussierte) Beobachtungen oder diagnostische Interviews bzw. Gespräche. Diese sollten lernprozessbegleitend stattfinden. Mehr zu Methoden, die in einer lernprozessbegleitenden Diagnostik Anwendung finden, erfahren Sie im Erklärvideo "Die Verstehende Perspektive vermitteln".
Differenz
Differenz meint im erziehungswissenschaftlichen Zusammenhang meist Unterschied und ist daher stark mit dem Begriff der Heterogenität verknüpft. Denn Vielfalt entsteht durch Unterschiede. Seit Mitte der 90er Jahre wird das Thema Differenz verstärkt im erziehungswissenschaftlichen Kontext diskutiert (Mecheril, Plößer 2009: 194). Unterschiedliche Denkschulen (ebd.) und pädagogische Teildisziplinen (Diehm, Kuhn, Machold 2017: 1) haben sich seither mit den Macht-, Diskriminierungs-, Reproduktions-, Identitäts- und Anerkennungsaspekten im Zusammenhang mit Differenz auseinandergesetzt.
Insofern geht es mit Bezug auf das Verhältnis von Differenz und Pädagogik nicht um die Frage: »Differenz: ja oder nein«, sondern um eine erfahrungsbezogene Reflexion darauf, wie Differenzen pädagogisch so thematisiert werden, dass als Konsequenz dieser Thematisierung weniger Macht über andere erforderlich ist. (Mecheril, Plößer 2009: 206)
Nach Gosepath (2010) ist Gleichheit (und somit auch Differenz (Dederich 2013) eine Beziehung zwischen drei Punkten, bestehend aus den zwei vergleichenden Aspekten und einem Vergleichskriterium. Das herangezogene Vergleichskriterium lässt eine Einstufung in gleich oder ungleich zu (Gosepath 2010: 920, zit. nach Dederich 2013: 123).
Dederich (2013) führt den Begriff der “relativen Differenz” ein. Die relative Verschiedenheit bezieht sich “auf ein übergreifendes, die Vergleichs- und Unterscheidungsmerkmale lieferndes Ordnungsgefüge (etwa: Herkunft, die Sprache oder die Kultur)” (ebd.: 124). Daher sollten in Lehr-Lern-Kontexten Fragen nach der Herstellung von Differenz und die pädagogische Relevanz von Differenzlinien hinterfragt werden. Zur Reflexion von “gleich/ungleich” und “normal/unnormal” bietet der Fundus Inklusion ein Material an.
Emotionen
Emotionen sind allgegenwärtig und ein Leben ohne sie ist undenkbar. Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit existieren zahlreiche unterschiedliche Auffassungen, Definitionen und Konzepte, die das Konstrukt "Emotion" zu fassen versuchen. Innerhalb des Fundus Inklusion verstehen wir Emotionen als dynamische und komplexe Prozesse, die bewusst oder unbewusst das Verhalten, die Wahrnehmung sowie die Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt beeinflussen. Vor diesem Hintergrund sind Emotionen mit Lehr-Lern-Prozessen untrennbar verbunden, da sie das Gehirn - metaphorisch gesprochen - für neue Sinneseindrucke, Lern- und Entwicklungsprozesse öffnen oder auch schließen (Steffens 2022).
Entwicklungspläne
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Exklusion
Das Projekt QuaBIS hat Exklusion definiert. Erfahren Sie mehr hier.
Fall
Ein Fall ist eine Situation oder ein Problem, das sich in einem berufsbezogenen Kontext ergibt. Generell gilt, dass alle Situationen, die mit Ihrem Beruf zu tun haben, zu einem Fall werden können. In Bezug auf die Kollegiale Fallberatung schreiben Bennewitz & Daneshmand (2010): "Entscheidend sind vor allem eine persönlich wahrgenommene Unzufriedenheit, subjektives Problemempfinden und der Wunsch, eine Änderung herbeizuführen" (ebd.: 66). Während der Arbeit mit einem Fall, bspw. während der Kollegialen Fallberatung, wird an bedeutsamen Fragen gearbeitet (Dlugosch 2006), z.B. „Wie kann ich den Schüler unterstützen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen?“
Im Fundus Inklusion wurden umfangreiche Fälle formuliert und reflektiert. Eine Sammlung aller Fälle finden Sie hier.
Fehler und Fehlerkultur
"Von einem Fehler ist die Rede, wenn eine Aussage, ein Sachverhalt oder ein Prozess von einer bereits etablierten Norm abweicht" (Prediger, Wittmann 2009). Bei einer potentialorientierten und von Wertschätzung geprägten Fehlerkultur sollte es nicht darum gehen, die Lernenden anhand ihrer Fehler bloßzustellen oder sie dafür zu bestrafen. Fehler haben vor allem das Potential, Aufschluss über individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse zu geben.
Gleichheit
Gleichheit ist kein triviales Wort. Nach Gosepath (2010) ist Gleichheit eine Beziehung zwischen drei Punkten, bestehend aus den zwei vergleichenden Aspekten und einem Vergleichskriterium. Das herangezogene Vergleichskriterium lässt eine Einstufung in gleich oder ungleich zu (Gosepath 2010: 920, zit. nach Dederich 2013: 123).
Einerseits sind wir alle gleich in dem Punkt, dass wir Menschen mit unveräußerlichen Menschenrechten sind. Dies gilt es anzuerkennen und das pädagogische Handeln daran auszurichten. Andererseits sind wir jedoch alle auch ungleich. Denn die Menschheit ist heterogen. Dies hat weitreichende pädagogische Konsequenzen, denn “Gleichbehandlung bei gegebenen Unterschieden und ungleichen Startbedingungen” (Mecheril, Plößer 2009: 197) führt zu einer Reproduktion der ungleichen Bedingungen und zu Benachteiligung. Bekannt geworden ist die Karikatur von Hans Traxler (1975), die diesen Umstand anhand von Tieren illustriert, die trotz ungleicher Voraussetzungen alle die gleiche Prüfung absolvieren sollen. Eine vielfaltssensible Bildung und eine Verstehende Perspektive auf die Lernenden ist daher zentral, um sowohl der Gleichheit, als auch der Unterschiedlichkeit Rechnung zu tragen und so Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.
Bildnachweis: Traxler, Hans: Chancengleichheit. In: betrifft: erziehung. Jahrgang Juli 1975.
Gruppe und Gruppenmerkmale
Gruppenarbeitsphasen stellen eine mögliche Sozialform in Lehr-Lern-Settings dar. Eine Gruppe kann als soziales System betrachtet werden, bei dem mindestens zwei Personen eine Einheit bilden und in einer Beziehung zueinander stehen. Wenngleich der Gruppenbegriff in sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen unterschiedlich definiert wird, zeichnen sich dennoch in den Theorien wiederkehrende Merkmale von Gruppen ab (Krieger 2003: 66)
-
die relative Häufigkeit der Interaktion
-
ein Wir-Gefühl (Gruppenbewusstsein)
-
gemeinsame Ziele
-
gruppenspezifische Normen
-
eine bestimmte Gruppenstruktur
-
Gegenseitige Verhaltenssteuerung
-
Arbeitsteilige Spezialisierung
-
Rollendifferenzierung
Daneben ist der Gruppenbegriff nicht unproblematisch, weil durch das Zusammenfassen von Individuen zu vermeintlich homogenen Gruppen leicht die Individualität, Heterogenität sowie Mehrfachzugehörigkeiten der einzelnen Gruppenmitglieder übersehen werden. Auch Vorurteile haben durch die Verknappung realer Komplexität auf Gruppenzugehörigkeiten leichteres Spiel.
Heimlicher Lehrplan (Hidden Curriculum)
Der heimliche Lehrplan bildet den Gegensatz zu den offiziellen, schriftlich festgehaltenen Lehrplänen der Bundesländer (Tenorth, Tippelt 2007: 313). Durch den heimlichen Lehrplan finden teilweise unbemerkt oder unbeabsichtigt "z. B. Geschlechterstereotype, Verhalten im Umgang mit Hierarchien, Benimm-Regeln, Muster der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Leistungsbilder etc." Eingang in den Schulalltag und werden pädagogisch wirksam (ebd., Hervorhebung im Original). "Er wird [..] problematisiert, weil er auch gesellschaftliche Strukturen bzw. nicht-akzeptable Normen und Werte sowie Verhaltensstile unreflektiert erzeugt und reproduziert." (ebd.)
Heterogenität
In pädagogischen Kontexten wird Heterogenität oft als Synonym zu den Begriffen Verschiedenheit, Vielfalt oder Differenz genutzt (Trautmann, Wischer 2011: 38). Als Gegenpol zur Heterogenität wird häufig der Begriff Homogenität genutzt. Heterogenität stellt “ein ebenso zentrales wie komplexes und theoretisch noch weiter zu klärendes Phänomen dar, welches sich nur schwer näher bestimmen lässt. Heterogenität wird entsprechend auch als ‘fuzzy concept’ bzw. ‘Containerbegriff’ bezeichnet” (Budde 2017: 14).
Da Vielfalt keinen Gegenpol hat (wie es etwa bei Heterogenität-Homogenität sowie Ungleichheit-Gleichheit der Fall ist), ist der Begriff Vielfalt darum positiver besetzt und wird auch im Fundus häufig(er) verwendet. Die Vielfalt der Lernenden bezieht sich nicht nur auf ihre unterschiedlichen ethnischen, kulturellen, sprachlichen und sozialen Hintergründe, sondern unter anderem auch auf ihre individuellen Interessen, Bedürfnisse, Erfahrungen und Aneignungsvorlieben, welche vor allem in inklusionssensiblen Lehr-Lern-Kontexten Beachtung finden (Walgenbach, 2014).
Inklusion
Mit unserem Verständnis von Inklusion haben wir uns umfänglich auseinandergesetzt. Lesen Sie auf der Seite "Inklusion - Wer? Wie? Was?" was Inklusion im Fundus bedeutet.
Ein Blick lohnt sich auch in das Inklusion Lexikon, für das Kerstin Ziemen Inklusion definiert hat. Zum Artikel geht es hier.
Integration
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Interesse
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Isolation
Isolation wird gefasst als ein "Getrennthalten von Dingen, Prozessen, Individuen oder Institutionen" (Jantzen, Meyer 2014: 38), abgeleitet aus dem lateinischen Wort isola, das Insel bedeutet. Im ’aktiven’ Sinn wird durch Isolation also "etwas zur Insel [gemacht]" (ebd.: 38). Im weiteren Sinne versteht Jantzen (1979) Isolation folgendermaßen:
Isolation trennt das Individuum als je konkret-historisches von der umfassenden Aneignung des gesellschaftlichen Erbes, von der umfassenden Realisierung seines menschlichen Wesens als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Isolation meint damit die Stoffwechselprozesse des menschlichen Individuums mit Natur und Gesellschaft durch Arbeit und Kooperation. Sie ist als Störung der Widerspiegelungs-, Aneignungs- und Vergegenständlichungsprozesse im innerorganismischen Bereich wie im Verhältnis zur objektiven Realität in Natur und Gesellschaft zu begreifen (ebd.: 36).
Bereits 1964 verband Haggard (1964) diesen Begriff mit persönlichkeitstheoretischen Aspekten. So soll sich jede Art der Isolation abhängig von zeitlichen und qualitativen Faktoren unterschiedlich stark auf Bereiche der Persönlichkeit auswirken. Angefangen bei der Umgestaltung der Wahrnehmung kann diese letztlich zur Veränderung der affektiven Selbstregulation führen. M.a.W. lässt sich Isolation „als Abwesenheit, Mangel, Störung oder Beeinträchtigung [des] lebensnotwendigen (sozialen) Austauschs mit der Umwelt charakterisieren“ (Steffens 2019, S. 55). Ist der Austausch des Menschen mit der Umwelt gehemmt oder gar nicht möglich, kann Lernen und somit Entwicklung nicht stattfinden.
Ist der Austausch des Menschen mit der Umwelt gehemmt oder gar nicht möglich, kann Lernen und somit Entwicklung nicht stattfinden.
Wenn es also gelingt, in Lehr-Lern-Kontexten Isolation zu erkennen, zu verstehen und zu vermeiden, kann das als eine Stellschraube für die Gestaltung inklusionssensibler Lernumgebungen fungieren (Jugel & Steffens 2019; Langner & Jugel 2019; Friebel, Matusche, Wesemeyer 2022). Indikatoren für Isolation stellen verschiedene Verhaltensweisen dar, sogenannte Kompensationsformen. Steffens (2019) hat diese Kompensationsformen systematisiert, sodass sie für diagnostische Prozesse in Lehr-Lern-Kontexten (Erklärvideo Verstehende Perspektive) genutzt werden können. Im Erkennen möglicher Kompensationsformen liegt ein wesentlicher Schlüssel zur Gestaltung inklusionssensibler Lehr-Lern-Setting.
Kompetenz
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Konzepte
Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens verschiedene Erklärungsmodelle für das, was um sie herum geschieht (Sander 2009: 57). Diese Erklärungsmodelle werden als Konzepte bezeichnet und können als gedankliche “Werkzeuge, mit deren Hilfe wir in der Welt sinnfällig handeln können” verstanden werden (Kron 1999: 78 nach Atkinson 1990: 321). Konzepte schaffen gedankliche wie begriffliche Klarheit hinsichtlich existierender Phänomene, stattfindender Prozessen und Beziehungen (Kron 1999: 78). Sie sind zum Teil hierarchisch geordnet und bedingen sich gegenseitig (Sander 2009:58). Beispielsweise kann das Konzept zu “Macht” das Konzept zum Thema “Gerechtigkeit” beeinflussen.
Konzepte entstehen, indem Menschen Bedeutungen und Handlungsweisen verschiedener gesellschaftlicher Güter verinnerlichen (ebd.). Mit Hilfe dieser verinnerlichten Informationen können dann, individuell wie kollektiv, Erklärungsansätze entwickelt werden. Die Entwicklung von Erklärungsansätzen ermöglicht Menschen handlungsfähig zu sein, also aktuelle Ereignisse verstehen sowie zukünftige Handlungen planen zu können (ebd). Konzepte bestimmen und prägen nicht nur unser Verhalten. Sie nehmen auch entscheidenden Einfluss darauf, wie Phänomene beurteilt werden.
Da die Entwicklungen von Konzepten kontext- und informationsabhängig ist, kommt es häufig zur Ausbildung verschiedener Konzepte für das gleiche Phänomen. Also das Erklärungsmodell ein und derselben Situation kann bei zwei verschiedenen Personen unterschiedlich aussehen.
Ein Beispiel: Es ist Bundestagswahl. Die Eltern diskutieren hitzig darüber, welche Parteien einziehen werden und welche an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Zwischen den Wahlprognosen läuft Sport - Springreiten im Fernsehen. Das Kind verfolgt neugierig die Debatte der Eltern und das Fernsehen. Das Erklärungsmodell für das Konzept “Bundestagswahl” wird dadurch beeinflusst und besteht viele Jahre aus der Annahme, dass bei der Bundestagswahl Parteien im Springreiten antreten.
Dieses Beispiel mag durchaus extrem erscheinen. Es macht jedoch deutlich, wie schnell Konzepte entwickelt werden und wie Erklärungsversuche stattfinden, welche die Wirklichkeit nicht abbilden. Für Lern- und Entwicklungsprozesse muss demnach nicht nur identifiziert werden, welche Konzepte bei den Lernenden zu Phänomenen vorherrschen, um anschlussfähig zu sein (Sander 2009: 58). Es muss auch darauf geachtet werden, dass neue Konzepte und dazugehörige Informationen das Phänomen in seiner Gesamtheit wiedergeben.
Kooperation
Kooperation bedeutet Zusammenarbeit und gilt „als zentrale Gelingensbedingung für die Entwicklung von Schule sowie pädagogischer Professionalität“ (Baum, Idel, Ulrich 2012: 9). Insbesondere für die Entwicklung einer inklusiven Schule und den Umgang mit Heterogenität ist sowohl die Kooperation zwischen Lehrenden, die Kooperation der Lernenden und auch die Kooperation von Bildungsinstitutionen zentral (Werning, Arndt 2013: 9). Kooperation bringt nicht nur wertvolle Synergieeffekte mit sich, sondern auch Entlastung für Lehrende (Wessel 2005: 10) und fördert kognitives und soziales Lernen von Lernenden (Leuders 2006: 1). Oft fehlen strukturelle Einbettungen von Kooperation und damit auch die zeitlichen Ressourcen (Werning, Arndt 2013: 34).
Leistung
Leistung wird in Bildungskontexten häufig als die zentrale Währung verstanden (Rabenstein, Reh, Ricken, Idel 2013: 675). In diesem Sinne dient das Wort in unseren Texten als Irritationsauslöser, welcher zum Weiterlesen und zur anschließenden Reflexion anregen soll. Denn Leistung und Inklusion stehen in einem nicht zu verschweigenden Spannungsverhältnis (Streese, Schiermeyer-Reichl, Meyer et al. 2017: 123; Dietrich 2017) zwischen Hierarchisierung und Selektion einerseits und gleichberechtigter Teilhabe aller andererseits. Mit diesem Dissens umzugehen, ist eine der zentralen Herausforderungen von Bildung.
"Wenn Leistungshierarchien thematisiert werden, zum Beispiel in Situationen der Trauer um unerreichte Leistungsziele, [...] ist es klärend, auch die egalitär-universelle Bezugsnorm der unverlierbaren Menschenwürde und die individuell-kriteriale Bezugsnorm des einzigartigen kreativen Beitrags eines jeden Mitgliedes der Klasse oder Gruppe zu betonen." (Prengel 2017: 16) Außerdem binnendifferenziert und anerkennend bei der Leistungserhebung und -beurteilung vorzugehen (ebd.: 15-25), löst den bestehenden Widerspruch zwar nicht auf (Dietrich 2017: 197), lässt jedoch eine Atmosphäre der "Selbstsorge und der Sorge für andere [..] entstehen, in der emotionales, soziales und kognitives Lernen einander stützen und steigern" (Prengel 2017: 24f) kann.
Weiterführender Buchtipp:
- Textor, Annette / Grüter, Sandra / Schiermeyer-Reichl, Ines et al. (Hrsg.) (2017): Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft. Band 2. Unterricht, Leistungsbewertung und Schulentwicklung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2017, S. 121-129. Link zum OpenSource-Dokument
Lebenswelt
Lebenswelt kann als “die je subjektiv wahrgenommene Welt eines Menschen bezeichnet werden [...]. In diesem Sinne lässt sich formulieren, dass der Mensch seine Lebenswelt unter den jeweiligen Bedingungen seiner Lebenslage konstruiert” (Kraus 2006).
Diesem Gedanken folgend beschreibt Lebenswelt die real existierenden Lebensbedingungen eines Menschen, wie bspw. die Wohnsituation, Zugänge zu verschiedenen materiellen und immateriellen Gütern sowie Familienkonstellationen. Diese nehmen Einfluss darauf, wie Menschen ihre Lebenssituation und Gestaltungsmöglichkeiten subjektiv wahrnehmen. Bedeutsam ist in diesem Kontext demnach die individuelle Wahrnehmung und Einschätzung der aktuellen Lebensumstände und damit zusammenhängende Fragen, Probleme und Interessen (Kraus 2006). Lebenswelt muss als individueller Zustand verstanden werden, der nicht allein von außen benannt und beschrieben werden kann. Es ist möglich, Bedingungen zu identifizieren. Jedoch können die tatsächlichen Auswirkungen und Bedeutungen der Lebenswelt nur durch das Individuum selbst formuliert werden.
Vergleichbar ist dies mit der Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit. Menschen nehmen die Realität nur als subjektive Wirklichkeit wahr, die nicht immer mit der Wahrnehmung anderer übereinstimmen muss (Kraus 2006). Ähnliche oder gleiche Faktoren können in der Lebenswelt unterschiedlich positiv oder negativ wahrgenommen werden.
Lerngegenstand
Lernen muss als Prozess verstanden werden, bei dem Lernende ihre Handlungsfähigkeit erweitern. Sie verinnerlichen neues Wissen und neue Fähigkeiten, die sie ermächtigen, Bedürfnisse zu erfüllen und in ihrer Umwelt zu agieren (Lompscher 2004: 50; Sasse, Schulzeck 2021: 58ff). Lernprozesse finden immer und überall statt. Das bedeutet, dass alles, was Menschen umgibt, potenzieller Lerngegenstand sein kann. Für institutionalisierte Lern- und Entwicklungsprozesse kann auf diese Fülle an Lerngegenständen zugegriffen werden (Sasse, Schulzeck 2021: 65). Lerngegenstände können zwar konkrete Gegenstände sein, sollten jedoch eher als komplexe Situationen, Fragen oder Prozesse gedacht werden. Statt sich bspw. mit der Funktionsweise des Bundestages zu befassen, kann die Frage in den Fokus gestellt werden, in welcher Form Mitbestimmung im demokratischen Miteinander gelingen kann.
Statt also konkrete Themen festzuschreiben, die so und nicht anders von den Lernenden gelernt werden müssen, forciert der Lerngegenstand ein Lernen, in dem Handlungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen. So kann die Auseinandersetzung mit den Gegenständen ermöglichen, das Lernende sich immer besser in der Umwelt zurechtzufinden und in dieser handlungsfähig werden (Sasse, Schulzeck 2021:66).
Georg Feuser, der das Konzept des Gemeinsamen Gegenstandes entwickelte, auf das der Lerngegenstand zurückzuführen ist, beschreibt diesen als einen “zentrale[n] Proze[ss], der hinter den Dingen und beobachtbaren Erscheinungen steht und sie hervorbringt“ (Feuser, 1989, S. 32).
Durch die verschiedenen Zugänge, Fragen und Unterthemen ermöglicht die Planung von Lehr-Lern-Settings entlang eines Lerngegenstandes nicht nur vielfältige Interessen, Bedürfnisse und Vorerfahrungen der Lernenden zu berücksichtigen. Verschiedene Themen erfordern und ermöglichen auch verschiedene Formen der Aneignung. Für inklusionssensible Lehr-Lern-Angebote sind Lerngegenstände demnach essentiell. Da sie zum einen individuelles Lernen ermöglichen. Zum anderen werden so vielfältige Aspekte eines Phänomens sichtbar und damit auch vorherrschende Zusammenhänge.
Lernpfad
Wenn im Fundus Lernpfade beschrieben werden, sind damit nicht Lern- bzw. Erkenntniswege gemeint. Bei dieser traditionellen Perspektive auf Lernen wird angenommen, dass Verinnerlichung entlang von festen, systematisierten Handlungen stattfindet. Es wird ein Lernweg für alle vorgegeben, der vom Lerngegenstand aus gedacht wird. Dieser Ansatz steht der Erkenntnis entgegen, dass Lernen und Entwicklung individuell stattfindende Prozesse sind. Das bedeutet: Lernen vollzieht sich auf individuell gestalteten und veränderbaren Lernpfaden. Diese Pfade sind abhängig von vielfältigen Faktoren und werden durch individuelle Lernerfahrungen geprägt. Lernpfade können demnach nicht vorgegeben werden. Sie können jedoch als Instrument zur Planung von Lehr-Lern-Settings genutzt werden, mit deren Hilfe “Ziele für das Lernen formuliert, und der Pfad zu jedem dieser Ziele [...] individuell „getrampelt“ werden [kann], im Sinne eines Pfades” (Langner 2023: 2). So werden die Lernenden als “bewußte [sic!], zielorientierte, aktiv[e] Subjekt[e]” angenommen (Lompscher 1992: 1). Den Lernenden sollten verschiedene Angebote zur Gestaltung des Lernpfades, entsprechend ihrer Bedürfnisse unterbreitet werden. Zum Beispiel, indem ihnen Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der Aneignungsform, der Methode oder der Sozialform gegeben werden. Je sicherer Lernende in der Gestaltung ihrer Lernpfade sind, desto offener können die Vorgaben sein. Wichtig für gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse ist dabei, dass die Lernenden selbst darüber entscheiden, wie sie ihren Lernpfad ausgestalten, ob sie ihn verlassen oder mit Lernpfaden anderer verbinden (Langner 2023: 2). Lehrpersonen unterstützen Lernende dabei, den für sich passenden Pfad zu bestimmen. Damit Lernende befähigt werden, ihre Lernpfade selbstbestimmt auch zukünftig gestalten zu können, benötigen sie Kompetenzen bezüglich:
-
der Zielformulierung (Langner 2023: 7)
-
der Identifikation von Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich des Lernziels (ebd.)
-
der Kontrolle/Überprüfung und Reflexion der eigenen Lerntätigkeit (ebd.)
-
der Evaluation des Lernprozesses (ebd.)
-
der Regulation/Anpassung nachfolgender Lerntätigkeiten (ebd.)
Lernziele
Lernprozesse können in mehrere Etappen bzw. Schritte unterteilt werden, welche wiederum unterschiedlichen Zielsetzungen zugrunde liegen. Solche Lernziele können unterschiedlich umfangreich sein und unterschiedliche Kompetenzen und Inhalte betreffen (bspw. sozial-affektiv, kognitiv, psychomotorisch). Für inklusionssensibe Lehr-Lern-Prozesse ist bedeutsam, dass Lernziele individuell sind und dass die einzelnen Lernenden je nach Aneignungsvorlieben und Lernpfaden unterschiedliche Lernziele verfolgen können. Zu Zwecken der Motivation sollten die jeweiligen Lernziele zudem für die Lernenden transparent und von persönlicher Relevanz sein.
Prozesse des Lernens können unterteilt werden in einzelne Lernziele, die der Lernende in Schritten oder in Differenzierungen leichter und nachprüfbarer erreichen kann. Lernziele können in abstrakter oder in konkreter Form formuliert werden: Leitziele, Richtziele, Grob- ziele, Feinziele (Pollack, , Helm, Reinhold 1999: 367).
Macht
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Motivation
Die Frage nach der Motivation von Menschen kann nach Leont’ev (2013) auf drei verschiedenen Ebenen betrachtet werden:
- Die Frage danach, “warum Menschen überhaupt irgendetwas tun”
- Die Frage nach einer gerade stattfindenden Handlung in einer Situation und
- Der Frage danach, warum sie Handlungen zu Ende führen
Für Lern- und Entwicklungsprozesse ist es wichtig Motivation zu erzeugen, die Lernenden dazu anregt, sich nicht nur mit dem Lerngegenstand zu befassen (2. Ebene), sondern diese Handlung auch zu Ende zu führen (3. Ebene).
Die Motivation, etwas zu tun, entsteht auf ganz basaler Ebene (1. Ebene) dadurch, dass Menschen durch ihre Handlungen versuchen, Interessen und Bedürfnisse zu erfüllen (Deci/ Ryan 1993: 229). Die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand erscheint zur Bedürfnisbefriedigung sinnvoll. Damit Lernende nun motiviert sind, in die Auseinandersetzung mit einem Gegenstand zu gehen, muss dieser sinnhaft für sie und ihre Bedürfnisse sein (Steffens 2019: 41). Dabei kann sich das Bedürfnis auch erst am Gegenstand konkretisieren (Leont’ev 2013: 198). Wenn ich bspw. politische Misstände wahrnehme, entsteht evtl. das Bedürfnis, diese zu artikulieren und mich für eine Verbesserung einzusetzen. Dieses Bedürfnis ist zunächst abstrakt vorhanden. Damit Motivation zur Handlung entsteht, bedarf es einem konkreten Gegenstand, der durch seine Bedeutung Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und somit sinnhaft wird. Beispielsweise könnte in Lehr-Lern-Settings angeboten werden, sich mit Interessenvertretungen (bspw. Gewerkschaften) zu befassen, als Ort zur Meinungsbildung und aktivem Einsatz zur Verbesserung von Verhältnissen. Der Gegenstand kann so für mich individuell sinnhaft werden, da für aktuelle Bedürfnisse (Ebene 1) eine Handlungsoption (Ebene 2) angeboten wird. Dies motiviert, sich überhaupt mit dem Gegenstand zu befassen.
Damit Ebene drei auch greift, also die Auseinandersetzung (und somit Verinnerlichung) beendet wird, braucht es das Zusammenspiel verschiedener Aspekte wie bspw. Selbstwirksamkeit, dem “wahrgenommene[n] Ort der Handlungskontrolle” (Deci/ Ryan 1993: 224 mit Verweis auf Rotter 1966) und dem Schwierigkeitsgrad (Deci/ Ryan 1993: 224). Die Auseinandersetzung muss so gestaltet sein, dass Lernende selbstbestimmt handeln, die Schwierigkeit als angemessen empfinden und Selbstwirksamkeit erfahren können. Andernfalls stellt sich eine negative Erfolgsbewertung ein und lernen wird verhindert.
In der Motivationspsychologie wird außerdem zwischen intrinsischer (sinnstiftender) und extrinsischer (reizmotivierter) Motivation unterschieden (Deci/ Ryan 1993: 224f; Leont’ev 2013: 198f). Intrinsische, also sinnstiftende Motivation entsteht dann, wenn eine Handlungsoption den Werten, Bedürfnissen und Zielen einer Person entspricht und selbstbestimmt ausgeführt wird (ebd.). Extrinsische, also reizmotivierte, Motivation hingegen entsteht durch Impulse von außen, beispielsweise durch Belohnung (Noten) oder gesellschaftliche Konventionen (Kleidungsordnung bei Anlässen) (ebd.). Die Durchführung einer Handlung basiert nicht allein auf einer selbstbestimmten Entscheidung, sondern dient der Abwehr von negativen oder dem Herbeirufen von positiven Konsequenzen (Deci/ Ryan 1993: 227). Entgegen der gängigen Annahme, müssen intrinsische und extrinsische Motivation jedoch nicht zwingend nicht als Gegensatzpaare verstanden werden (ebd. 226). Viel mehr “verstärkte sich die Vermutung, daß [sic!] auch extrinsisch motiviertes Verhalten durchaus selbstbestimmt sein kann” (ebd.) und somit Einfluss auf die Motivationsbildung nimmt.
Zu diesem Thema empfehlen wir "IN*GE liest vor - Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihrere Bedeutung für die Pädagogik" und zum selber lesen, den OpenSourc-Text.
Partizipation
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Perspektive
Der Begriff Perspektive ist für pädagogische Kontexte hoch relevant. Einerseits bezieht er sich auf die subjektive Wahrnehmung eines jeden Menschen, was grundlegend für die Sicht auf Lernende sowie Lerngegenstände ist und somit konstitutiv für Lehr-Lern-Settings. Andererseits ist damit die Fähigkeit zur Empathie (=Perspektivenübernahme) angesprochen (Tenorth, Tippelt 2007: 555), die eine wichtige Kompetenz von Lehrkräften darstellt. Sie ermöglicht es ihnen, sich gedanklich und gefühlsmäßig in Lernende hineinzuversetzen (ebd.). Durch das Nachvollziehen sind Lehrpersonen in der Lage, die Bedürfnisse, Ressourcen, Lebenswelten und Emotionen der Lernenden zu berücksichtigen (ebd.). Damit ist Empathie ein zentraler Ausgangspunkt für gelingende pädagogische Bindungen und Beziehungen.
Die Perspektivenüberhame ist eng mit Reflexionsprozessen verknüpft. Denn nur durch Reflexion können Lehrpersonen sich der Subjektivität, Selektivität und Normativität ihrer eigenen Perspektive bewusst werden und diese durch die Sichtweisen anderer erweitern.
Pygmalion-Effekt
Der Pygmalion-Effekt ist ein Versuchsleiter-Erwartungseffekt und ein psychologisches Phänomen, dass sich auch in Lehr-Lern-Kontexten positiv wie auch negativ auswirken kann. Eine Untersuchung von Rosenthal (Rosenthal & Jacobson 1968) verdeutlicht, dass sich die Erwartungen von Lehrer*innen bezüglich der Leistungen der Lernenden auf diese auswirken. Dies führt in Folge dazu, dass die Lehrenden ‘anders’ mit den Lernenden umgehen und die Erwartungen schlussendlich tatsächlich eintreffen. Ein Beispiel: Eine Lehrperson hat die Erwartung, dass bestimmte Lernende einer Lerngruppe zukünftig besonders gute Leistungen erzielen oder einen Entwicklungssprung durchleben werden. Diese Erwartungen wirken sich auf den Umgang mit den Lernenden und so auch auf ihre Leistungen aus. Es kommt tatsächlich zu einer Steigerung. Umgekehrt bedeutet dies jedoch auch, dass sich negative Erwartungshaltungen der Lehrenden hemmend auf die Lern- und Entwicklungsprozesse der Lernenden auswirken können. Umso bedeutsamer ist demnach, ein positives Bild von den Lernenden zu haben und ihnen etwas zuzutrauen. Die Entdeckung von Rosenthal und Jacobson, dass die Erwartungen anderer Personen an uns, unser eigenes Handeln beeinflussen, wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen (Rosenthal, 2002). Der Pygmalion-Effekt - häufig auch nach seinem Entdecker als Rosenthal-Effekt bezeichnet - zählt zu den psychologischen Erwartungseffekten und hängt unter anderem eng mit dem Stereotype-threat und der Self-fullfilling-prophecy zusammen.
Reflexion
Im pädagogischen Zusammenhang kann Reflexion betrachtet werden als Kompetenz, "typisch[e] Situationen des schulischen Alltags" (Leonhard et al. 2010: 114) mit Abstand betrachten zu können. Wodurch "eine eigene Bewertung und Haltung sowie Handlungsperspektiven" (ebd.) ermöglicht werden. Um eine distanzierte Perspektive einnehmen zu können, wird der eigene Erfahrungsschatz "mit wissenschaftlichen Wissensbeständen" (ebd.) angereichert. "Reflexion [...] ist damit in der Lage, Handlung zu verändern und nicht nur zu rechtfertigen" (Christof 2017: 90).
Inklusion setzt eine „durchgängig selbstreflexive Haltung" (Baldus 2013: 305) voraus, "die sich um die Dekonstruktion vermeintlicher Gewissheiten, Zuschreibungen und ›Diagnosen‹ bemüht, die Begrenztheit des eigenen Beobachterstandpunktes anerkennt und sich auf die Suche nach der Eigenlogik" (ebd.) der Lernenden "und der spezifischen Funktionalität [ihres] Verhaltens begibt.“ (ebd.)
Problemlagen können anhand von Reflexion angemessen durchdacht sowie im Anschluss entsprechend bearbeitet werden (Kreuzer 2007: 79). Somit sollte Reflexionskompetenz nicht nur als Grundlage, sondern auch wertvolles Lernziel von Bildungssituationen gesehen werden.
Weiterhin wird der Wert von Reflexion auch im Bezug auf Selbstschutz von Pädagog*innen "vor Überforderung, Überbelastung und Burnout“ (Baldus 2013: 303) betont.
Reflexion wird im Fundus Inklusion an vielen Stellen thematisiert. Einen eigenen Navigationspunkt zum Thema finden Sie in den Materialseiten.
Resilienz
Der auf das Lateinische zurückgehende Begriff fand ursprünglich in der Physik für elastisch verformbare Werkstoffe Verwendung und meint in der Psychologie etwas ähnliches. "Psychologisch gesehen bedeutet Resilienz so viel wie innere Widerstandsfähigkeit oder Elastizität." (Kriebs 2019: 17) Sie ermöglicht es Menschen "trotz widriger Umstände [..] wieder in eine gesunde Balance zu kommen" (ebd.), so wie der Werkstoff in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. So wird erklärbar, "dass es Menschen gibt, denen schwere mehrfache Belastungen dauerhaft weniger schaden, als üblicherweise." (Prengel 2013b: 41)
Persönliche und soziale Ressorcen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Resilienz einer Person auswirken (Diers 2016: 77). Bezüglich dieser Faktoren gibt es unterschiedliche Modelle und "keine einheitliche [...] Operationalisierung von Resilienz" (ebd.: 76). Ein Modell geht beispielsweise von den sieben Säulen Akzeptanz dessen, was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, Optimismus, Selbstwirksamkeitserfahrung, Autonomieerleben, Kooperation, Lösungs- sowie Zukunftsorientiertheit (Kriebs 2019: 18-36) aus. Auch wenn eine enge und einheitliche Definition des Resilienzbegriffes angesichts seiner Multiperspektivität nicht sinnvoll erscheint (Diers 2016: 76), kann aufgrund der bestehenden Forschung davon ausgegangen werden, dass Menschen gesundheitlich darunter leiden, wenn eine oder mehrere der genannten Säulen über längere Zeit wegfallen (Grams Davy 2017: 25). Die Psychische Widerstandsfähigkeit ist also je nach zur Verfügung stehenden persönlichen und sozialen Ressourcen veränderlich (Diers 2016: 76). Resilienz "ist ein dynamischer Prozess" (Diers 2016: 76) und damit auch erlernbar (Kriebs 2019: 17). Wichtig ist, dass dies sowohl für Lehrende wie auch für Lernende gilt.
Resilienz wird im Fundus Inklusion an vielen Stellen thematisiert. Eine Inhaltsseite führt alle Erkenntnisse des Fundus Inklusion im Punkt Resilienz für alle als Fazit zusammen.
Restorative (Practice) Approach
Beim Restorative Approach bzw. Restorative Practice Approach geht es vorrangig um vorbeugende und reaktive Beziehungsgestaltung (Riestenberg 2002; Wachtel 2013). Vorbeugend soll die jeweilige Gemeinschaft in ihren Beziehungen gestärkt werden und reaktiv ein beziehungsförderlicher Umgang in der Aufarbeitung von konfliktreichen Situationen erfolgen (ebd.). Dabei geht es nicht um Bestrafung oder Schuldzuweisung, sondern um den reflexiven Umgang mit den Emotionen und Verantwortungen aller am Konflikt beteiligten Personen sowie um das Ableiten von Handlungsalternativen für die Zukunft (Morrison 2003; Harrison 2007; Wachtel 2013).
Man unterscheidet in informellere Praktiken des Restorative Approach, die weniger Personen involvieren, weniger Planungsaufwand und -zeit sowie Struktur benötigen und ihre Effekte langsam und stetig in alltagsnahen Zusammenkünften entfalten (O’Connell, Wachtel, Wachtel 1999; McCold, Wachtel 2001; Pranis 2005). Dazu zählen die sogenannten Chats - Fragen und Aussagen, die vor allem auf der Gefühlsebene ansprechen - sowie Meetings - spontane, reflektierende Gruppengespräche (ebd.). Auf der formelleren Seite stehen die sogenannten Circels und Conferences, an denen mehr Personen beteiligt sind und die meist bestimmte wiederkehrende Muster (z. B. Begrüßungrituale), Strukturen (z. B. feste Abläufe), Regeln (z. B. das Rederecht betreffend) und Rollen (z. B. Protokollführer*in) beinhalten (ebd.). Daher sind sie in Planung und Durchführung aufwendiger, erzeugen aber meist auch größere, sofortige Effekte (ebd.).
Selbstwirksamkeit
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Sinn und Bedeutung
Sinn und Bedeutung sind komplexe Kategorien, die großen Einfluss darauf haben, ob und wie Menschen lernen können (Leont’ev 2013: 196f). Nach Leontjew (1973) entsteht Sinn in dem Moment, wo ein in der Vergangenheit entstandenes Bedürfnis an einer tatsächlich Handlung und dem dabei unmittelbar zusammenhängenden Ergebnis Form annimmt (ebd. 221). Sinn existiert demnach in der Vergangenheit/ Gegenwart als Bedürfnis. In der Gegenwart wird es als Emotion hinsichtlich einer Tätigkeit sichtbar und bildet sich, in die Zukunft gerichtet, als Motiv einer Tätigkeit aus. Sinn kann also nur entstehen, wenn ein Bedürfnis auf einen Gegenstand trifft, welcher zur Befriedung dient (Leont’ev 2013: 198). Die Handlung wird als sinnvoll und der Gegenstand als bedeutsam bewertet. Hinsichtlich der Bedeutung einer Handlung führt Leontjew (1992) aus: "Der Sinn wird nicht durch die Bedeutung erzeugt, sondern durch das Leben" (ebd. 262). Anders gesagt, Sinn braucht zwar Bedeutungen, diese entstehen jedoch immer in Austauschprozessen zwischen Individuum und Umwelt (Lanwer 2002: 80).
Für Lernen und Entwicklung bedeutet dies, dass Verinnerlichung nur dann stattfinden kann, wenn die Lernenden individuellen Sinn für sich hinsichtlich des Lerngegenstandes entwickeln, also die Bedeutung des Gegenstandes für sich identifizieren können (Steffens 2019: 41). Das, was verinnerlicht werden soll, muss sinn- und bedeutungsvoll sein (ebd) also hinsichtlich eines Bedürfnisses bei den Lernenden eine Handlung offenbaren, deren Ergebnis ein gewünschtes Ziel in Zukunft darstellt. Andere Handlungen, die diesem Ziel nicht entsprechen, werden als “sinnlos” bewertet.
Damit Sinn und Bedeutung hinsichtlich eines Lerngegenstandes entwickelt werden kann, muss dieser durch die Lehrperson so aufbereitet werden, dass er mit Blick auf die Interessen und das Vorwissen der Lernenden aufzeigt, warum und wie er sinnvoll für sie ist. Denn nur, wenn der Lerngegenstand an die Interessen, Bedürfnisse und bereits verinnerlichten Fähigkeiten anschließt, wird den Lernenden die Sinn- und Bedeutungskonstruktion und damit auch Verinnerlichung ermöglicht (Steffens 2019: 41). Sinn- und Bedeutungskonstruktion wirkt sich demnach auch entscheidend auf die Motivationsentwicklung aus (Leont’ev 2013: 198).
Sozialform
Unter dem Begriff der Sozialformen werden didaktisch-methodische Entscheidungen in Bezug auf Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen gefasst (Meyer 2005: 136). Nach Hilbert Meyer haben Sozialformen „eine äußere, räumlich-differenzierende und eine innere, die Kommunikation- und Interaktionsstruktur regelnde Seite“ (ebd.: 138). Dabei wird in folgende Formen unterschieden:
-
Frontale Lehr-Lern-Settings
-
Gruppenarbeit oder kooperatives Lernen
-
Tandemarbeit (auch Partner*innenarbeit)
-
Einzelarbeit (auch Still- oder Alleinarbeit)
-
Lerngruppen-übergreifender Unterricht
Die Wahl der Sozialform ist immer auch eine didaktische Entscheidung und abhängig von den Lernzielen, den Lernenden selbst, den Rahmenbedingungen und der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Inklusionssensibles Lehren und Lernen gelingt vor allem dann, wenn die Lernenden selbstorganisiert zwischen verschiedenen Sozialformen des Lernens wechseln können.
Soziale Interdependenz
Soziale Interdependenzen sind Abhängigkeiten unter Individuen. Nach Johnson & Johnson (1993) werden drei Formen der Abhängigkeit beschrieben: positive, fehlende und negative Interdependenz/Abhängigkeit.
-
Mit positiver Interdependenz ist gemeint, dass die "Mitglieder einer kooperativ lernenden Arbeitsgruppe wissen, dass sie das Ziel nur gemeinsam in einer koordinierten Zusammenarbeit erreichen können und dadurch voneinander abhängig sind." (Mendzheritskaya et al. 2018: 148f.). Eine Abhängigkeit kann dadurch entstehen, dass verschiedene Rollen verteilt werden, die erfüllt werden müssen, um einen (möglichst gelingenden) Arbeitsprozess zu vollführen, Material zur Verfügung steht, dass sich hinsichtlich Komplexität, Informationsgehalt oder Darreichungsform (siehe Aneignungsebenen) unterscheidet und nicht für alle zur Verfügung steht, unterschiedliche Perspektiven bewusst transparent gemacht werden und diese profiliert und/oder zusammengeführt werden (müssen) oder unterschiedliche Wissensstände auf einem Gebiet zusammenkommen müssen, um ein komplexes Ziel zu erreichen.
-
Fehlende Abhängigkeit: D.h. eine Person braucht keine anderen Personen, um ihre Ziele zu erreichen. Das Einzelkämpfertum könnte hierbei eine Folge sein.
-
Negative Abhängigkeit: Eine Person erreicht ihr Ziel, wenn die Anderen, mit denen er*sie im Wettbewerb steht, ihre Ziele nicht erreichen. Synonyme für die negative Abhägigkeit sind Konkurrenz oder Wettkampf
Stereotyp
Stereotype sind „vereinfachende, schematisierende und verzerrende Kognitionen von Aspekten der sozialen Welt (Gruppen, Klassen, Nationen, Berufen, etc.) sowie von sozialen Institutionen“ (Häcker, Stapf 2004). Stereotype sind somit Über-Generalisierungen und werden auch häufig mit dem Begriff “Vorurteile” in Verbindung gebracht. Stereotype können sich sowohl auf Dinge als auch auf Personen bzw. Personengruppen beziehen. Stereotype ermöglichen uns, auf bestimmte Erfahrungen und Erfahrungsmuster zurückzugreifen, sodass sie unser Denken vereinfachen können. Hierbei werden jedoch die individuellen Eigenschaften einer Person gänzlich vernachlässigt. So belegen etwa zahlreiche Studien, dass der Stereotype-Thread sich als Erwartungseffekt häufig negativ auf die typisierten Personen auswirkt, da durch die Stigmatisierung ihre Individualität vernachlässigt wird (z.B. Aronson 2002, Alexander & Schofield 2008, Kratzmann & Pohlmann-Rother, 2012). Zu denken, die Lernenden wären alle gleich und sie folglich gleich zu behandeln wirkt sich auf das Verhalten sowie Selbstwertgefühl der Lernenden aus und resultiert schlussendlich auch in Frustration auf Seiten der Lehrperson (lesen Sie hier spannende Fallbeispiele dazu).
Subjektorientierung
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Systemische Perspektive und Denkweise
“Kennzeichnend für die systemische Perspektive ist, dass sich der Fokus der Aufmerksamkeit weg von den Eigenschaften isolierter Individuen hin zur Betrachtung der (zirkulären) Wechselbeziehungen miteinander kommunizierender und interagierender Personen verschiebt. Dabei richtet sich der Blick auf Systeme.” (Haselmann 2009: 158) Das bedeutet, dass z.B. aggressives Verhalten nicht als in einem einzelnen Individuum lokalisiertes Phänomen betrachtet wird (ebd.: 160), sondern sich der Fokus auf das soziale Umfeld richtet, in dem das aggressive Verhalten zutage getreten ist. Isolierende Bedingungen können hier ein Faktor sein.
“Als „systemisch“ wären [...] diejenigen Sichtweisen zu bezeichnen, die solche Phänomene oder definierte Störungen als Beschreibungen von Interaktionsprozessen betrachten. Zugleich wird dabei berücksichtigt, dass diese Beschreibungen nicht von einer objektiven Warte her erfolgen können, sondern immer nur aus der Sicht eines Beobachters, dass es sich also immer um „beobachterabhängige“ Beschreibungen handelt” (Haselmann 2009: 160). Kennzeichnend für die systemische Denkweise fasst Haselmann (2009) folgende Punkte zusammen:
-
“Sichtweise, die Interaktions- und Kommunikationssysteme zu ihrem Gegenstand macht (bei Achtung ihrer Selbstorganisation und Autonomie)
-
Betrachtung der Wechselbeziehungen kommunizierender und interagierender Personen (statt der Eigenschaften isolierter Individuen)
-
„Störungen“ gelten als interaktionelle Probleme oder als „unglückliche Kommunikationen“ (statt als Zustände einzelner Personen)” (ebd.: 158).
Diese Denkweise ist stark verknüpft mit der Verstehenden Perspektive, durch die unter Hinzuziehung verschiedener Perspektiven (Innen- und Außensicht) hypothesengeleitet pädagogisch-didaktische Schlussfolgerungen für den Lernprozess gezogen werden können. Ebenso kann die systemische Denkweise z.B. dabei helfen, sog. Unterrichtsstörungen als gescheiterte Kommunikation und ein Verhalten aufgrund von inadäquaten Lernangeboten zu beschreiben.
Teilhabe
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Themenzentrierte Interaktion (TZI)
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) ist ein Konzept zur Zusammenarbeit in Gruppen. Sie wurde in den 1950er und 1960er Jahren von der Psychoanalytikerin Ruth Cohn entwickelt. Ziel ist ein „lebendiges Lernen“, bei dem sowohl Intellekt und Emotionen, Körper und Geist, Gedanken und Gefühle, Handlung und Reflexion mit einbezogen werden (Schneider-Landolf, Spielmann, Zitterbart 2009: 14). Mittlerweile ist die TZI „eines der meistangewandten Gruppenverfahren im Bereich der humanistischen Psychologie und Pädagogik" (Löhmer et al. 2020: 9).
Auf Grundlage des Vier-Faktoren-Modells bietet die TZI Orientierung in der Konzeption und methodisches Handwerkszeug in der Umsetzung von Lehrveranstaltungen. Mit dem Ziel des sozialen Lernens und der persönlichen Entwicklung bietet sich das Modell an, um Konflikte erklären und bearbeiten zu können. Konflikte werden hierbei als Störungen bezeichnet. Darunter wird alle das gefasst, was die Gruppe oder Einzelnen Mitglieder*innen einer Gruppe darin hindert sich am Prozess zu beteiligen. Das können größere und kleinere, innere und äußere Störungen sein, die überall im Vierfaktorenmodell angesiedelt verortet werden können: Beim ICH (den einzelnen Menschen), beim WIR (dem Zwischenmenschlichen / der Gruppe) beim ES (in Form von Widerständen oder Unklarheiten in Bezug auf die Aufgabe) oder beim GLOBE (den Rahmenbedingungen).
Weitere Informationen zur TZI finden Sie in der Broschüre des Ruth Cohn Institute for TCI-international.
Unterrichtsstörung
Im pädagogischen Kontext wird Verhalten als die Fähigkeit gekennzeichnet, "mit Sprache und/oder Handlungen auf die Reaktion von Anderen oder ihren Erwartungen zu reagieren" (Langner 2009: 1). Werden Reaktionen als inadäquat, in dem Sinne als wenig sinn- und zweckvoll gewertet, wird auch in der Pädagogik von Verhaltensauffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen gesprochen bzw. diese als solche interpretiert. Zirfas (2014) kritisiert, dass in den zugrundeliegenden Klassifikationen wie der ICD - 10 weder die "konstituierenden Elemente [des Verhaltens, Anm. Team Fundus] noch deren Entwicklung bzw. deren Zusammenspiel und auch nicht ihre individuelle subjektive Bedeutung" (ebd.: 684) behandelt wird, wodurch Zirfas sie schlussendlich für die pädagogische Praxis als wenig hilfreich einstuft. In seiner Kritik spricht er die den sozialen Erwartungen zugrundeliegenden Normalitätsvorstellungen von Verhalten an. Normalitätsvorstellungen ergeben sich in gesellschaftlichen Prozessen, in Alltagserfahrungen, durch Verdatung und Statistik und werden normativ mit einem Durchschnittswert verknüpft, der es vermag, ’normales’ und ’pathologisches’, d.h. von Normalitätsvorstellungen abweichendes Verhalten herzustellen. So ergibt sich, dass Verhalten von einem Maßstab abhängt, der die/der Beobachter/in des Verhaltens innehat. Auffälligkeiten und Störungen im menschlichen Verhalten hängen folglich von der Perspektive der beobachtenden Person ab (Langner 2009: 1). Die Beschreibungen von Verhalten, die sich aus dem Fokus von Außenstehenden ergeben, laufen jedoch Gefahr, die innere, "subjektiv sinnhafte Seite" (Lanwer 2002: 10) zu marginalisieren. Die Folgen können sich in zweck- und zielorientierten Zuschreibungen abzeichnen, die sich hauptsächlich aus der äußeren Perspektive speisen.
Häufig wird einhergehend noch davon ausgegangen, dass das einzig mögliche Fehlverhalten im Lernprozess auf Seiten der Lernenden stattfände (Hoffmann 2009: 24). Tatsächlich aber führen in "einfachen" Fällen die verschiedenen Perspektiven von Lehrenden und Lernenden sowie deren unterschiedliche Perzeptionen (ebd.: 38) zu Missverständnissen. Teilweise wird in der Fachliteratur von Disziplinproblemen als verdeckten Überlebenstaktiken der Lernenden (Zimmermann 2006: 126) gesprochen.
Kommt es im Unterricht also zu konflikthaften Situationen wie kann zielführend und lernförderlich damit umgegangen werden? "Wenn Schule soziales Verhalten nicht mehr voraussetzen kann, muss sie dafür sorgen, dass dieses sich durch stabile Beziehungsmuster im schulischen Kontext entwickeln kann" (Hoffmann 2009: 311). Weiterhin seien das Vorleben konstruktiver Verhaltensmuster, ethischer Orientierungen und wertschätzender, themenzentrierter Kommunikationsmöglichkeiten, wie auch eine Atmosphäre von Akzeptanz und Anerkennung, die den Aufbau von Selbstbewusstsein begünstigt, zielführend (ebd: 304-311). Zu diesen eher langfristig angelegten Lösungsvorschlägen treten überdies kurzfristig wirksame Hinweise hinzu. So wird zum einen geraten, einen reflexiven Schritt aus dem Geschehen zurückzutreten, um dadurch "[z]u erkennen, dass eine Handlung [...] eigentlich nicht dem Pädagogen als Person gilt, sondern diesen nur in Stellvertreterfunktion meint" (Baldus 2013: 302). Auch die Methoden des Restorative Approach bzw. Restorative Practice Approach können nützlich sein, um akute Konflikte so zu bearbeiten, dass für alle Beteiligten eine beziehungsförderliche Lösung gefunden werden kann.
- weiterführende Literatur:
- Störmer, Norbert (2014): Du störst!. Herausfordernde Handlungsweisen und ihre Interpretation als "Verhaltensstörung". Pädagogik. Band 8. Berlin: Frank & Timme. Link zum SLUB-Katalog
Verstehende Perspektive
Die verstehende Perspektive ähnelt einem diagnostischen Prozess vom Beobachten, Erklären, Verstehen bis zum pädagogischen Handeln. In Bildungskontexten kommt im letzten Schritt noch eine didaktische Ableitung hinzu. Die verstehende Perspektive zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich im Prozess von äußeren Zuschreibungen und selektierenden, festgeschriebenen Diagnosen gelöst wird. Es werden verschiedene Perspektiven zusammengeführt, der betroffenen Person selbst, Freunden, Pädagog*innen, Ärzt*innen und Erziehungsberechtigten. Erst im Zusammenführen aller Perspektiven kann es zu einem Verstehen kommen, zu einer Beschreibung, die keine Bewertung ist.
Die Verstehende Perspektive nimmt als theoretische Hintergrundfolie eine wichtige Stellung im Fundus Inklusion ein. Daher bietet ein eigener Bereich zur Verstehenden Perspektive Erklärvideo, Material und weitere theoretische Grundlagen.
Verinnerlichung
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Vielfalt
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.
Vorurteil
Vorurteile werden zumeist definiert als individuelle, negative bzw. ablehnende Einstellung gegenüber einem Menschen oder einer Menschengruppe. Infolge stereotyper Vorstellungen werden einem Menschen oder einer Menschengruppe bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die sich selbst bei widersprechenden Erfahrungen nur schwer verändern lassen (Davis 1964: 78). Vorurteile erweisen sich selbst in “Kontexten der Interaktion, die sie eindeutig zu widerlegen im Stande sein müssten, als äußerst rigide” (Kurilla 2020: 101).
Einerseits ermöglichen Vorurteile Orientierungs- und Handlungssicherheit in einer komplexen sozialen Umwelt, vermitteln ihnen ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit und stärken dadurch ihre soziale Identität (Thomas 2006: 9). Andererseits wird die Individualität der Personen, auf die sich ein Vorurteil bezieht, ignoriert. Menschen werden dann lediglich als Mitglieder einer Fremdgruppe betrachtet, die anonymisiert werden und austauschbar erscheinen. Weiterhin offenbart sich der problematische Charakter von Vorurteilen z. B. darin, dass sie
- emotional gefärbt sind,
- für allgemeingültig und wahrhaftig erachtet werden,
- generalisierende Urteile über soziale Sachverhalte erzeugen,
- durch neue Erfahrungen und Informationen nur schwer veränderbar sind,
- selten infrage gestellt und bewusst reflektiert werden (ebd.: 3f).
Zudem gehen verfestigte Vorurteile nicht selten mit Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einher, was aus vielfaltssensbiler und demokratischer Perspektive strikt abzulehnen ist.
An folgendem Fallbeispiel können Sie Eindrücke gewinnen, wie sich Vorurteile auf Lehr-Lern-Situationen auswirken können: Hier geht`s zum Fall.
Zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen ist nicht zwingend ein sozialer Konflikt nötig. Sie können bereits bei minimalem Kontakt mit anderen Menschen oder Fremdgruppen aus dem ‚Nichts‘ erwachsen und bleiben mitunter auch dann bestehen, wenn die Gruppenmitglieder sich gegenseitig näher kennenlernen (Tajfel et al. 1978, 1982). Vor allem die Theorie der sozialen Identität stellt einen bedeutsamen Ansatz für die Erklärung des Zustandekommens von Vorurteilen dar. So kommt es bei der Zuordnung von Menschen zu Gruppen beinahe unumgänglich zur Bevorzugung der Eigengruppe und Benachteiligung der anderen Gruppe (Tajfel et al. 1971). “Vorurteile sind demnach quasi ‘Nebenprodukte’ der Konstruktion von positiven sozialen Identitäten” (Klein 2014: 26). Vor allem bei fehlender Reflexion der eigenen und durch soziale Identifikationsprozesse aufgebauten Vorurteile werden ihre Verfestigung und Reproduktion begünstigt. Ein Universalrezept, wie Vorurteile abgebaut werden können, gibt es nicht, da sie „nur unter extrem ‘günstigen’ Bedingungen bewusst reflektiert und einer kognitiv-rationalen Kontrolle unterzogen werden (können).“ (Thomas 2006: 6). Wohl aber existieren bereits zahlreiche Vorschläge wie z. B. :
-
Abbau von Homogenisierungstendenzen
-
Bewusste Selbstreflexion der eigenen Vorurteile und Stereotype
-
(positiv bewertete) Begegnungen mit Menschen, die sich entgegen des Vorurteils verhalten
-
Vermeidung sozialer Vergleichsprozesse zwischen Fremd- und Eigengruppe (vgl. dazu die Nachteile der sozialen Bezugsnorm)
-
Kooperation mit einem gemeinsamen Ziel
-
Die Schaffung alternativer Vergleichsdimensionen und ‚überlappender‘ Kategorisierungen
(nach Tajfel 1983, Thomas 2006).
Zone der aktuellen Entwicklung
Die "Zone der aktuellen Entwicklung" beschreibt in der Diagnostik all das, was aktuell im Kompetenzbereich des Kindes/Jugendlichen liegt. Das impliziert, dass das Kind/der*die Jugendliche*r dort keine Unterstützung benötigt. Das können z.B. "verfügbare Begriffe und Zusammenhänge" sowie "gegenwärtiges Interesse und die Motivation am Thema/Gegenstandsbereich" (Ziemen 2016: 46) sein.
Zone der nächsten Entwicklung
Die "Zone der nächsten Entwicklung" ist in der Diagnostik als sozialer bzw. intersubjektiver Raum zu verstehen. Sie schließt all das ein, was mithilfe kompetenter Anderer geleistet werden kann. “Das Kind vermag durch Nachahmung, in kollektiver Tätigkeit, unter Anleitung Erwachsener viel mehr einsichtig zu leisten, als es selbstständig tun könnte. Die Differenz zwischen dem Niveau, auf dem die Aufgaben unter Anleitung, unter Mithilfe der Erwachsenen gelöst werden, macht die Zone der nächsten Entwicklung aus.” (Vygotskij 1987: 97)
Zone der vergangenen Entwicklung
Die "Zone der vergangenen Entwicklung" (Ziemen 2003) hat die Sache, einen Gegenstand oder ein Thema im Zentrum. Sie berücksichtigt in der Diagnostik "die Erfahrungen und Erlebnisse des Kindes/Jugendlichen mit diesem; die breits erworbenen und bekannten Begriffe und Zusammenhänge; das Interesse und die Motivation an diesem Thema; die eigens gestellten Fragen und Lernbedürfnisse" (Ziemen 2016: 45f.).
Zugang
Für die Fertigstellung dieser Begriffserklärung braucht das Team Fundus noch etwas Zeit.