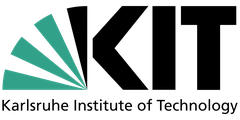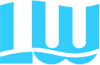Abgeschlossene Forschungsprojekte
TUD-Sylber Teilprojekt 8
Außerschulsichen Lernorte in der Lernlandschaft Sachsen
Projektlaufzeit: 01.07.2019 bis 30.06.2023
Ausgangslage
Das Lernen an außerschulischen Lernorten hat das Potential, Auseinandersetzungen mit authentischen Lerngegenständen unserer unmittelbaren Lebenswelt anzuregen, indem die natürlichen räumlichen Grenzen der Schule durchbrochen werden. Diesem Potential stehen Herausforderung für (angehende) Lehrkräfte gegenüber, außerschulische Lernorte zu finden und auszuwählen, nachhaltig in den Schulalltag einzubinden und fächerübergreifende Konzepte am Lernort zu entwickeln.
Zielstellung und Maßnahmen
Das interdisziplinäre Vorhaben „Außerschulische Lernorte in der Lernlandschaft Sachsen“ der Fachdidaktiken Chemie, Deutsch, Geografie und Physik verfolgt das Ziel, außerschulisches Lernen in der Lehrer:innenaus- und -weiterbildung zu verankern. Durch unmittelbare Erfahrungen am Lernort sollen (zukünftige) Lehrkräfte motiviert werden, außerschulisches Lernen nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren.
Ausgangspunkt der Projektarbeit sind Schlüsselprobleme, die mit regionalem Strukturwandel im Zusammenhang stehen. Zu diesen werden konkrete Lernorte ausgewählt und theoriebasiert Best-Practice-Konzepte nach fächerübergreifend-problemorientierten Ansätzen entwickelt und beforscht. Das Projekt erarbeitet und erprobt diese Konzepte exemplarisch in Zusammenarbeit mit der Umweltbildungsstelle Wolf, dem Förderverein Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sowie mit dem Bergbaumuseum Altenberg/Zinnwald.
Ein zentrales Anliegen ist die konzeptuelle Entwicklung und die Durchführung von fachdidaktischen Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende zum fächerübergreifenden, außerschulischen Lernen. Fokus sind dabei gemäß der Zielstellung des Projektes die Schwerpunktregionen sächsische Oberlausitz und Osterzgebirge. In den Seminaren lernen Lehramtsstudierende ausgewählte Regionen kennen, entwickeln Unterrichtskonzepte und erproben diese an und gemeinsam mit außerschulischen Lernorten.
Auf Basis der Best-Practice Konzepte und Lehrveranstaltungen werden Fortbildungen für Lehrer:innen zur Einbindung von außerschulischen Lernorten in den Schulunterricht entwickelt und angeboten. Um es Lehrkräften zu erleichtern, außerschulische Lernorte zu finden und nach ausgewählten Kategorien zu suchen, wurde im Rahmen des Projekts eine digitale Karte außerschulischer Lernorte in Sachsen entwickelt, die derzeit weiter optimiert wird. Akteur:innen der Lernorte haben dabei die Möglichkeit, ihre Lehr- und Lernangebote gezielt zu präsentieren. Die Lernlandkarte soll die Zielsetzung unterstützen, außerschulisches Lernen nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren. (Link zur Karte: https://lernorte.sachsen.schule/p/)
Weitere Informationen
Das Maßnahmenpaket „Synergetische Lehrerbildung im exzellenten Rahmen“ wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Weitere Informationen zu den Teilprojekten finden Sie unter: TUD SYLBER Teilprojekte
Prof.in Dr.in phil. habil. Manuela Niethammer
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=bWFud" data-b1="WVsYS5uaWV" data-b2="0aGFtbWVyQ" data-b3="HR1LWRyZXN" data-b4="kZW4uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Professorin
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Hochschullehrerin
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Bemerkungen:
Hochschullehrerin, Verantwortlich für diesen Fachbereich
Darius Mertlik
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=ZGFy" data-b1="aXVzLm1lc" data-b2="nRsaWtAdH" data-b3="UtZHJlc2R" data-b4="lbi5kZQ==">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum MS1 576
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-34935
Studienfachberater Höheres Lehramt an Berufsbildenden Schulen / Berufliche Fachrichtungen BFR Labor- und Prozesstechnik; Didaktik der Chemie
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum MS1 576
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-34935
Sprechzeiten:
Vorlesungszeit:
Die.: 14:00-15.00 Uhr MS1/576
Vorlesungsfreie Zeit:
Nach Vereinbarung—Anmeldung per E-mail
Sammelband
Pospiech, G.; Niethammer, M.; Wieser, D.; Kuhlemann, F.-M. (Hg.) (2020): Begegnungen mit der Wirklichkeit. Chancen für fächerübergreifendes Lernen an außerschulischen Lernorten. 1. Auflage. Bern: hep.
Beiträge in Sammelbänden
Kuske-Janßen, W.; Janßen, H.; Kühne, T.; Schlünz, O. (2020): „Lernlandschaft Sachsen: außerschulische Lernorte in der Lehrer*innenausbildung“ in: M. Stein, M. Jungwirth, N. Harsch, Y. Korflür (Hg.): Forschen. Lernen. Lehren an öffentlichen Orten – The wider view. Tagungsband. Münster: WTM-Verlag. Download
Raschke, N.; Janßen, H. (2021): „Interaktive Lernlandkarte der außerschulischen Lernorte in Sachsen – Ein digitales Instrument zur besseren Verankerung von außerschulischen Lernorten in den schulischen Unterricht“ in: Maurer, C.; Rincke, K.; Hemmrer M. (Hg.): GFD-Tagungsband zur Fachtagung 2020 mit der Universität Regensburg. Fachliche Bildung und digitale Transformation – Fachdidaktische Forschung und Diskurse, S. 177-180. Download
Posterpräsentationen (Datei oder Links bei Online-Publikationen)
2019
Janßen, H.; Kühne, T.; Kuske-Janßen, W.; Schlünz, O. (2019): „Lernlandschaft Sachsen: außerschulische Lernorte in der Lehrer*innenausbildung.“ Forschen. Lernen. Lehren an öffentlichen Orten – The wider view, Münster: 19.09.2019.
Janßen, H.; Kühne, T.; Kuske-Janßen, w.; Schellhammer, S.; Schlünz, O. (2019): „Lernlandschaft Sachsen: Entwicklung einer digitalen Lernlandkarte der außerschulischen Lernorte.“; 4. TUD-Sylber-Konferenz Digitalisierung in der Lehrerbildung, Dresden: 16.11.2019.
2022
Janßen, H.; Böning, P.; Schlünz, O.; Mertlik, D. (2022): „LERNLANDKARTE Sachsen. Ein digitales Instrument zur nachhaltigen Verankerung des außerschulischen Lernens.“; Mosaik-Tagung Erfolgreiches weiterführen – erfolgreiches Weiterführen: Theorien und – Konzepte zur Implementation im Kontext der Lehrer:innenbildung, Landau: 06.04.2022.
Vorträge (einschließl. Links bei Online-Publikationen)
2019
Kuske-Janßen, W.; Janßen, H. (2019): „Außerschulische Lernorte in der Lernlandschaft Sachsen.“ Netzwerktreffen MI(N)Teinander. Netzwerke(n) für die MINT-Bildung in Sachsen, Dresden: 30.08.2019.
2020
Janßen, H.; Schlünz, O.; Englmann, A. (2020): „Lernlandschaft Sachsen: Vorstellung einer interaktiven Lernlandkarte der außerschulischen Lernorte.“; (online), Herbstakademie 2020 – Medienbildung und Digitalisierung in der Schule, 19.11.2020.
Janßen, H.; Schlünz, O.; Englmann, A. (2020): „Interaktive Lernlandkarte der außerschulischen Lernorte in Sachsen – Ein digitales Instrument zur besseren Verankerung von außerschulischen Lernorten in den schulischen Unterricht.“ GFD-Tagung 2020 – Fachliche Bildung und digitale Transformation in Regensburg, 23.-25.09.2020.
2021
Böning, P.; Mertlik, D. (2021): „MINT-Lernen im Bergbaumuseum?! Außerschulisches naturwissenschaftliches Lernen an MINT-untypischen Lernorten“; (online), MINT-Aktionswoche: „MINT-vernetzt“, 24.11.2021.
2022
Janßen, H.; Böning, P.; Schlünz, O.; Mertlik, D. (2022): „Außerschulisches Lernen in der Lernlandschaft Sachsen. Kooperation in der Region langfristig fördern.“; Mosaik-Tagung Erfolgreiches weiterführen – erfolgreiches Weiterführen: Theorien und Konzepte zur Implementation im Kontext der Lehrer:innenbildung, Landau: 06.04.2022.
Workshops
2021
Schlünz, O.; Janßen, H.; Böning, P.; Mertlik, D.; Wieser, D.; Niethammer, M.; Pospiech, G.; Raschke, N. (2021): „Workshop 5: Lernlandschaft Sachsen: Phasenübergreifende Abstimmung zu Anforderungen und Chancen außerschulischen Lernens“; (online), 6. TUD-Sylber-Konferenz „Lehrerbildung gemeinsam gestalten“, 13.11.2021.
Schlünz, O.; Janßen, H. (2021): „Wie Hochschulen in multiprofessionellen Netzwerken Kompetenzen fördern und die Schullandschaft stärken; Handlungsfeld 2: Schulpraxisbezüge im Lehramtsstudium durch Kooperation mit regionalen Akteur:innen; Beispiel: Lernlandschaft Sachsen zu außerschulischem Unterricht“; (online), Programmkongress der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern, 22.11.2021.
Aufholen nach Corona
Projektlaufzeit: 01.01.2022 bis 31.08.2022
Ausgangslage
Es wird davon ausgegangen, dass durch die COVID-19-Pandemie bei etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen Bedarf an zusätzlicher Förderung besteht.
Der Bund stellt deshalb im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Verfügung, um bei den Kindern und Jugendlichen entstandene Defizite auszugleichen.
Einen wichtigen Beitrag können dabei Schülerlabore leisten. Als außerschulische Lernorte können sie fernab des schulischen Rahmens Kinder und Jugendliche erreichen. Die Fokussierung der Schülerlabore auf die Entwicklung der Problemlösefähigkeit und die authentische, oft forschungsnahe Umgebung, sollen positive Auswirkungen auf das Fähigkeitsselbstkonzept und die Lernmotivation erreicht werden.
Ziel des Projektes
- Etablierung von regionalen Schüler:innenangeboten im MINT Bereich
- Ausbau der Kooperationsstrukturen
Vorhaben
Da das Schülerlabor „LernLaborFarbe“ den Schwerpunkt auf naturwissenschaftliche Versuche gesetzt hat, wird auch dies der wesentliche Teil der Projektwoche sein. Dabei liegt der Fokus nicht darauf naturwissenschaftliche Hintergründe bis ins Detail zu verstehen, sondern viel mehr einen Zugang zu naturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu finden. Den Schüler:innen werden unterschiedliche Themen zur Wahl gestellt und diese dürfen sie nach Ihren Interessen auswählen.
Während der Projekttage arbeiten die Lernenden in Fünfergruppen und werden von einem Lernbegleitern unterstützt. Die Lernbegleiter sind Lehramtsstudierende eines naturwissenschaftlichen Fachs (vorrangig Chemie) bzw. des Grundschullehramtes. Sie begleiten die Schüler:innen bei den Experimenten und stehen ihnen bei Fragen zur Seite. Der Fokus liegt darauf, dass die Lernenden selbstständig die Versuche durchführen und selbst forschen.
in Arbeit
KAtLA+
Die Hauptzielstellung fokussierte auf die Verbreiterung der Rekrutierungsbasis der Lehrpersonen an berufsbildenden Schulen in den gewerblich-technischen Fachrichtungen, die über die Ausweitung der Studienangebote auf Abiturient(inn)en ohne vorherige Berufsausbildung, Absolvent(inn)en mit Fachhochschulreife, Studierende an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs) erfolgen soll. Zur Erschließung dieser Zielgruppen sollten im Projekt Studienmodelle für ein hochschulübergreifendes Studienangebot in der Lehramtsausbildung in den beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik und Informationstechnik, Metall- und Maschinentechnik, Bautechnik sowie Labor- und Prozesstechnik entwickelt werden. Bei den angedachten Studienmodellen stand die Anschlussfähigkeit vom Abschluss an einer HAW zum Lehramtsstudium im Mittelpunkt. Der Weg zum Lehramtsstudium über das abgeschlossene (Bachelor-)Studium an einer HAW ermöglicht zusätzlich Schülerinnen und Schülern mit Fachhochschulreife die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Diese Zielgruppe verfügt z. T. auch über einen einschlägigen Berufsabschluss in einer der oben genannten Fachrichtungen.
Aus den vielfältigen Voraussetzungen potenzieller Kandidat:innen für das Lehramtsstudium im gewerblich-technischen Bereich wurden vier Teilzielstellungen abgeleitet.
Ziel des Projektes
Mit dem Projekt wurden folgende Ziele verfolgt:
- Sicherung der Qualität der dualen Ausbildung in den technischen beruflichen Fachrichtungen
- Gewinnung neuer Zielgruppen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen – vor allem Abiturient*innen ohne vorherige Berufsausbildung sowie Studierende an Fachhochschulen (FH-Bachelor)
- Sicherung der Nachfrage für KAtLA bzw. für das Studium Lehramt an Berufsbildenden Schulen mit dem Ziel, den Lehrkräftenachwuchs für diese Schularten zu sichern
- Etablierung eines neuen Studienmodells FH-Bachelor Ingenieurpädagogik mit direkter Anschlussfähigkeit zum Lehramtsstudium BBS (Typ 5, KMK Kategorie), ggf. auch Etablierung eines integrierten Studiengangs FH/TU
Zusammenfassung der wichtigsten Projektergebnisse
Die wichtigsten Projektziele zur Verbreiterung der Rekrutierungsbasis der Lehrpersonen an berufsbildenden Schulen in den gewerblich-technischen Fachrichtungen wurden erreicht. Dazu zählen das klassische „KAtLA“-Programm und die Entwicklung und Implementierung von zwei Studienmodellen zur Rekrutierung von Absolvent(inn)en mit Fachhochschulreife, Studierende an Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs).
Das „klassische“ KAtLA-Programm hat den Regelbetrieb fortgesetzt und etabliert, weitere Unternehmen für die einjährigen Betriebspraktika gewonnen und das Angebot auf ET/IT und Bautechnik ausgeweitet. Das Projekt hat dazu beigetragen. Damit haben Lehramtsstudierende deutschlandweit das einmalige Angebot einer Verbindung aus Studium und Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen.
Des Weiteren wurden zwei Studienmodelle entwickelt, über die der Übergang von der HTW Dresden zu einem Studium an der TU Dresden im gewerblich-technischen Lehramt geebnet wird. Das konsekutive Modell (Studienmodell 1) wurde für die beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik und Informationstechnik, Metall- und Maschinentechnik, Bautechnik sowie Labor- und Prozesstechnik ausgearbeitet. Dazu wurden alle Dokumente zur Anerkennung erbrachter Studienleistungen erstellt, die den Anerkennungsprozess beim Antritt eines Studiums an der TU Dresden erleichtern. Das kooperative Modell (Studienmodell) wurde für die Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik konzeptionell entwickelt und auch implementiert.
Auch wenn mit Projektende nicht die gewünschten Studienanfängerzahlen erreicht wurden, so wurde doch eine konzeptionelle Basis für andere Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs) geschaffen, vergleichbare Studienmodelle zu entwickeln und zu implementieren. Die Instrumentarien und Materialien wurden dem Folgeprojekt OptLA (Option Studium des technischen Lehramtes an berufsbildenden Schulen in Kooperation mit weiteren Hochschulen und Universitäten in Sachsen) zur Verfügung gestellt.
Projektleitung
Prof.in Dr.in phil. habil. Manuela Niethammer
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=bWFud" data-b1="WVsYS5uaWV" data-b2="0aGFtbWVyQ" data-b3="HR1LWRyZXN" data-b4="kZW4uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Professorin
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Hochschullehrerin
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Bemerkungen:
Hochschullehrerin, Verantwortlich für diesen Fachbereich
Prof. Dr. Rolf Koerber
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=cm9s" data-b1="Zi5rb2VyY" data-b2="mVyQHR1LW" data-b3="RyZXNkZW4" data-b4="uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Projektleiter
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum MS1 515
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-42333
Verantwortlicher für das Fach WTH
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum MS1 515
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-42333
Sprechzeiten:
Nach Vereinbarung per E-Mail
Verantwortlich für das Fach Werken
Fach Werken
Fach Werken
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum MS1 515
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-42333
Publikationen zu KAtLA+ ab 2017
Beiträge in Zeitschriften
Düwel, F.; Koerber, R.; Niethammer, N. (2019): KAtLA+. Kooperative und integrative Studienmodelle zur passgenauen Qualifizierung Studierender im Studiengang Höheres Lehramt an berufsbildenden Schulen; in: Sonderdruck des bbw - Beruflicher Bildungsweg „Wege in das Berufskolleg“.
Posterpräsentationen
2018
Düwel, F.; Koerber, R.; Niethammer, N. (2018): Kooperative und integrative Studienmodelle. Passgenaue Qualifizierung Studierender im Studiengang Höheres Lehramt an Berufsbildenden Schulen, 20. GTW-Jahrestagung; Poster
Publikationen zu KAtLA von 2011 bis 2015
Sammelbände
Niethammer, M./ Hartmann, M. (Hrsg.) (2015): Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt. Kompetenzorientierte Lehrerbildung für berufsbildende Schulen im gewerblich-technischen Bereich. Reihe Berufsbildung, Arbeit und Innovation/Bd. 40. Bielefeld. (als E-book auf open access lesbar)
Beiträge in Sammelbänden
Kratzing, A.; Niethammer, M. (2016): Entwicklung und Erfassung didaktischer Kompetenzen von Lehramtsstudierenden am Beispiel der beruflichen Fachrichtung „Labor- und Prozesstechnik“. In: Frenz, M.; Schlick, C.; Unger, T. (Hrsg.): Wandel der Erwerbsarbeit. Berufsbildgestaltung und Konzepte für die gewerblich-technischen Didaktiken, Band 32, Berlin: LIT-Verlag, S. 420-433
Wohrabe, Dirk; Matthes, Nadine (2016): Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt – Zwischenstand und Ausblick im Modellprojekt. In: Jenewein, Klaus; Dreher, Ralph; Neustock, Ulrich; Schwenger, Ulrich (Hg.): Wandel der technischen Berufsbildung. Ansätze und Zukunftsperspektiven, Bielefeld: W. Bertelsmann-Verlag 2016, S.107-121
Hübner, A./ Maier, S./ Schmidt, D./ Wohlrabe, D. (2013): Das Konzept der kooperativen Ausbildung im technischen Lehramt. Ein Modellprojekt an der TU Dresden. In: Becker, M./ Grimm, A./ Petersen, A. W./ Schlausch, R. (Hrsg.): Kompetenzorientierung und Strukturen gewerblich-technischer Berufsbildung. Berufsbildungsbiografien, Fachkräftemangel, Lehrerbildung. Reihe: Bildung und Arbeitswelt. Bd. 26. Berlin. S. 576–590.
Beiträge in Zeitschriften
Schmidt, D. (2014): Die Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt (KAtLA) der TU Dresden. In: BAG-Report 16. Heft 1. S. 50–59. (download)
Hartmann, M. D., Matthes, Nadine/ Wohlrabe, Dirk (2015): Verknüpfung beruflicher Arbeits- und Lernprozesse als Beitrag zur Professionalisierung angehender Lehrender der Elektrotechnik und Metalltechnik im Rahmen der Kooperativen Ausbildung im technischen Lehramt. In: bwp@Spezial 8 Arbeitsprozesse, Lernwege und berufliche Neuordnung, hrsg. v. Schwenger, U./Geffert, R./Vollmer, T./Neustock, U., 1-12. Online (19.02.2015)
Hübner, A. (2013): Neue Wege in der Lehrerbildung für berufliche Schulen. In: bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 07, Online: http://www.bwpat.de/ht2013/ft07/huebner_ft07-ht2013.pdf
Wohlrabe, Dirk (2010): Bachelor- und Facharbeiterabschluss gleichzeitig. Berufsausbildung und Lehramtsstudium an der TU Dresden in einem neuen Modell vereint. In: Dresdner UniversitätsJournal, 21. Jahrgang, Nr. 15, Seite 5
Vorträge
2015
Matthes, Nadine/ Wohlrabe, Dirk (2015): Das Projekt „Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt (KAtLA)“ - Zwischenstand und Ausblick, 18. Hochschultage Berufliche Bildung an der Technischen Universität Dresden, Fachtagung der BAG Elektrotechnik, Online: http://www.bwpat.de/spezial8/hartmann_etal_bag-elektro-metall-2015.pdf
2014
Kratzing, A. [2014]: Entwicklung und Erfassung didaktischer Kompetenzen von Lehramtsstudierenden am Beispiel der beruflichen Fachrichtung „Labor- und Prozesstechnik“. 18. Herbstkonferenz Gewerblich-technische Wissenschaften und ihre Didaktik, Aachen: 02.10.2014.
2013
Hübner, A. [2013]: KAtLA-Neue Wege in der Lehrerbildung für berufliche Schulen. 17. Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung Chemie- und Umwelttechnik, Essen: 14.03 2013.
2012
Niethammer, M.; Hübner, A. [2012]: Kompetenzorientierte Lehrerbildung. Vortrag beim wissenschaftlichen Symposium an der SBG Dresden: 14.01.2012.
Hübner, A.; Mayer, S.; Schmidt, D.; Wohlrabe, D. (2012): Das Konzept der kooperativen Ausbildung im technischen Lehramt: Ein Modellprojekt an der TU Dresden. 17. Herbstkonferenz Gewerblich-technische Wissenschaften und ihre Didaktik, Flensburg: 10.10.2012.
Posterpräsentationen
2011
Hübner, A.; Niethammer M. [2011]: „Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt - KAtLA“. Gesellschaft Deutscher Chemiker, Wissenschaftsforum Chemie, Bremen 2011.
SFK – Sicherung des Fachkräftebedarfs in Kleinst- und Kleinunternehmen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Die sächsische Wirtschaft wächst. Unternehmen expandieren und suchen neue Mitarbeiter. Ähnlich wie in anderen Bundesländern ist die Fachkräftesituation in Sachsen angespannt. Verschärft wird die Lage durch Passungsprobleme (Mismatches). Während kleinste, kleine und mittlere Unternehmen offene Stellen haben, finden viele Schulabsolventinnen und
-absolventen keinen Ausbildungsplatz.
Vor diesem Hintergrund untersuchte die TU Dresden in Kooperation mit der IHK Dresden und HWK Dresden wie Kleinst-, Klein-, und mittlere Unternehmen Fachkräfte gewinnen und inwiefern sie vorhandene Beratungs- und Informationsangebote nutzen. Außerdem wurden ihre Bedarfe an solchen Angeboten sowie weiteren Unterstützungsmöglichkeiten oder Auslagerung ermittelt.
Parallel dazu wurden Schulabsolventinnen und -absolventen online befragt, um deren Sichtweisen auf die Ausbildungsplatzsuche zu erheben und Einflussfaktoren bei der Berufswahl abzuzeichnen. Es kann ein exemplarischer Einblick für neunte Klassen an Oberschulen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gegeben werden.
ChemNet – Entwicklung und Erprobung einer Web 2.O-basierten Lernumgebung für die Aus- und Weiterbildung im Chemiesektor
In dem Projekt ging es um die Entwicklung und Erprobung einer Web 2.0 basierten Lernumgebung für die berufliche Qualifizierung im Chemiesektor.
Der dafür entwickelt ChemNet-Online-Campus ist eine persönliche Lernumgebung (Personal Learning Environment – PLE), die von den Nutzern flexibel eingerichtet werden kann, um auf alle zur Verfügung stehenden Werkzeuge wie Kurse, Foren, Blogs, Wikis, Links etc., die mit der Aus- und Weiterbildung in Verbindung stehen, unmittelbar zugreifen zu können. Im Rahmen des Projektes wurden Lern- und Kooperationsszenarien entwickelt, erprobt und evaluiert.
Eine detaillierte Darstellung der Grundkonzeption der Plattform und darüber realisierbaren Lern- und Kooperationszenarien können den projektbezogenen Publikationen entnommen werden.
Prof.in Dr.in phil. habil. Manuela Niethammer
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=bWFud" data-b1="WVsYS5uaWV" data-b2="0aGFtbWVyQ" data-b3="HR1LWRyZXN" data-b4="kZW4uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Professorin
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Hochschullehrerin
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Bemerkungen:
Hochschullehrerin, Verantwortlich für diesen Fachbereich
Beiträge in Sammelbänden
Düwel, Frauke (2015): Berufliche Bildung 2.0 - Lernortübergreifende Lern- und Kooperationsszenarien durch Nutzung der Neuen Medien, In: Tagungsband der 18. GTW-Herbstkonferenz; in Druck
Düwel, Frauke; Neumann, Jörg (2013): Möglichkeiten und Grenzen einer Web 2.0 basierten Lernumgebung für die Berufliche Bildung. In: bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 07, hrsg. v. NIETHAMMER, M./ PFRENGLE, G., 1-19. Online: http://www.bwpat.de/ht2013/ft07/duewel_neumann_ft07-ht2013.pdf
Forschungsberichte
Budig, Bernd; Düwel, Frauke; Gerstner, Stefan; Hofmann, Jens, Köhler, Thomas; Kühl, Sigmar; Neumann, Jörg; Niethammer, Manuela; Paul, Urte; Ulbricht, Isabell (2015): ChemNet. Entwicklung und Erprobung einer Web 2.0 basierten Lernumgebung für die berufliche Qualifizierung im Chemiesektor, Abschlussbericht
Neumann, Jörg; Düwel, Frauke; Niethammer, Manuela (2014): Forschungsbericht zur IST-Stands-Analyse im BMBF Verbundvorhaben ChemNet. TU Dresden. Dresden, online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-150916
Posterpräsentionen
eQualification 2014
eQualification 2013
Fakultätstag, Fakultät Erziehungswissenschaften, TU Dresden, 2013
Vorträge
18. GTW-Herbstkonferenz
Düwel, Frauke (2015): Berufliche Bildung 2.0 - Lernortübergreifende Lern- und Kooperationsszenarien durch Nutzung der Neuen Medien, 02.10.2014
Hochschultage Berufliche Bildung 2013 und 2015
Düwel, Frauke (2015): Berufliche Bildung 2.0: Lernstrategien und Kompetenzentwicklung durch Nutzung der Neuen Medien, 20.03.2015
Düwel, Frauke (2013): Möglichkeiten und Grenzen einer Web 2.0 basierten Lernumgebung für die Berufliche Bildung,13.-15.03 2013
Mitgliederversammlung des Bildungsverbunds Sachsen für Chemie und chemiebezogene Berufe
Berger, Anne (2013): ChemNet-OnlineCampus: Gestaltung einer Web 2.0 basierten Lernplattform, Mitgliederversammlung des Bildungsverbunds Sachsen für Chemie und chemiebezogene Berufe. Dresden. 08.10.2013
International Summer School 2013: Digitization and its Impact on Society
Düwel, Frauke (2013): Chances and limits of a web 2.0 based learning environment for vocational education, 04.10.2013
CredChem Network Sommerakademie 2013
Berger, Anne (2013): ChemNet - Stand der bisherigen Projektarbeiten und Ausblick auf weitere Meilensteine, CredChem Network Sommerakademie 2013. Dresden. 30.05.2013.
Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.V. Dresden
Neumann. Jörg (2012): Neue Medien in der Beruflichen Aus- und Weiterbildung. Berufsförderungswerk Bau Sachsen e.V. Dresden. 23.10.2012
Gesamtlehrerkonferenz am BSZ Radebeul
Düwel, Frauke (2012): Verbundvorhaben ChemNet - Entwicklung und Erprobung einer Web 2.0 basierten Lernumgebung, Gesamtlehrerkonferenz am BSZ Radebeul, 29.08.2012
TransRisk - Charakterisierung, Kommunikation und Minimierung von Risiken durch neue Schadstoffe und Krankheitserreger im Wasserkreislauf
Als Teil der BMBF-Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf (RiSKWa)“ beschäftigte sich das Projekt TransRisk mit der Charakterisierung, Kommunikation und Minimierung von Risiken, die von anthropogenen Spurenstoffen (z. B. Arzneimittelwirkstoffe, Hormone, kosmetische Inhaltsstoffe, Flammschutzmittel), deren Transformationsprodukten sowie von Krankheitserregern im Wasserkreislauf ausgehen. Im Projekt wurden Methoden zur Charakterisierung dieser Spurenstoffe entwickelt sowie Verfahren zur weitergehenden Abwasserreinigung erprobt. Parallel dazu wurden sozial-empirische Studien durchgeführt und Bildungskonzepte zum Thema entwickelt.
Ein Arbeitsschwerpunkt des Projektes, welcher durch die TU Dresden realisiert wurde, war die Risikokommunikation, in der die in TransRisk generierten Erkenntnisse auf ihre Relevanz für verschiedene Adressatengruppen geprüft, didaktisch aufbereitet und zielgruppenspezifisch kommuniziert wurden. Dabei entstanden Bildungskonzepte für die Allgemeinbildung sowie die Aus- und Weiterbildung professioneller Akteure im Umweltschutz. Darüber hinaus wurden Fortbildungskonzepte für Lehrende der Berufs- und Allgemeinbildung erstellt, um diese Berufsgruppe für das Thema zu sensibilisieren und als Multiplikatoren der Risikokommunikation zu befähigen.
Prof.in Dr.in phil. habil. Manuela Niethammer
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=bWFud" data-b1="WVsYS5uaWV" data-b2="0aGFtbWVyQ" data-b3="HR1LWRyZXN" data-b4="kZW4uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Professorin
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Hochschullehrerin
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Bemerkungen:
Hochschullehrerin, Verantwortlich für diesen Fachbereich
Beiträge in Sammelbänden
Alt, Ulrike; Niethammer, Manuela (2013): Veränderte Bildungsanforderungen durch die Etablierung neuer Technologien –projektintegrierte Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien. In: bwp@ Spezial 6 – Hochschultage Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 07, hrsg. v. Niethammer, M.; Pfrengle, R., 1-12.
Beiträge in Zeitschriften
Krauße, Ulrike; Niethammer, Manuela (2015): Nachhaltiges Handeln erfordert fachübergreifende Kompetenzen. Ein Unterrichtsbeispiel aus dem technischen Umweltschutz. In: Berufsbildung. Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule, Jg. 155, S. 21-23.
Posterpräsentionen
Niethammer, M; Krauße, U.; Götz, K.; Sunderer, G.; Thaler, S. (2015): Risikomanagement durch Kommunikation. Abschlussveranstaltung der BMBF-Fördermaßnahme „Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf - RiSKWa“, Berlin.
Niethammer, M.; Krauße, U.; Götz, K.; Sunderer, G. (2013): AP 3: Risikowahrnehmung und -bewertung. 2. Statusseminar der BMBF-Fördermaßnahme „RiSKWa - Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf“, Karlsruhe.
Krauße, U.; Niethammer, M. (2013): Entwicklung von Bewertungskompetenz im Chemieunterricht. GDCP-Jahrestagung. München.
Alt, U.; Niethammer, M. (2012): Communication of risks associated with pharmaceuticals in the environment - development of educational concepts. International Doctoral Seminar Smolenice, Smolenice.
Niethammer, M; Alt, U.; Götz, K.; Thaler, S. (2012): Arbeitspaket 3 „Risikokommunikation“. Kick-Off Meeting der BMBF-Fördermaßnahme „RiSKWa - Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf“, Frankfurt a. M..
Vorträge
Krauße, U. (2015): Potenziale der Integration aktueller Forschungsschwerpunkte in die berufliche Aus- und Weiterbildung. 18. Hochschultage Berufliche Bildung 2015, Fachtagung Chemie- und Umwelttechnik. Dresden.
Krauße, U. (2014): Risikokommunikation im Bildungskontext. Allgemeinbildung und Berufliche Bildung. RiSKWa-Fachgespräch „Risikokommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“, Frankfurt a. M.
Krauße, U.; Sunderer, G. (2014): Kommunikationsstrategien. Workshop „Relevanz von Transformationsprodukten im urbanen Wasserkreislauf inklusive Ergebnissen aus dem BMBF-Forschungsprojekt TransRisk“, Koblenz.
Krauße, U.; Niethammer, M. (2014): Wasser unter der Lupe. Schülerprojekt zu Spurenstoffen um urbanen Wasserkreislauf. Jahrestagung der Fachgruppe Chemieunterricht der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Kiel.
Niethammer, M.; Götz, K. (2014): Arbeitspaket 3: Risikokommunikation. Risikowahrnehmung und -beurteilung. TransRisk-Symposium IFAT München, München.
Krauße, U. (2013): Wasser unter der Lupe. Das Forschungsprojekt TransRisk. MINT-Woche am Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa, Riesa.
Krauße, U.; Niethammer, M. (2014): Wasser unter der Lupe - Schülerprojekt zu Spurenstoffen im urbanen Wasserkreislauf. 31. Fortbildungs- und Vortragstagung der Fachgruppe Chemieunterricht der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Kiel.
Niethammer, M.; Krauße, U. (2013): BMBF Research Project TransRisk. New Technology Needs New Contents in Professional Training. WorldSkills, Leipzig.
Alt, U. (2013): Projektintegrierte Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien für die Berufliche Bildung. 17. Hochschultagen Berufliche Bildung, Fachtagung 07 Chemie- und Umwelttechnik, Essen.
Presseinformationen
DWA (Hg.) (2014): „Wasser unter der Lupe“. Schülerinnen und Schüler in Ulm diskutieren Problematik der Spurenstoffe im Wasserkreislauf.
Donau Zeitung (Hg.) (2014): Windeln als Superabsorber. Umwelt - Schüler des Albertus-Gymnasiums Lauingen testen verschiedene Möglichkeiten zur Reinigung von Abwasser. 05.06.2014.
Südwest Presse (2015): Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums treffen Bildungsministerin Johanna Wanka in Berlin. Online: http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Schueler-des-Albert-Einstein-Gymnasiums-treffen-Bildungsministerin-Johanna-Wanka-in-Berlin;art4329,315732
TransRisk ist ein Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme "Risikomanagement von neuen Schadstoffen und Krankheitserregern im Wasserkreislauf (RiSKWa)“. Es wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
KAtLA - Kooperative Ausbildung Im technischen Lehramt
Das Modellprojekt KAtLA intendierte die Integration beruflicher Ausbildungsinhalte in das Lehramtsstudium für technische Berufe. Damit wurden speziell Studieninteressenten ohne Berufsabschluss angesprochen, die sich ab dem Wintersemester 2011 in den neuen Studiengang für das höhere Lehramt an Berufsbildenden Schulen mit kooperativer Ausbildung immatrikulieren konnten. Parallel zum Lehramtsstudium führte dieses zu den Berufsabschlüssen Chemielaborant/-in, Elektrotechniker/-in für Geräte und Systeme, Tischler/-in bzw. Industriemechaniker/-in.
Vorrangig ging es bei dem neuen Studienmodell um die Verbesserung der Qualität der Lehrerausbildung und damit der Ausbildung an den berufsbildenden Schulen Sachsens. Für ihre Aufgabe, Facharbeiter auszubilden, benötigen die Lehrenden an den berufsbildenden Schulen fundiertes Wissen und Erfahrung in der Facharbeit. Erst dann können sie in den Lernfeldern des Ausbildungsberufs Problemlagen des beruflichen Alltags einschätzen, entsprechende Aufgabenstellungen formulieren und deren Lösung richtig bewerten. Als Nebeneffekt sollte der nicht nur in Sachsen bestehende Bedarf an Lehrer/-innen der technischen Beruflichen Fachrichtungen besser gedeckt werden.
Für das Studium konnten sich Abiturient(inn)en bewerben, die bei Studienantritt ihren Hauptwohnsitz in Sachsen hatten. Der Modellversuch begann Anfang Juli mit einem Vorpraktikum von 13 Wochen. Den Studierenden stand in der gesamten Zeit des qualifizierenden Praktikums (3-4 Jahre), ein monatliches Stipendium von ca. 325 Euro (Nettobetrag) zur Verfügung. Darüber hinaus wurden die Kosten für die Ausbildungspraktika und die Abschlussprüfung mitfinanziert. Das Modellprojekt „Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt“ (KAtLA) wurde von Frau Prof. Dr. Niethammer und Herrn Prof. Dr. Hartmann geleitet. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und Unterstützungen durch das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA). Die Abstimmung ist durch die Ministerien für Kultus (SMK) sowie Wissenschaft und Kunst (SMWK) erfolgt und begleitet worden.
Die Abschlusspublikation (als E-book auf open access lesbar) informiert über das Modellprojekt „Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt“ und die Ergebnisse der ersten beiden Studiendurchgänge. Alleinstellungsmerkmal, Ausgangslage, Rahmenbedingungen, Konzepte und deren theoretische Hintergründe, Erfolge und Erfahrungen des kooperativen Studienmodells werden in der Publikation mit dem Hintergrund der wissenschaftlichen Begleitforschung bekannt gemacht. Weiterhin enthält die Publikation Empfehlungen für die Zukunft einer praxisorientierten Lehrerbildung für berufsbildende Schulen.
Die Evaluationsergebnisse und die positiven Rückmeldungen aller Beteiligten zeigen, dass KAtLA ein Lösungsansatz für eine qualitativ hochwertige und auf die Zukunft ausgerichtete kompetenzorientierte Ausbildung von Lehrkräften für gewerblich-technische Fachrichtungen an berufsbildenden Schulen darstellt. Mit der Verstetigung von KAtLA möchten wir einen hohen Qualitätsstandard in der Lehramtsausbildung im gewerblich-technischen Bereich dauerhaft garantieren.
LsU - Lehrer studiert Unternehmen
Im Projekt „Lehrer studiert Unternehmen“ realisierten Lehramtsstudierende der Fächer Chemie und Physik der TU Dresden zusätzlich zu ihrem Studium zweimal ein zweiwöchiges Praktikum in Unternehmen oder Forschungsinstitutionen der Region.
Im Rahmen dieser Praktika lernten die Studierenden Wirtschafts- bzw. Forschungsunternehmen Sachsens kennen. Sie erschlossen und strukturierten bildungsrelevante Inhalte, die in einem konkret untersuchten Arbeits- oder Forschungsbereichs zu Tage traten. Als Ergebnis dieser Arbeitsanalysen entstand eine Sammlung kontextbezoger strukturierter Inhalte, die einen alternativen Zugang zu Inhalten der Naturwissenschaften bietet und so den Zugang über fachsystematisch aufbereitete Literatur sinnvoll ergänzt.
Auf der Basis dieser Analyseergebnisse entwickelten die Studierenden Konzepte kontextbezogenen Unterrichtes nach folgenden Kriterien: Sie sind kontext- und somit für die Lernenden problembezogen. Sie stellen ein Unternehmen Sachsens in den Mittelpunkt, wodurch sich die Lernenden die sächsische Wirtschaft- bzw. Wissenschaftslandschaft exemplarisch erschließen können. Durch die Fokussierung auf konkrete Aufgaben der Praktikumspartner werden Elemente der Berufsorientierung gesichert, denn die Lernenden erfahren auf diese Art und Weise, welche Tätigkeiten in den jeweiligen Unternehmen zu bewältigen sind.
Der im Projekt entwickelte Ansatz ist in die Curricula der Lehrerbildung im Fach Chemie eingearbeitet worden. Das heißt, die Praktika sind unmittelbar in die didaktische Ausbildung eingegliedert. Die Studierenden haben die übergeordnete Aufgabe, aus dem Praktikum heraus ein arbeitsorientiertes Unterrichtskonzept zu entwerfen. Die zukünftigen Lehrer/-innen erlernen, arbeits- und damit auch bildungsrelevante Inhalte für einen praxis- und anwendungsbezogenen Unterricht zu erschließen, didaktisch zu strukturieren und zu reduzieren.
Insgesamt bewerten alle Beteiligten die durchgeführten Praktika als bedeutende Erfahrung mit großem Nutzen für die spätere Berufstätigkeit der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer. Durch die Betriebspraktika können die Lehramtsstudierenden Konzepte kontextbezogenen (anwendungsbezogenen) Unterrichts mit Bezug zur Arbeitswelt entwerfen und durch ihr erworbenes Wissen über Berufsgruppen ihre zukünftigen Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und Technik interessieren sowie für einen Beruf in diesem Bereich motivieren. Sächsische Forschungs- und Wirtschaftsunternehmen benötigen diese zukünftigen Absolventen der Natur- und Ingenieurwissenschaften für die Sicherung ihrer Innovationsfähigkeit.
Gleiche oder ähnliche Erfahrungen zu Betriebsabläufen und –strukturen können in der universitären Ausbildung an keiner anderen Stelle vermittelt werden. Unternehmen betonen die Bedeutung solcher Initiativen und sind sehr gerne bereit, auch zukünftig Lehramtsstudierende als Praktikanten bei sich aufzunehmen.
Prof.in Dr.in phil. habil. Manuela Niethammer
<a target="_blank" class="ms-href external-link" data-a0="https://s" data-a1="ecuremail" data-a2=".tu-dresd" data-a3="en.de/web" data-a4=".app?" data-b0="rcpt=bWFud" data-b1="WVsYS5uaWV" data-b2="0aGFtbWVyQ" data-b3="HR1LWRyZXN" data-b4="kZW4uZGU=">Eine verschlüsselte E-Mail</a> <span>über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).</span>
Professorin
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Professur für Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung / Berufliche Didaktik
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Hochschullehrerin
Besuchsadresse:
Münchner Straße 1, Raum 575
01187 Dresden
- work Tel.
- +49 351 463-33068
Sprechzeiten:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Bemerkungen:
Hochschullehrerin, Verantwortlich für diesen Fachbereich
Monographien (Dissertationen)
Unverricht, Ines (2015): Betriebspraktika als Element kompetenzorientierter Lehrerausbildung: hochschuldidaktisches Konzept für den Studiengang Höheres Lehramt an Gymnasien für Chemie und Physik. Bielefeld: wbv
Lein, Sandra (2014): Das Betriebspraktikum in der Lehrerbildung: eine Untersuchung zur Förderung der Wissenschafts- und Technikbildung im allgemeinbildenden Unterricht. Berlin: Logos
Beiträge in Zeitschriften
Koch, Sandra / Unverricht, Ines (2011): Lehrer studiert Unternehmen. Eine erste Bilanz, in Dresdner Universitätsjournal, Jg. 22, Nr. 12, S. 3
Koch, Sandra / Unverricht, Ines (2010): Lehrer studiert Unternehmen. Ende August geht ein neues Konzept in der Lehrerausbildung in die erste Runde, in Dresdner Universitätsjournal, Jg. 21, Nr. 12, S. 4
Lein, Sandra (2010): Lehrer studiert Unternehmen. Lehrer/-innen kämpfen gegen MINT-Mangel, in Deutscher Ingenieurinnenbund, Jg. 95, Nr. 4, S. 39-40
Dieses Vorhaben wurde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen gefördert.
.