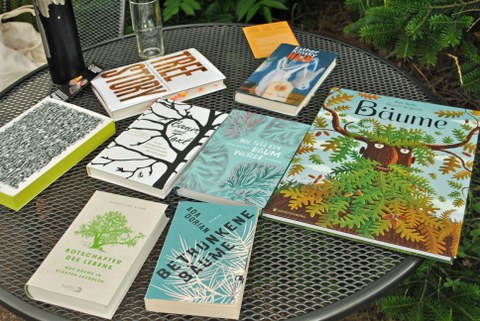Triff die Koryphäe unter der Konifere
Nadelbäume als Baum der Erkenntnis? An ausgewählten Sonntagen im Sommer gibt es unter den Koniferen im Botanischen Garten Einiges über innovative Forschung, ungelöste Probleme und den langen Weg zu neuen Antworten zu erfahren. Kommen Sie mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TU Dresden ins Gespräch und stellen Sie Ihre Fragen!
Sie sind Wissenschaftler*in an der TU Dresden und hätten Lust ihr spannendes Forschungsgebiet einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen? Schreiben Sie uns gern an bot.garten@tu-dresden.de.
Unsere geplanten Veranstaltungstermine sind 2026: 7. Juni, 19. Juli, 23. August, 6. September jeweils 15:30 Uhr.
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es hier.
Mitschnitte der vergangenen Veranstaltungen finden Sie unten sowie auf den gängigen Podcast-Portalen, wie Spotify.
Inhaltsverzeichnis
- Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden - JProf. Dr. Matthias Forkel
- Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg - Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher
- Der Duft des Textes: Gerüche in der antiken Literatur - JProf. Dr. Mario Baumann
- Grundwasser und Wald - Prof. Dr. Andreas Hartmann
- CampusAcker: Bildung für Nachhaltige Entwicklung - Prof. Dr. Jana Markert und Dr. Simone Reutemann
- Das neue Bauen: Chance und Notwendigkeit - Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach
- Mögliche Zukünfte gemeinsam entwickeln- Professor Dr.-Ing. Jens Krzywinski
- Lebende Arzneimittel - Dr. med. Torsten Tonn
- Alte Bäume als Lebensräume - Dr. Sebastian Dittrich
- Wie theoretische Physik hilft Mobilität zu verstehen - Dr. Malte Schröder
- Bestäubungsökologie - Dr. Katharina Stein
- Das Quantenpendel - Prof. Michael Kobel
- Bäume in der Literatur - Dr. Solvejg Nitzke
Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden - JProf. Dr. Matthias Forkel
Mit zunehmender Sommertrockenheit als Folge der Klimakrise nehmen Waldbrände auch in unseren Breiten zu. Doch wie können Satelliten bei der Untersuchung solcher Brandflächen Aufschluss über Brandursachen und die Vermeidung von Waldbränden geben? Prof. Matthias Forkel von der Juniorprofessur für Umweltfernerkundung der TU Dresden gibt Antwort auf diese und weitere Fragen.
Transkription der Audioaufnahme:
Moderation, Caroline Fuhr: So, dann auch noch mal von mir: Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind, so zahlreich. Und danke auch an Sie, Herr Prof. Dr. Forkel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute sich hier mit eurem, mit Ihrem Forschungsthema uns mal ein bisschen erleuchten.
Prof. Dr. Matthias Forkel: Vielen Dank für die Einladung.
Moderation: Sehr gerne. So das Titel, der Titel heute ist „Waldbrände mit Satelliten erforschen und vermeiden“. Und das Thema Waldbrand ist ja, ich denke, das wissen sie alle recht relevant. Man hört das immer häufiger in den Nachrichten. Wir hören Dinge aus den USA, aus Spanien, aus Frankreich und immer häufiger jetzt natürlich auch aus Deutschland. Diejenigen von Ihnen, die hier wohnen, haben sicher auch mitbekommen, dass ab und zu schon mal die Fenster geschlossen bleiben mussten, weil eben sehr viel aus den Waldbränden hierhergezogen ist. Das heißt unglaublich relevantes Thema und umso cooler, dass Sie heute da sind und uns dann mal ein paar Einblicke geben. Sie sind Professor für Umweltfernerkundung hier an der TU Dresden und ein Schwerpunkt liegt bei Ihnen so ein bisschen auf dem technischen Aspekt, auf der Arbeit mit den Satelliten und der andere eben im Methodischen, wie man dann, was man dann mit den Daten macht, wie man damit Ökosysteme versteht und vielleicht auch Klimaentwicklungen beobachten kann. Und ich würde den Titel mal so ein bisschen dreiteilen, weil ich mit dem mal angeguckt und gesehen: Thema eins „Waldbrände“, Thema zwei „mit Satelliten erforschen“, Thema drei „vermeiden“. Was ich mit am spannendsten finde und auf jeden Fall, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Aber ich würde mal mit dem Thema Waldbrände allgemein anfangen und sie fragen, warum sie sich explizit mit Waldbränden beschäftigen.
Prof. Dr. Forkel: Warum explizit mit Waldbränden? Ich mache das schon lang. Also das erste Mal mit dem Thema Waldbrände bin ich in Kontakt gekommen tatsächlich während meines Studiums, als ich ein Praktikum gemacht habe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ganz normal ein studentisches Praktikum. Und da hat mir die Betreuerin vorgeschlagen, untersuch doch mal was zum Thema Waldbrände. Und seitdem bin ich mit diesem Thema irgendwie hängengeblieben, habe das in meiner Masterarbeit gemacht, in der Promotion und nach der Promotion auch noch. Und jetzt immer noch. Ähm, ja. Ich finde das, also es ist eine persönliche Motivation. Ja, ich finde das sehr spannend das Thema. Es ist vor 15 Jahren ein sehr Nischenthema gewesen im deutschsprachigen, eigentlich auch im europäischen Raum. Es hat kaum jemand untersucht. Es gab da viel Forschung dazu in USA, in Kanada, in Australien, also in Ländern, wo es Waldbrände schon länger gibt. Aber in Mitteleuropa gab es ganz wenige Professuren, die sich damit überhaupt beschäftigt haben. Genau. Und ja, ich habe mich halt sehr aus der fernerkundlichen Sicht dafür interessiert. Also was kann man aus Satellitendaten über Waldbrände überhaupt erfahren? Und eigentlich diese globale Erforschung von Waldbränden war auch erst mit der Entwicklung von Satellitensystemen möglich, weil diese erst ermöglichen, überhaupt Waldbrände großflächig zu erkennen und zu quantifizieren. Vorher, als es noch keine Satellitensysteme gab, hat man mal im Wald in der Nachbarschaft einen Waldbrand gesehen, aber man hatte nicht wirklich eine Information darüber, was ist denn das Ausmaß von Waldbränden in Deutschland, in Europa oder sogar weltweit? Also erst die Entwicklung von Satellitensystemen in den letzten 30, 40 Jahren hat eigentlich so eine weltweite Erforschung von Waldbränden ermöglicht.
Moderation: Können Sie noch mal kurz für uns zusammenfassen, was so das Verheerende an Waldbränden ist, also auf welchen Ebenen die auch wirken?
Prof. Dr. Forkel: Na ja, Waldbrand ist nicht gleich Waldbrand. Also wir reden in Deutschland immer von Waldbränden, aber, wenn man in andere Teile der Welt schaut, dann müsste man auch eigentlich sagen, es sind Savannenbrände, es sind Graslandbrände, es sind Torfbrände. Also manchmal sagt man allgemein in der Wissenschaft es sind Vegetationsbrände oder Vegetationsfeuer. Dieser Begriff hat sich in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht so etabliert. Da redet man von Waldbränden. Aber eigentlich meint man in der Forschung in der Regel mehr. Und wenn man sich zum Beispiel Brände in Savannen anschaut, dann kann man gar nicht sagen, dass die dort verheerend sind, sondern sind eigentlich Teil des natürlichen Ökosystems. Savannen brennen regelmäßig, es erneuert sich damit das Gras. Bestimmte Pflanzen können überhaupt erst austreiben nach so einem Brand. Also dort würde man nicht sagen, dass das was Verheerendes ist. Waldbrände werden erst verheerend, wenn sie auftreten in Regionen, wo sie eigentlich nicht normalerweise auftreten oder wenn sie viel häufiger auftreten als normalerweise. Wenn man sich also zum Beispiel Waldbrände in Deutschland anschaut, da könnte man schon sagen, ist es eher verheerend, weil normalerweise in Wäldern in Mitteleuropa keine Waldbrände auftreten, normalerweise. Wenn diese Waldbrände eher schwache Waldbrände sind, sind die nicht unbedingt verheerend. Da brennt vielleicht ein bisschen von der Streuschicht ab. Trockene Nadeln, trockene Blätter am Boden. Aber es beeinflusst nicht unbedingt den Wald. Erst wenn das Feuer eine gewisse Intensität erreicht, also mit einer starken Energie brennt, viel Hitze freisetzt und vielleicht komplett diese Streuschicht aufbrennt und vielleicht sogar bis in den Boden hinein brennt und so heiß wird, dass die Bäume auch beeinflusst werden und dann vielleicht nicht unmittelbar beim Waldbrand verbrennen, aber durch die Hitzeeinwirkung nach dem Waldbrand absterben, dann würde man sagen, war dieser Waldbrand verheerend für das Ökosystem. Und dann im nächsten Schritt, wenn der Waldbrand natürlich so intensiv und so schnell wird, dass er auch Siedlungsgebiete beeinflusst, wie wir es jetzt ja oft in den Nachrichten sehen, aus dem Mittelmeerraum oder aus dem Südwesten der USA, aus Kalifornien, dass im Prinzip Siedlungsgebiete auch betroffen werden, Häuser abbrennen, dann ist der Waldbrand natürlich auch verheerend für die Menschen.
Moderation: Also von meiner Perspektive aus wirkt es so, als würden sich Waldbrände oder das Phänomen Waldbrand oder Vegetationsbrand weltweit vermehren. Ist dem so?
Prof. Dr. Forkel: Die Antwort darauf ist ziemlich schwierig. Also man könnte Waldbrände, wenn man das sagt, ja. Wie viele Waldbrände gibt es weltweit? Was man dann häufig macht ist, man schaut sich an, was ist weltweit die gesamte verbrannte Fläche pro Jahr? Die Informationen bekommt man aus Satellitendaten und wenn man diese Satellitendaten sich über die letzten 20, 25 Jahre anschaut, dann sieht man, dass weltweit diese Brandfläche sogar zurückgeht. Also es brennt weniger. Und das ist sehr überraschend, weil wir in den Medien natürlich immer sehen, diese Feuer in Kalifornien, in Portugal, Spanien, Griechenland oder auch bei uns. Also man bekommt einen ganz anderen Eindruck. Da muss man sich aber diese Daten, die man da hat, viel genauer anschauen. Warum gibt es denn diesen Rückgang weltweit in den Waldbränden? Und das kommt vor allem dieses Signal aus den Savannen in Afrika. Also weltweit die größten Brandflächen treten auf in den Savannen in Afrika, in Südamerika oder Nordaustralien. Und dort geht tatsächlich über die letzten 25 Jahre die Brandfläche zurück. Es brennt weniger und die Brände werden auch kleiner. Und das beeinflusst diese gesamte Brandfläche so weit, weltweit so weit, dass man eigentlich einen Rückgang sieht. Wenn man sich dann aber andere Regionen anschaut, eben wie Nordamerika, Kanada und Sibirien. Dort sieht man dann eine Zunahme der Waldbrände. Also es brennt in den Regionen mehr, es treten mehr Feuer auf. Wenn man sich Mitteleuropa anschaut, ist es noch ein bisschen komplizierter. Wir hatten in den letzten Jahren 2018, 19, 22, voraussichtlich dieses Jahr auch wieder, relativ große Waldbrände in Deutschland oder auch in Tschechien, in Polen. Die hatten wir die letzten 20 Jahre nicht in dem Ausmaß. Aber tatsächlich in den 80er und 90er Jahren hatte man ähnlich große Waldbrände und noch viel größere Waldbrände sogar in den 50er und 60er Jahren. Das heißt, in Mitteleuropa sieht man eigentlich seit den 50er und 60er Jahren auch einen Rückgang der Anzahl und der Größe von Waldbränden. Das war dann auf einem Minimum in den 90er und 2000er Jahren. Und tatsächlich in den letzten Jahren sieht man wieder große Waldbrände, wie wir sie schon vor Jahrzehnten hatten. Warum das so ist, das ist auch noch mal eine ganz interessante Frage. Aber die Fragen stellen Sie ja, nicht ich.
Moderation: Aber, wenn Sie möchten, können Sie die direkt beantworten.
Prof. Dr. Forkel: Genau. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Mitteleuropa viele Wälder eigentlich nicht besonders gepflegt, weil man halt während des Krieges nicht dafür die Zeit hatte, um sich um den Wald zu kümmern. Und dann in den 50er Jahren wurden viele Wälder neu angepflanzt, vor allem in Norddeutschland oder in Polen mit Kiefern. Junge Kiefern stehen in der Regel sehr dicht, haben die Äste auch bisher unten, und wenn dort ein Waldbrand auftritt, kann dieser Waldbrand sich relativ schnell ausbreiten von einem jungen Kiefernbaum zum nächsten und dabei auch eine große Energie freisetzen und sehr stark werden. Mit der Zeit wachsen die Kiefern, die werden älter, der Wald wird durchforstet, es werden also einzelne Bäume herausgenommen. Es bleiben nur noch größere stehen, damit man halt mehr Holz produzieren kann. Und damit reduziert sich auch so ein bisschen diese Waldbrandgefahr, weil wenn ein Feuer auftritt, es nur noch am Boden brennt und in der Regel nicht mehr bis in die Baumkronen hinein brennt. Also das ist ein Faktor, warum dann in den 60er, 70er und 80er Jahren es in Mitteleuropa weniger Waldbrände gab, weil einfach diese Kiefernwälder älter geworden sind. Ein anderer Faktor ist, insbesondere in Polen und auch in Ostdeutschland, in der DDR wurde das Waldbrandmonitoring, die Vorbeugung verbessert. Jetzt sind wir eigentlich schon beim dritten Teil. Ich könnte das jetzt aussparen für zu Ende. Wie Sie möchten oder ich sage es jetzt.
Moderation: Dann sagen Sie es einfach.
Prof. Dr. Forkel: Dann sage ich es einfach jetzt. Ja. Genau. Also, es wurden in den 70er und 80er Jahren in der DDR ein Monitoringsystem eingeführt für Waldbrände. Sie haben es vielleicht gesehen, in Brandenburg stehen manchmal im Wald solche Türme. Das sind die Feuerwachtürme. Die wurden eigentlich schon um 1900 erfunden, in der Lausitz. Die waren lange Zeit bemannt. Also im Sommer bei den heißen und trockenen Perioden saß da eine Person obendrauf und hat geschaut, ob es irgendwo Rauchentwicklung gibt. Und da kann man dann im Prinzip feststellen aus der Richtung, man hat so ein Netzwerk von Türmen, wo trat der Waldbrand auf? Und dieses System dieser Feuerwachtürme wurde dann in den 60er und 70er Jahren eigentlich in ganz, in den Kiefernwäldern in Nordostdeutschland und auch in Polen ausgebaut. Das heißt, man konnte Waldbrände viel schneller entdecken. Es kam dann hinzu, auch der Wetterdienst hat ja im Prinzip die Waldbrandgefahr berechnet. Sie kennen vielleicht alle dieses Eichhörnchen manchmal in den Wäldern, wo dann die Waldbrandwarnstufe steht. Das ist eine Erfindung aus der DDR, die in den 70er Jahren eingeführt wurde. Vom Wetterdienst wurde diese Waldbrandgefahr berechnet. Es wurde intensiv in den Schulen unterrichtet über die Waldbrandgefahr. Das heißt, es wurde ein Bewusstsein geschaffen. Und das sind alles Faktoren, die zu einem Rückgang dieser Waldbrände geführt hat.
Moderation: Danke. Ich würde jetzt erstmal mit dem Thema zwei weitermachen und wir schließen dann später wieder auf. Mit Satelliten erforschen – bezieht sich erstmal generell gefragt Umweltfernkunde hauptsächlich auf die Arbeit mit Satelliten oder wird da auch noch andere Technik genutzt?
Prof. Dr. Forkel: Also Fernerkundung ist eigentlich die Beobachtung der Erde mit elektromagnetischer Strahlung und mit verschiedenen Sensorsystemen. Also elektromagnetische Strahlung heißt wir nutzen zum Beispiel das Licht, wir nutzen infrarote Strahlung oder wir nutzen Mikrowellen, um etwas zu messen, um etwas zu beobachten. Und diese Sensoren können auf Satelliten sein. Die können aber auch auf Flugzeugen sein, oder die können auf Drohnen sein. Ja, das würde man alles als Fernerkundungssysteme bezeichnen. Wir arbeiten in der Regel mit Satelliten-Systemen, aber auch Kollegen von uns an der TU Dresden die arbeiten mit Drohnen-Systemen und andere arbeiten mehr mit flugzeugbasierten Systemen. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Sie sehen hier, ich kann es dann auch rumgeben, ein Satellitenbild von einem Waldbrand in Australien im Jahr 2020. Da gab es ja diesen schwarzen Sommer in Australien. Also sprich, das war bei uns Weihnachten 2019, 2020. Und was Sie auf diesem Satellitenbild erkennen können, ist ja tatsächlich, wo gerade die Waldbrände brennen, also die Feuerfront. Das sind diese rot, gelb, orangenen Farben. Und sie sehen auch diese Rauchwolken. Also was man mit Satelliten da erkennen kann, ist einerseits Feuer, die gerade brennen. Aus diesen Farben kann man ableiten wie intensiv ist der Waldbrand, mit welcher Temperatur brennt er? Und im Prinzip mit anderen Satellitensystemen könnte man auch quantifizieren diese Rauchwolken aus was sind die denn zusammengesetzt? Also zum Beispiel wie viel Kohlenmonoxid ist da drin, wie viel Stickoxide, wie viel Methan, wie viel Feinstaub wird freigesetzt? Genau. Ich fange mal hier an! Sie können sich das anschauen und dann weitergeben. Ich habe auch ein weiteres Bild noch mit. Ja, mit Satellitensystemen kann man wie auf dem ersten Bild so einen einzelnen Waldbrand beobachten. Aber wir können im Prinzip ja auch ganze Kontinente beobachten. Hier sehen Sie Südamerika. Das ist auch im Jahr 2020. Und Sie sehen hier auch diese gelb orangenen Flecken überall. Das sind Waldbrände, die im Jahr 2020 in Südamerika, also südlich des Amazonasregenwaldes, aufgetreten sind. Und hier oben habe ich auch noch mal hingeschrieben, was das Ausmaß von diesen Waldbränden hier war. Also im Jahr 2020 wurden bei diesen Waldbränden etwa 91.000 Quadratkilometer Fläche verbrannt im Amazonasgebiet. Das muss man sich vorstellen. Das ist etwa fünf Mal die Landesfläche von Sachsen komplett abgebrannt und es wurden etwa freigesetzt 370 Millionen Tonnen, also 370 Millionen Tonnen Biomasse wurde verbrannt, die dann entweder in die Atmosphäre emittiert wird oder auch als Holzkohle verbleibt. 370 Millionen Tonnen. Stellen Sie sich vor, so ein Kleinwagen wiegt eine Tonne, so ein Kleinwagen, also 370 Millionen Kleinwagen an Masse wurden da verbrannt. Genau. Ich habe noch eine Abbildung. Ja, man kann sich dann mit Satellitensystemen anschauen erstmal wo brennt es, wie intensiv brennt es? Man kann sich anschauen, was für Gase werden da freigesetzt? Man kann sich aber natürlich auch anschauen: Was brennt denn da eigentlich? Also diese Karte zeigt auch Waldbrände im Jahr 2020 im Amazonasregenwald und hier sind in verschiedenen Farben dargestellt, ja verschiedene Brandtypen. Also in Gelb: es haben zum Beispiel Savannen und Grasländer gebrannt. In Blau: das waren eher landwirtschaftliche Flächen. In Grün: Wälder. Und Rot: das sind solche Waldbrände, wo im Prinzip der Regenwald abgeholzt wird. Wenn man sich das flächenmäßig anschaut, dann sieht man ja in der Amazonasregion in Südamerika die meisten Brände, die da auftreten, sind Savannenbrände. Aber was verbrannt wird an Biomasse, kommt in der Regel von Waldbränden oder halt von diesen Abholzungsbränden des tropischen Regenwaldes. So gebe ich dir auch mal weiter. Genau. Die anderen Abbildungen gebe ich später weiter. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
Moderation: Das heißt, was bekommen Sie an Daten? Bekommen Sie Bilder und dann Tabellen oder wie sieht das dann aus?
Prof. Dr. Forkel: Also ganz unterschiedlich. Wir bekommen zum Teil Satellitenbilder, Aufnahmen, die wir selbst auswerten, wo wir dann also zum Beispiel versuchen, erst mal aus den Bildern zu extrahieren, was ist die abgebrannte Fläche? Weil auf so einem Bild sieht man ja eine Mischung an allen möglichen. Man sieht da die Wälder, man sieht die Städte, man sieht Gewässer, man sieht ist es grün oder weniger grün und man sieht zum Beispiel eine verbrannte Fläche. Ja, das könnten wir, wenn wir auf das Bild schauen, relativ schnell sehen, dass es irgendwo eine verbrannte Fläche gibt. Aber wenn man diese Fläche berechnen will, wie groß die ist, muss man die erst mal extrahieren. Das heißt, früher wurde das gemacht, indem jemand sich diese Bilder angeschaut hat, im Prinzip manuell visuell ausgewertet hat. Heute macht das niemand mehr manuell, sondern das passiert mit Computeralgorithmen. Das heißt, da haben wir verschiedene Methoden, um dann so eine Brandfläche zu extrahieren und können dann berechnen zum Beispiel wie groß ist die Fläche? Und wenn wir jetzt Bilder nehmen aus verschiedenen Zeitpunkten, verschiedenen Jahren und jedes Mal diese Brandfläche extrahieren, im Prinzip, dann können wir Tabellen erstellen, um so eine Statistik zu bekommen über die Größe der Brandflächen. Zum Teil nutzen wir aber auch andere Daten von Satellitensystemen, die schon vorher von jemand anderes ausgewertet wurden. Also es gibt zum Beispiel Satellitensysteme, die messen die Energieemissionen aus Waldbränden. Und da gibt es zum Beispiel durch die NASA, also die amerikanische Weltraumbehörde oder auch durch die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, schon fertige Algorithmen, die dann die Informationen bereitstellen, wo traten Feuer auf und wie intensiv war das? Das heißt, da präzisieren wir gar nicht mehr selbst so viel von den Daten, sondern nutzen die vorhandenen Daten und werten diese aus.
Moderation: Okay, ich habe das Thema auch in meinem Bekanntenkreis ein bisschen herumgereicht und die meisten haben bei dem Wort vermeiden gestutzt. Haben, können Sie das kurz erklären, wie man quasi mit diesen Daten Waldbrände vermeiden kann?
Prof. Dr. Forkel: Also das Vermeiden ist natürlich ein bisschen überspitzt, ja. Weil die meisten Waldbrände entstehen weltweit durch menschliche Ursachen. Ja, man sagt weltweit 70 % der Brände sind menschgemacht. Hier in Mitteleuropa, in Deutschland sind es über 90 %, 95 % der Brände sind menschgemacht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann natürlich Brandstiftung sein, das kann Unachtsamkeit sein. Also Leute machen Lagerfeuer und denken nicht wirklich nach, dass das einen Effekt haben könnte. Was wir auch vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, in Deutschland und Mitteleuropa Probleme haben, sind landwirtschaftliche Maschinen, die in Brand geraten, zum Beispiel bei der Ernte und dann ein Feldbrand verursachen. Es gab auch in Schweden Untersuchungen, was die größten Ursachen für Waldbrände sind. Und da sind es tatsächlich forstliche Maschinen, also solche Harvester, die einfach bei hohen Temperaturen und dann tritt ein Steinschlag auf, auch so ein Funkenflug verursachen können und dann auch einen Waldbrand verursachen können. Das heißt, die Ursachen für Waldbrände sind zwar menschgemacht, aber das muss nicht immer heißen jemand zündet den Wald an, sondern es können auch einfach Unfälle sein. Das heißt, das können wir jetzt nicht wirklich mit Satelliten vermeiden. Ja, aber was wir machen können, ist wir können im Prinzip Informationen liefern darüber, wo ist denn die Waldbrandgefahr oder das -risiko relativ hoch? Das heißt, wir können zum Beispiel mit Satelliten natürlich nicht nur sehen, wo tritt gerade ein Waldbrand auf, sondern wir können auch sehen, wie sieht denn der Wald aus vor so einem Waldbrand? Also wir können kartieren, wo gibt es Laubwälder, wo gibt es Nadelwälder? Wir versuchen zu kartieren, was wächst denn am Boden? Wobei das relativ schwierig ist. Also ist das jetzt eine sehr dichte Vegetation? Gibt es da Büsche im Unterwuchs oder ist das frei? Und daraus kann man dann abschätzen, was ist denn die Gefahr, dass dort ein Waldbrand auftritt? Und wie würde sich denn der Waldbrand verhalten? Das heißt, das ist das eine. Wir können diese Vegetation kartieren und wie waldbrandanfällig ist die? Und zum anderen könnten wir, können wir natürlich auch kartieren, was ist denn gerade der Zustand der Vegetation? Also sind die Wälder trocken, sind die Wälder feucht? Aus Satellitensystemen können wir von oben ja auch sehen, ob ein Wald frisch und grün aussieht, das heißt relativ feucht ist oder ob er eher so gelb verfärbt ist, das heißt relativ trocken ist. Und daraus können wir dann abschätzen, was ist der Feuchtegehalt in der Vegetation, in den Blättern, in den Büschen? Und das dient als Information auch für die Waldbrandgefahr. So was Ähnliches berechnet ja der Deutsche Wetterdienst. Der Deutsche Wetterdienst berechnet den Waldbrandindex, den Waldbrandgefahrenindex, der im Prinzip eine Aussage darübermacht: Wie trocken ist das Streumaterial, wie hoch sind die Temperaturen, wie stark ist der Wind? Und daraus wird dann am Ende diese Waldbrandstufe berechnet. Das heißt, wenn wir diese Informationen haben und dann zum Beispiel sehen entweder vom Wetterdienst aus Wetterdaten oder aus Satellitendaten, wir haben gerade eine ganz hohe Waldbrandgefahr in einem bestimmten Waldbrandgebiet, dann können wir die Informationen natürlich weitergeben an Forstbehörden. In Sachsen ist es so der Deutsche Wetterdienst gibt den Waldbrandindex weiter an den Sachsenforst und dann weiter an die Landkreise und Gemeinden. Die geben dann die Waldbrandgefahrenstufe raus und können dann entscheiden, was sie machen, zum Beispiel den Wald schließen oder im Nationalpark nächtliches Betretungsverbot ausrufen. Das heißt, damit würde man verhindern, dass Leute in den Wald gehen und möglicherweise unbewusst ein Feuer verursachen. Das heißt, wir bieten Informationen, die genutzt werden können, um solche Maßnahmen dann zu ergreifen. Was wir sicherlich nicht machen können, wenn jemand vorsätzlich den Wald in Flammen setzen will. Also ich meine, dann kann man den Wald schließen, aber dann hat man trotzdem keine Chance. Ja.
Moderation: Wie würden Sie das Management von Waldbränden hier in Deutschland momentan einschätzen? Gibt es da Luft nach oben? Läuft das schon ganz gut?
Prof. Dr. Forkel: Das hängt sehr davon ab, wo man ist in Deutschland. Also das wird überall anders gemanagt. Ja, im Prinzip was die jeweilige Gemeinde oder ein Landkreis mit der Information der Waldbrandgefahrenstufe macht, hängt eigentlich davon sehr ab, wer in dem jeweiligen Landkreis dafür zuständig ist und ob der Landkreis schon Erfahrung mit Waldbränden hatte. Also in Teilen Deutschlands, die bekommen diese Waldbrandgefahrenstufe und da wird dann keine Konsequenz gezogen, weil es hat dort nie gebrannt. Ja, und dann gibt es Regionen in Deutschland, Landkreise, da weiß man natürlich, Brandenburg, Nordsachsen, bei Waldbrandgefahrenstufe ziehen wir hier eine Konsequenz. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt in Deutschland ein einheitliches Muster oder Verfahren, wie man damit umgeht, sondern das ist regional, lokal sehr, sehr anders. Insgesamt würde ich einschätzen, Brandenburg und Nordsachsen hat da durchaus aufgrund der Erfahrung der größeren Waldbrände in diesen Kiefernwäldern auf den trockenen Böden viel Erfahrung und ist auch am weitesten, auch Sachsen-Anhalt, zum Teil Niedersachsen. Es gibt in Brandenburg ja ein Monitoring Center, oder? Ich weiß gar nicht, mir fehlt genau jetzt der Name. Louis, du weißt, wie heißt das? Auf jeden Fall laufen da die Informationen zusammen von den Feuerwachtürmen. Da sitzen im Prinzip die Leute vor einer Monitorwand und sehen die Informationen von diesen verschiedenen Feuerwachtürmen. Die fließt dort automatisch ein. Und dann sehen die: Aha, hier wurde was detektiert und die da sitzen ja Personen 24 Stunden in dem Lagezentrum und schätzen dann aufgrund der Kameraaufnahmen ein, hier gibt es einen Waldbrand. Und dann, ja, wenn es schnell geht, innerhalb von sieben Minuten ist die Feuerwehr da. Also das ist wahnsinnig schnell, in Brandenburg und Nordsachsen. In anderen Teilen Deutschlands hat man null Erfahrung mit Waldbränden und da gibt es sowas überhaupt nicht.
Moderation: Sollte es das da geben?
Prof. Dr. Forkel: In der Zukunft ja. Ja, also manche Leute sagen in Deutschland Waldbrand ist nicht wirklich was, worum man sich kümmern muss, weil Deutschland ist gut aufgestellt. Ich würde sagen ja. Einige Teile in Deutschland ja, aber nicht alle. Es gibt ja Teile in Hessen, Nordrhein-Westfalen, die hatten nie Waldbrände. Und in den letzten Jahren haben sie festgestellt: Oh, das wird bei uns ein Thema, jetzt gibt es bei uns auch Waldbrände. Und es gibt jetzt in ganz vielen Bundesländern im Prinzip ja Initiativen in der Forschung, in der Verwaltung, die sagen, wir müssen uns irgendwie besser aufstellen und besser vorbereiten. Und eigentlich müssen wir noch ganz viel lernen, wie man Waldbrände überhaupt erkennt, wie man die denn vorbeugen kann. Wir müssen im Prinzip auch unseren Feuerwehren sagen: Wie bereitet ihr euch darauf vor? Wie geht ihr so einen Waldbrandeinsatz überhaupt an? Weil die meisten Feuerwehren, die meisten freiwilligen Feuerwehren in Deutschland wurden nie dafür ausgebildet, einen Waldbrand zu bekämpfen. Und die gehen dann zu einem Waldbrand im Prinzip mehr oder weniger in der gleichen Ausrüstung, wie sie ein Fahrzeug- oder Gebäudebrand bekämpfen würden. Und stellen dann fest, es ist viel zu heiß in der Ausrüstung, ich bin viel zu unbeweglich. Ja, mit dieser Schutzausrüstung, mit der ich einen Gebäudebrand bekämpfen kann, kann ich nicht durchs Gelände, durch den Wald laufen. Und da gibt es, also da müssen auch im Prinzip viele Feuerwehren, die bisher dieses Problem noch nicht hatten, tatsächlich lernen und auch Kurse und Ausbildungen entwickeln, um sich in Zukunft da darauf vorzubereiten.
Moderation: Also Sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass es in Zukunft mehr dieser Waldbrände geben wird.
Prof. Dr. Forkel: Genau. Genau. Also man sieht das. Naja, der Hauptgrund ist, aufgrund des Klimawandels steigen die Temperaturen an und grundsätzlich ja, das ist Physik, steigende Temperaturen heißt, es kann grundsätzlich mehr Wasser in der Luft gespeichert werden. Das heißt, diese trockene Atmosphäre bei hohen Temperaturen zieht im Prinzip mehr Wasser aus der Streu oder aus kleinem Holz, aus Holz, aus der Vegetation heraus. Das heißt, die Vegetation trocknet mehr aus und damit steigt rein von den Wetterbedingungen die Waldbrandgefahr.
Und Ja, wenn man Klimadaten sich anschaut aus den letzten 30, 40, 50 Jahren, sieht man, dass weltweit die Waldbrandgefahr zunimmt, überall, eben aufgrund der Temperaturanstiege. Und wenn man sich dann Klimamodelle anschaut, dann sieht man, dass auch das im Prinzip weltweit auch diese Waldbrandgefahr aufgrund des Klimawandels zunimmt. Und was interessant ist, wenn man das für Europa auswertet, diese Klimamodelle, dann sieht man tatsächlich, dass die größten Anstiege der Waldbrandgefahr in Europa in den Mittelgebirgsregionen in Mitteleuropa auftreten, also bei uns Erzgebirge, Lausitzer Gebirge, Riesengebirge, Alpenraum. Dort erwartet man wirklich die größten Anstiege der Waldbrandgefahr aufgrund des Klimawandels. Das heißt dann ja natürlich noch nicht, dass es auch brennt. Ja, ob es dann brennt, hängt davon ab, ob ein Feuer entsteht und auch davon, wie die Vegetation zusammengesetzt ist.
Ja, das ist ein großes Stellrad. Grundsätzlich sagt man oder weiß man, dass Nadelwälder brandgefährdeter sind. Also die Konifere, unter der wir sitzen, ja, die könnte relativ gut brennen. Solche Nadelbäume sind voll mit ätherischen Ölen. Sie können auch mal im Internet auf YouTube schauen: Feuer und Konifere. Da gibt es ganz interessante Videos, wo jemand in seinem Garten den Grill zu nahe an der Konifere anzündet und dann ist der Wind stark und die Koniferenhecke ist innerhalb von fünf Minuten komplett abgebrannt. Ja. Also sprich, Nadelwälder sind erstmal gefährdeter als Laubwälder, zumindest in Mitteleuropa. Ja, und ob es dann in Zukunft mehr und intensive Waldbrände gibt, hängt auch stark davon ab, wie der Wald in Mitteleuropa umgebaut wird. Wir haben ja momentan vor allem Nadelwälder, also im Mittelgebirgsraum eher die Fichtenwälder, im Norddeutschen Tiefland eher die Kiefernwälder. Die sind waldbrandgefährdeter. Es gibt ja schon seit langem den Trend, diese Wälder umzubauen mehr zu Laubwäldern oder Mischwäldern. Da würde man davon ausgehen, dass solche intensiven Waldbrände und großen Waldbrände nicht mehr auftreten. Aber man hat in den letzten Jahren tatsächlich auch gesehen: Auch Buchenwälder und Eichenwälder haben gebrannt. Ja, es gab zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr in Österreich ein Buchenwald, der ein sogenanntes Vollfeuer gehabt hat, also wo sogar die Baumkronen gebrannt haben, ein Buchenwald. Ja, das hat niemand damit gerechnet, dass das überhaupt möglich ist. Aber im Prinzip es war so trocken, der Wind war so stark, dass sogar so ein Buchenwald gebrannt hat. Das heißt, man geht davon aus, mit Laubwäldern wird es weniger und weniger intensiv brennen. Aber tatsächlich, ob das ausreicht in Zukunft? So richtig sicher ist man sich dann nicht aus diesen Erfahrungen, die man hatte.
Moderation: Okay, dann danke erstmal bis jetzt. Wir haben unsere halbe, erste halbe Stunde ist durch. Das heißt, das Wort geht jetzt an Sie, dass wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Gedanken zu dem Thema, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, diesen Experten dazu auszuquetschen. Also noch mal kurz. Ach, da geht es schon los. Ich komme mit dem Mikrofon. Bis gleich. Ich schlängele mich mal hier durch. So.
Gast A: Dankeschön. Eigentlich habe ich zwei Fragen: Ich fange mal mit der wahrscheinlich wirklich leichteren an. Du hast vorhin in meiner Wahrnehmung Savannenbrände und Waldbrände gleichgesetzt, also bei der Verrechnung der Waldbrandfläche. Und für mich ist Savanne nicht unbedingt Wald. Das wäre so meine erste Frage, warum man das so gegenrechnet.
Prof. Dr. Forkel: Naja, also es gibt so ein Interesse zu wissen, was ist weltweit die gesamte Fläche von allen Waldbränden oder Vegetationsbränden und da rechnet man dann Wälder und Savannen zusammen. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Man muss das eigentlich getrennt sich anschauen und dann sieht man eben, dass die Veränderungen in den Savannen ganz andere sind als in Wäldern in Nordamerika oder in Sibirien. Also das ist, da stimme ich dir zu. Man sollte das eigentlich nicht verrechnen. Aber ja, man will weltweit die FAO oder der Weltklimarat will halt solche Statistiken und wissen, was ist weltweit die Brandfläche und dann rechnet man das zusammen.
Gast: Meine zweite Frage, darf ich die noch stellen? Die ist tatsächlich von letzter Woche, ist die entstanden. Deswegen bin ich auch hier, um dich das zu fragen. Da war in den Nachrichten, ich habe aber vergessen wo, der Hinweis, dass Fernerkundler jetzt versprechen, Waldbrände deswegen zu verhindern, weil sie schneller erkennen können, wo die entstehen. Und gleichzeitig gab es dann einen Artikel in so einer ganz berühmten wissenschaftlichen Zeitschrift, die da dagegengesprochen hat und gesagt hat: Das ist ja so ein Heilsversprechen, und eigentlich ist das Quatsch. Wir müssen mehr nach Feuerökologie gucken und mehr mit dem Feuer arbeiten. Und da wüsste ich gerne, was du davon hältst.
Prof. Dr. Forkel: Also ich sag mal, in Deutschland braucht man keine Satellitensysteme, um Waldbrände zu erkennen. Es gibt in Norddeutschland die Feuerwachtürme, da erkennt man einfach viel schneller einen Waldbrand. Weil Satellitensysteme haben zwei Probleme. Erstens: der Satellit schaut ja nicht ständig auf die Wälder, sondern der fliegt um die Erde drum herum und kann dann halt nur einen Waldbrand entdecken, wenn der Waldbrand gerade brennt, wenn der Satellit drüber fliegt. Das Zweite ist: Die Waldbrände brauchen eine gewisse Größe und Intensität, bevor sie überhaupt von einem Satelliten erkannt werden kann. Und tatsächlich die meisten Waldbrände in Deutschland, die sind viel zu klein, die erkennt man gar nicht auf Satelliten. Das heißt, für Deutschland ist das völlig irrelevant zu sagen, man braucht Satelliten, um Waldbrände zu erkennen. Aber andere Regionen der Erde, Kanada, Sibirien, Teile der USA, Brasilien, diese Länder sind einfach so groß, da gibt es oftmals keine andere Möglichkeit, als Satellitensysteme zu nutzen, weil es dort überhaupt niemand in der Nähe wohnt oder auch keine Feuerwachtürme gibt. Das heißt, diese Länder brauchen wirklich die Satellitensysteme, um Waldbrände zu detektieren. Es gibt in der Zeit tatsächlich ganz viele interessante Entwicklungen, um mit Satellitensysteme Waldbränden noch schneller zu detektieren. Da investiert gerade Google ganz stark. Es gibt eine Ausgründung aus der TU München. Die haben zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt ein Satellitensystem entwickelt, um auch kleinere und schwächere Waldbrände zu detektieren. Diese Ausgründung, diese Firma heißt OroraTech und die sind jetzt irgendwie mit Google zusammengekommen. Und Google investiert. Wie genau wer da in wen investiert, das kriegt man nicht so richtig raus. Aber auf jeden Fall verspricht Google jetzt so einen, ja, Schnellerfassungssystem satellitenbasiert für Waldbrände zu entwickeln über die nächsten Jahre und im Prinzip mit kleineren und vielen Satelliten auch dann Waldbrände möglichst schnell zu detektieren. Das heißt, wenn man viele Satelliten im All hat, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass irgendwann ein Satellit auch relativ schnell drüber fliegt und dann kann so ein Waldbrand eher detektiert werden. Da gibt es, glaube ich, hier noch eine Anschlussfrage dazu.
Gast B: Ein Einwurf und Frage
Moderation: Mikrophon kommt.
Gast B: Ja, passt prima dazu: Einwurf und Frage. Was ist mit Wolkenschichten? Ich habe also vergeblich versucht, mit dem Kopernikus System mal ein bisschen durch die Gohrischheide zu stöbern und da war viel zu oft eine dünne Wolkenschicht. Und auch im kurzwelligen Infrarot geht das offenbar nicht durch oder wird zu stark gestreut.
Prof. Dr. Forkel: Genau. Also wenn man Wolkenschichten hat, dann sieht man mit den meisten Satellitensystemen ja nicht die Erdoberfläche. Man sieht nur die Wolken von oben. Das heißt, wenn man im Bereich, es gibt das elektromagnetische Spektrum, wo wir das Licht haben, man hat da die Farben Rot, Grün und Blau, was man auch mit unseren Augen sehen. Und wenn wir jetzt von oben auf die Erde schauen würden, aus einem Flugzeug heraus, dann sehen wir Wolken und sehen nicht, was drunter ist. Die meisten Waldbrände werden erfasst über die Thermalstrahlung, und wenn die Strahlung, die bei einem Waldbrand, die thermale Strahlung stark genug ist, dann kann die zu einem gewissen Maße auch durch Wolken durchgehen. Das heißt, wenn man jetzt Feuer hat, die eher mit geringer Intensität brennen, würde das nicht durch die Wolken durchgehen. Das heißt, die Strahlung muss schon relativ stark sein. Bei diesen Systemen, die zum Beispiel OroraTech oder Google entwickelt, geht man ja davon aus, dass man viele kleinere Satelliten hat. Und wenn man viele Satelliten hat, die dann öfters drüber fliegen, hat man dann die Hoffnung, dass es auch immer wieder mal Lücken zwischen den Wolken gibt, um so einen Waldbrand eher zu detektieren.
Genau. Jetzt beantworte ich noch deine zweite Frage, die noch dahinten war. Es ging ja. Sollte man nicht mehr auf die Ökologie der Waldbrände schauen? Naja, das sind, also das eine ist die Waldbranddetektion und ich glaube, das andere ist mehr, wie kann man Waldbrände besser verstehen und möglicherweise auch vermeiden? Und da gebe ich dir recht, sollte man natürlich auf die Ökologie schauen. Also sprich, was sind die Pflanzen? Welche Eigenschaften haben die Pflanzen? Sind die brennbar? Sind die nicht brennbar? Ja, da kommen wir wieder zur Konifere. Es gibt zum Beispiel, in Kalifornien ist es gang und gäbe, dass die Bevölkerung Empfehlungen bekommt, wie sie ihre Gärten gestalten sollen, damit möglichst das Haus bei einem Waldbrand nicht brennt. Also sprich in welchem Abstand zum Haus sollen welche Pflanzen möglichst nicht angepflanzt werden? Denn wenn bei einem Funkenflug zum Beispiel so eine Konifere entzündet wird, dann brennt die relativ schnell und kann auf das Haus überspringen. Ja, und das ist die Ökologie und das Wissen, was man eigentlich braucht. Was sind die Brandeigenschaften verschiedener Pflanzen? Und dann kann man tatsächlich auch viel besser diese Waldbrände im Kleinen, zum Beispiel im Garten, wenn der in einem Waldbrand gefährdeten Gebiet liegt, managen oder halt auch im Großen sich überlegen, wie man so einen Wald umbaut.
Gast C: Ja, danke. Zum Thema Waldumbau hatte ich jetzt auch gerade noch den Gedanken. Also wenn jetzt die Wälder zunehmend durchmischter werden und das halt nicht einschichtige Wälder sind, dann wird es wahrscheinlich auch viel leichter so zu einem Vollfeuer kommen, oder? Und? Also welche Erfahrungen gibt es da mit jüngeren Bäumen? Ob jüngere Bäume, kleinere Bäume, viel mehr Wasser speichern und eher weniger brennen? Aber gleichzeitig ist der Wald strukturierter und es könnte tatsächlich mehr zum, also zum Waldbrand kommen. Also gibt's da klare Tendenzen, wo man sagen kann, dass so ein durchmischter Nadel-Laubwald vielleicht resistenter ist, aber vielleicht auch nicht.
Prof. Dr. Forkel: Also grundsätzlich weiß man, dass junge Wälder eher mit starken Intensitäten brennen eben. Ja, weil so ein Feuer, also ein Waldbrand entsteht ja in der Regel am Boden und brennt am Boden. Und wenn der Wald jung ist, hat halt das Feuer eher die Chance hoch zu klettern. Das heißt, junge Wälder brennen häufig mit höherer Intensität. Und so ein geschichteter Wald bietet für einen Waldbrand auch eher die Möglichkeit hoch zu wandern in die Baumkronen. Was man gesehen hat, zum Beispiel auch beim Waldbrand vor drei Jahren im Nationalpark Sächsische Schweiz ist, dass da auch die jungen Fichtenbäume, die wirklich frisch und grün aussahen, relativ schnell und intensiv abgebrannt sind. Und das ist aber wieder zurückzuführen auf den Anteil an ätherischen Ölen in diesen Bäumen. Das heißt am Ende, wie stark das Feuer brennt, hängt stark wieder von den Pflanzen ab. Ja, welche chemischen Eigenschaften haben diese Pflanzen? Wie ist, wie sind die zusammengesetzt, wie viel flüchtige Verbindungen, wie viel Monoterpene sind in den Pflanzen drin? Weil das beeinflusst dann tatsächlich, mit welcher Intensität und welcher Geschwindigkeit so ein Feuer die Vegetation abbrennen kann. Das heißt, dass insgesamt zu beantworten ist schwierig.
Gast A: Mir geht der Gedanke einfach nicht aus dem Kopf, dass ich von den Ausführungen, die Sie genannt haben, mit den Wehrtürmen oder Feuertürmen und dem System, das man in der DDR und in Polen angewendet hat. Das hat sich sehr effizient und klug angehört. Und bei mir taucht immer wieder die Frage auf: Schießen wir hier nicht eigentlich mit Kanonen auf Spatzen? Und kann es nicht sein, dass dieses System auch vom Energieaufwand her viel besser anzuwenden ist, zumindest in den europäischen Breiten, wenn ich jetzt mal die großflächigen Sachen rausnehmen würde, und wir damit viel weiterkämen, auch vom Energieverbrauch her, der einfach nur dadurch entsteht, dass ich eine Maschine einschalte, um nachzugucken, wo vielleicht gerade was brennt.
Prof. Dr. Forkel: Also im Vergleich zu Satelliten, meinen Sie?
Gast A: Im Vergleich zu Satelliten. Und in diesem Zusammenhang, das habe ich noch nicht verstanden, die Satellitentechnik an sich, wie funktioniert die? Auf welcher Basis funktioniert die? Welche Energie wird dafür benutzt? Und es gibt ja glaube ich zumindest in der Physik vier Grundenergien und eine davon ist die, mit der wir Wesen auf diesem Planeten grundsätzlich alle miteinander kommunizieren und dem dieser natürlichen Kommunikation, die auch in unserem Gehirn stattfindet, dieser Elektromagnetismus, den jede Pflanze und jedes Tier benutzt zum Leben, wird dieser natürliche Elektromagnetismus nicht überlagert von diesen, von dieser großen Maschine, der wir unsere jetzt, die wir selbst gebaut haben und die wir benutzen. Und kann es nicht sein, dass genau dieser Energieaufwand, den wir benutzen, dazu führt, dass es mehr Waldbrände gibt?
Prof. Dr. Forkel: Also ich fange mit Ihrer ersten Frage an, ob das System der Feuerwachtürme effektiver ist als Satellitensysteme. Ich sage mal, in dicht besiedelten Regionen und flachen Regionen ist es wie in Brandenburg, ist es ein sehr effektives System. Da bräuchte man kein Satellitensystem. Aber es wird schon schwieriger, wenn man in die Mittelgebirgsregionen bekommt oder hier in die Sächsische Schweiz. Sie können da irgendeinen Wachtürmen Feuerwachturm hin bauen, aber sie sehen nur bis zum nächsten Berg. Ja. Das heißt, man müsste da so ein dichtes Netz an Feuerwachtürmen aufbauen, damit man auch wirklich in alle Täler und in alle Winkel hineinschauen kann. Und das ist schon nicht möglich. Das heißt, gerade in den Gebirgsregionen ist es, ist dieses System der Feuerwachtürme nicht geeignet. Man kann versuchen, dann die Kameras, die da genutzt werden, vielleicht auf Bergen, auf Kirchtürmen anzubringen. Das geht schon. Das wird auch teilweise in Alpenländern oder in Slowenien gemacht. Genau. Aber es gibt andere Regionen auf der Erde, also die kann man nicht mit einem Netzwerk von Wachtürmen überspannen, wie den Regenwald oder große Savannengebiete. Da ist dann tatsächlich ein Satellitensystem effizienter. Genau. Ihre zweite Frage war: Wie funktionieren Fernerkundungssysteme? Also mit Fernerkundungssystemen, mit Satellitensystemen misst man immer elektromagnetische Strahlung. Ja, man nutzt dazu, es gibt das Licht, was wir auch sehen. Das Licht hat ja die Komponenten Rot, Grün und blaue Strahlung. Das kann man mit einem Satellitensensor im Prinzip aufteilen. Dann kann man sehen, was ist. Also, es läuft so: Die Sonne bestrahlt die Erdoberfläche und das Sonnenlicht wird reflektiert. Und dann sehen wir, dass die Vegetation, dass die Konifere, dass die grün ist. Warum ist das so? Weil die Vegetation, das grüne Licht, den grünen Anteil des Lichts viel stärker reflektiert als den blauen und den roten Anteil. Der blaue und der rote Anteil des Lichts wird absorbiert von der Vegetation, weil die nutzt diese Lichtenergie für die Photosynthese. Ja, und das Grüne wird etwas mehr reflektiert. Deshalb sehen wir, Vegetation ist grün. Ja, und mit Satellitensystemen können wir dann im Prinzip sehen, wie stark ist die Reflexion von der Erdoberfläche im grünen, blauen oder roten oder dann auch in längeren Wellenlängen im Bereich des Infrarotens, was wir mit unseren Fernerkundungssensoren, unseren Augen nicht mehr beobachten können. Aber mit Satellitensensoren kann man dann auch das Infrarot beobachten oder dann noch längere Wellenlängen, die Wärmestrahlung, also sprich ja die Strahlung, die Wärme, die wir fühlen oder noch längere Wellenlängen, wo wir dann schon einen Millimeter bis Zentimeterbereich kommen. Das sind dann die Mikrowellen, die man dann auch mit Satellitensystemen beobachten kann. Das heißt, was man mit den meisten Satellitensystemen beobachtet, ist eigentlich ganz natürlich die Reflexion oder die Emission von Strahlung von der Erdoberfläche. Das heißt, das beeinflusst uns nicht als Lebewesen, weil wir dem sowieso ausgesetzt sind. Es gibt dann noch andere Satellitensysteme, die Radarsatelliten, die senden selbst Mikrowellen aus. Das müssen Sie sich vorstellen wie Ihre Mikrowelle zu Hause. Das sind ähnliche Wellenlängen. Heißt auch Mikrowelle. Da wird diese Strahlung eingesetzt, um ihr Essen zu erwärmen. Und was da genau erwärmt wird, ist im Prinzip das Wasser in Ihrem Essen. Ja, es gibt schon solche Systeme, auch auf Satelliten. Diese Satelliten senden die Mikrowellen aus und diese Mikrowellen interagieren mit dem Wasser auf der Erdoberfläche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen nassen Boden haben oder eine nasse Vegetation, würde diese Mikrowellenstrahlung noch viel stärker zum Satellit zurück gestreut werden und kann dann gemessen werden. (...) Da müssen Sie aber keine Sorge haben, dass wir durch diese Strahlung, die durch Satelliten ausgesendet werden, jetzt alle erhitzt werden, wie das Essen in der Mikrowelle. Ja, das ist im Prinzip so eine geringe Intensität. Das ist noch mal geringer als die natürliche Ausstrahlung von Mikrowellen der Erdoberfläche.
Gast D: (...) Ja, wenn man das jetzt weiß und daran forscht, also, dass immer häufiger Waldbrände auftreten, auch aufgrund des Klimawandels, gibt es da irgendwelche persönlichen Rückschlüsse, die man auf sein eigenes Verhalten zieht?
Prof. Dr. Forkel: Tja, eigentlich müsste man so leben, um den Klimawandel zu vermeiden. Also ich meine, es ist ja nicht nur das Thema Waldbrand, das durch den Klimawandel betroffen ist. Also diese Waldbrandgefahr steigt an aufgrund des Klimawandels. Das sind ja ganz allgemein und auch die Bedingungen, die zu Waldbränden führen, also Hitzeperioden, Trockenperioden, die durch den Klimawandel häufiger auftreten, intensiver auftreten. Und ja, die Ursachen des Klimawandels kennen wir ja eigentlich alle. Ja, es ist die Verbrennung von fossiler Energie hauptsächlich, es werden Treibhausgase freigesetzt. Und daran sind wir alle beteiligt, indem wir unsere Autos nutzen, indem wir oftmals heizen mit fossiler Energie. Es sind Großkonzerne daran beteiligt, die daran natürlich seit Jahrzehnten gewinnen. Das heißt, wenn man sagen möchte, man möchte ja aufgrund dieses Klimaeffektes Waldbrände vermeiden und auch ganz viele andere Auswirkungen des Klimawandels vermeiden, könnte man natürlich sagen, man muss ein Leben führen, was möglichst keine Treibhausgase freisetzt. Und das ist aber gar nicht so einfach. Ja, also das kann man individuell machen, aber da ist man ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, eigentlich muss sich die weltweite Politik und Wirtschaft ändern.
Gast D: Aber wenn wir jetzt ganz viele Tropfen auf dem heißen Stein sind, wenn wir alle zusammen jetzt also die Parteien wählen, die den Klimawandel sehen, was dagegen machen wollen, die die Konzerne in die Pflicht nehmen wollen. Wenn wir uns immer mehr auf Fleisch verzichten, auf Massentierhaltung verzichten, versuchen uns pflanzlich zu ernähren, versuchen, auf Flugreisen zu verzichten, dann sind wir doch viele, die es im Griff haben. Also wir haben es ja auch produziert, den Klimawandel. Wir sind ja auch die, die es verhindern können.
Prof. Dr. Forkel: Da stimme ich Ihnen zu. Aber das müsste ja weltweit passieren, wenn nur wir das machen…
Gast D: Aber wenn das jeder sagt, dann passiert es halt nicht.
Gast E: Das wird auch nicht passieren.
Prof. Dr. Forkel: Das Ding ist also, ich bin auch der Meinung, dass es relativ schwierig ist. Es ist, Sie haben, ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn wir das weltweit alle machen würden, dann hätten wir das Problem gelöst. Aber sagen Sie das mal gewissen Ländern.
Gast D: Das Argument kann ich nicht gelten lassen, weil zum Beispiel viele sagen, China tut so viel CO2 produzieren. Das stimmt. Aber 3/4 von denen der CO2 Produktion, die die produzieren, produzieren die für uns, weil wir chinesische Produkte kaufen. Also sind wir daran schuld, dass China so viel CO2 produziert.
Gast F: Nichts mehr kaufen.
Gast D: Oder halt nicht aus, oder? Ja, seine Möbel länger behalten. Nicht jeden Fashion Trend mitmachen.
Gast E: Also das weiß ja auch jeder. Aber es wird nicht gemacht, weil es einfacher ist.
Gast F: Man kann sich ja noch nicht mal bei den Plastikabkommen einigen.
Moderation: Ja, aber auf individueller Ebene kann man ja anfangen. Man hat ja auch immer eine Vorbildfunktion. Also ich gehe da schon mit. Man kann das natürlich individuell erstmal machen und auch wählen gehen und entsprechend gucken, dass man manche Konzerne vielleicht unterstützt und andere nicht. Und da zumindest auf der eigenen Ebene ein bisschen was regeln. Ich bin auch ein bisschen optimistischer als Sie das gerade ausgeführt haben.
Gast E: Aber, das Weltklima wird es nicht retten.
Moderation: Sie selber nicht. Aber man kann ja dazu beitragen.
Gast F: Und man tut was für sein Gewissen, so ist es.
Gast B: So ich habe noch was zu Satelliten: Wie weit ist man eigentlich bei der Brandflächenerkennung? Ich meine, in Großenschwand beim Waldbrand hat es auch in Zwischenschichten an der Seite einen großen Bodenbrand gegeben. Der ist nicht in der Statistik und nach zwei Jahren erst, fangen die Kiefernkronen an braun zu werden. Vorher waren sie grün und das sieht man auch auf den Luftaufnahmen. Gibt es da schon Ansätze? Also bei Luftaufnahmen mit Lidar kann man wenigstens Profile erfassen. Aber, ich weiß nicht, wie sieht das aus?
Prof. Dr. Forkel: Naja, also die Schwierigkeit ist tatsächlich, wenn der Waldbrand nur im Unterwuchs brennt und ich sag mal die Baumkronen recht geschlossen sind und unmittelbar nach dem Waldbrand auch immer noch grün sind, dann ist es recht schwer, das mit einem Satelliten zu erkennen und diese Brandfläche zu detektieren. Man hat die Hoffnung, dass man mit höher aufgelösten Satellitensystemen eher durch die Lücken durchschauen kann, dass es die dann auch gibt. Aber das ist relativ schwer. Ja, also es ist eigentlich, so richtig weiter kommt man nicht. Aber was man als Trend in den letzten Jahren sieht, je mehr man Satellitensysteme nimmt, die feinräumiger Dinge beobachten können, umso größer wird die Brandfläche, die man quantifizieren kann. Also mit jedem Satellitensystem korrigiert man die nachher die Zahl. Was ist die weltweite Brandfläche? Es geht immer nach oben. Ja, und dann ist die Frage: Wann hört man irgendwo auf? Also was ist die kleinste Brandfläche? Das Streichholz, was man abgebrannt hat, will man das auch noch quantifizieren?
Gast B: Ja, ganz konkret die Gohrischheide, wir fahren da wahrscheinlich ein, zwei Wochen mal hin, da sind noch ein paar grüne Flecken. In der Gohrischheide sieht man auf den neusten Satellitenbildern ein paar grüne Flecken und wir gucken mal an, wie der Boden aussieht. Das ist vielleicht schon mal ein Aufschluss.
Prof. Dr. Forkel: Genau.
Gast G: Ich habe gleich zwei Fragen. Die erste war, Sie hatten ja erwähnt im Vortrag, dass die Luftzusammensetzung auch gemessen wird. Ich würde erstmal gerne wissen wollen, wie wird die gemessen und wofür werden diese Daten am Ende gebraucht? Und die zweite Frage ist: Mir ist die Idee gekommen, dass man ja mit dem Brandwachturm theoretisch ja auch die Luftzusammensetzung messen könnte. Ähnlich wie bei einem Rauchmelder im Haus. Wäre das nicht eigentlich ein System zusätzlich zum Satellit?
Prof. Dr. Forkel: Genau. Also zu Ihrer ersten Frage: Die Luftzusammensetzung wird gemessen über die Absorptionseigenschaften verschiedener Gase in der Atmosphäre, zum Beispiel Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Methan absorbieren ja in ganz bestimmten Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen Spektrums. Das heißt, es gibt Satellitensysteme, die genau sensitiv in diesen ganz bestimmten Wellenlängenbereichen sind. Und dann sieht man zum Beispiel das Signal, was man von der Erdoberfläche bekommt, der reflektierten Sonnenstrahlung ist ziemlich schwach in dem Wellenlängenbereich, also gibt es offensichtlich eine Absorption der Strahlung durch zum Beispiel Kohlenmonoxid oder Methan. Das heißt, aus diesem Signal kann man abschätzen, wie viel Kohlenmonoxid, Stickoxide, was auch immer in der Atmosphäre ist. Diese Daten werden genutzt, vor allem zur Überwachung der Luftschadstoffe und Luftqualität. Es gibt europaweit ein System, das nennt sich, es gibt das Copernicus System. Das ist im Prinzip das europäische Erdbeobachtungs- und Umweltbeobachtungssystem. Da gibt es Satelliten, aber es gibt auch Wettermodelle Auswertemethoden, und da gibt es ein bestimmtes System. Das ist das Atmosphären-Monitoring-System. Dort fließen diese Satellitendaten zusammen, werden dann kombiniert mit Wettermodellen, um abzuschätzen, wie ist die Verbreitung von solchen Schadstoffen?
Ja, da gab es vor ein paar Jahren ja auch diesen Vulkanausbruch auf Island, wo auch ganz viele Gase freigesetzt wurden. Und das ist eine Information, die ist zum Beispiel wichtig für die Luftfahrt, weil Flugzeuge sollen durch diese Rauchwolken, durch diese Abgaswolken entweder von Vulkanen oder Waldbränden möglichst nicht durchfliegen, weil dann natürlich die Luftqualität in so einem Flugzeug beeinflusst wird. Oder auch man kann damit abschätzen, wo wird denn die Rauchwolke hin transportiert? Ja, wir hatten ja den Fall jetzt vor ein paar Wochen in der Gohrischheide oder auch vor drei Jahren in der Sächsischen Schweiz. Plötzlich haben wir alle gerochen: Oh, hier riecht's verbrannt. Ja, dann macht man sich erstmal Sorgen. Wo kommt das denn her? Brennt es irgendwo hier beim Nachbarn? Aber das ist vielleicht kilometerweit entfernt. Ja, und das sind dann Informationen, die bei den Wetterdiensten zusammenfließen, die dann sagen können: Wir wissen genau, diese Rauchwolke kommt von da. Und wenn bestimmte Grenzwerte dann überschritten werden, kann man halt auch zum Beispiel warnen: Bitte lassen Sie die Fenster zu, weil es ist dann schädlich, ja, diese Zusammensetzung der Rauchwolken. Also da fließen die Informationen zusammen bei den Wetterdiensten, die die Information dann weitergeben.
Zu Ihrer zweiten Frage: Können diese Informationen über den Geruch, über die Zusammensetzung der Schadstoffe auch genutzt werden? Es gibt Entwicklungen von eher kleineren Firmen, die solche Rauchsensoren entwickeln, um im Prinzip auch Waldbrände zu detektieren. Das wurde auch schon getestet, zum Beispiel auch ich glaube, aktuell im Nationalpark läuft da ein Versuch. Da können Sie dann vielleicht im Anschluss den Herrn da drüben fragen dazu. Der weiß da mehr, wo so ein System entwickelt wird, um zu sehen, kann man hier einen Waldbrand detektieren. Also wird auch inzwischen getestet. Aber da muss man solche Sensoren natürlich auch wieder an verschiedenen Stellen aufhängen und am Ende weiß man dann auch nicht bei dem Sensor misst der jetzt einen Waldbrand oder ist das irgendwo ein Grillfest? Ja.
Gast H: Eine Zigarette. #00:58:35‑6#
Moderation: Das Streichhölzchen. So, wir kommen langsam zum Ende der Geschichte. Ich sehe…
Gast D: Ich habe nochmal eine Frage?
Moderation: Ist es eine kurze Frage?
Gast D: Na ja, warum pflanzt man denn überhaupt so viel Kiefern? Nur weil man den Wald nutzen will? Also man könnte ja auch zum Beispiel Obstbäume pflanzen oder so was.
Gast I: Damit die Veganer sich ernähren können.
Prof. Dr. Forkel: Ja, also man hat natürlich in der Vergangenheit viele Fichten im Mittelgebirgsraum oder Kiefern im Tiefland gepflanzt, weil das relativ schnell wachsende Bäume sind und das Holz gut verarbeitet werden kann.
Gast D: Aber es brennt halt auch schnell und dann kann man es nicht mehr verarbeiten.
Prof. Dr. Forkel: Aber es brennt halt auch schnell, genau. Man hat die gleichen Probleme in zum Beispiel Portugal. Da wurden in den 70er Jahren Eukalyptusbäume angepflanzt, weil die einfach sehr schnell wachsen. Die waren gut für die Holzindustrie und seitdem hat man seit den 70er Jahren in Portugal ein großes Waldbrandproblem, weil der Eukalyptus auch noch ätherische Öle enthält. Ja. Also es ist eigentlich immer teilweise ein Konflikt zwischen ja, was will die Holzindustrie? Und dann holt man sich vielleicht ein ganz anderes Problem wieder rein mit den Monokulturen. Also es ist ja nicht nur das Waldbrandproblem, sondern auch die Anfälligkeit gegenüber Insekten. Ja.
Gast D: Aber der Wald ist doch nicht nur für Holzindustrie da, der ist doch auch Erholungsfläche und so was.
Prof. Dr. Forkel: Genau.
Gast D: Er ist Luftqualitätverbesserer.
Prof. Dr. Forkel: Er ist auch für die Luftqualität. Er ist auch Erholungsfläche. Also es gibt tatsächlich die FAO, also die von den Vereinten Nationen. Die Landwirtschaftsorganisation entwickelt inzwischen Empfehlungen, zum Beispiel für solche Mittelmeerregionen, dass die sagen: Ja, lasst uns doch mehr übergehen in diese sogenannte „Agroforestry“, also wo man Wald mit Landwirtschaft kombiniert und kann damit gleichzeitig das Waldbrandproblem reduzieren. Also man hat, nutzt dann Wälder ja mit mehreren Nutzungen. Also man hat einerseits eine Holzproduktion, man hat dann aber darunter zum Beispiel auch eine Viehwirtschaft, Ziegen, Schafe und diese fressen dann noch die Büsche ab und reduzieren damit die Vegetation, die bei einem Waldbrand abbrennen kann. Also es gibt durchaus solche Entwicklungen und Empfehlungen, dass man sagt ja, in bestimmten Regionen, lasst uns doch solche Systeme wieder mehr nutzen. Das gab es ja früher schon und dann können wir mehrere Probleme beseitigen.
Gast D: Aber man muss den Wald privat sein? Ich meine, der ist doch für alle da. Wie viel? Wie viel? Wem gehört denn der Wald?
Prof. Dr. Forkel: Na ja, das kann man so nicht sagen. Das kommt, das hängt ja davon ab, wo man ist. Und da gibt es verschiedene Gesetze in verschiedenen Ländern. In einigen Ländern gehört der Wald ja Privatpersonen oder auch in Deutschland. Ja, es gibt Privatwald, es gibt Bundeswald, es gibt Landeswald. Ich sag mal, wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass wir immer in den Wald gehen dürfen und da auch kreuz und quer laufen dürfen. Und deshalb haben wir auch das Gefühl, der Wald ist für alle da. Aber dieses Recht gibt es ja gar nicht in anderen Ländern. Da kann man nicht einfach kreuz und quer durch den Wald gehen, weil das gesetzlich ganz anders geregelt ist.
Moderation: Gut, eigentlich. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es mich die ganze Zeit anguckt. Ja, was ist das?
Prof. Dr. Forkel: Was ist das? Sie meinen, dass unter dem Teller.
Moderation: Ja.
Prof. Dr. Forkel: Also, ich habe hier. Wir hatten es vorher schon mal, glaube ich angesprochen. Noch mal eine Karte mit vom europäischen Waldbrandinformationssystem. Das sieht man hier so eine Karte mit orangenen und roten Punkten. Das sind im Prinzip die Waldbrände, die es jetzt in der letzten Woche in Europa gab. Ja, also wer daran Interesse hat, der kann auf diese Webseite gehen von dem europäischen Waldbrandinformationssystem und sieht, wo brennt es denn europaweit oder weltweit gerade? Ja, das sind freie Daten, da kann sich jeder anschauen. Kann ich auch noch mal rumgeben. Sie kennen das schon.
Was ich hier auch noch mit habe, ist kein Zauberstab oder auch kein Rohrstock. Das ist ein sogenannter Fuel Stick. Fuel Stick heißt das ist ein Holzstab aus einer nordamerikanischen Kiefernart. Und da gibt es ja zwei so Metallstäbe drin. Diesen Stab schließt man an den Sensor an und dann wird kontinuierlich aufgezeichnet, was der Feuchtigkeitsgehalt dieses Stabes ist. Das ist ein System, das hat sich in Nordamerika, Australien, teilweise im Mittelmeerraum seit Jahrzehnten etabliert. In Deutschland kennt das kaum jemand. Ja, aber damit wird kontinuierlich aufgezeichnet: Was ist die Feuchtegehalt des Holzes? Und wer zu Hause zum Beispiel Feuerholz hat für den Kamin, weiß ja, das verbrennt man im Kamin, wenn es trocken ist. Also in der Regel kleiner 10 %, 15 % Feuchtigkeitsgehalt. Wir haben jetzt vier solche Stationen mit solchen Messstäben eingerichtet, zwei davon im Nationalpark Sächsische Schweiz, zwei im Tharandter Wald, wo wir das kontinuierlich aufzeichnen. In Tschechien gibt es inzwischen ein Netzwerk im gesamten Land mit über 100 solcher Stationen, die das aufzeichnen. Es gibt ein paar solche in Österreich und ja, anhand dieser Messdaten kann man dann kontinuierlich abschätzen, was ist gerade die Waldbrandgefahr? Man kann sich das auch im Internet anschauen. Ich glaube, heute früh, ich habe geguckt im Nationalpark Sächsische Schweiz, da war der Feuchtigkeitsgehalt, die dieser Stab misst, bei 9 %. Also das ist trockenes Feuerholz. Ja. Ja. Und dann muss man sich überlegen, welche Konsequenzen man daraus zieht.
Moderation: Also ist das so ein bisschen Teil des Frühwarnsystems, quasi.
Prof. Dr. Forkel: Das ist Teil des Frühwarnsystems. Also was der Deutsche Wetterdienst für den Waldbrandindex macht, er nützt da einfach Wettervorhersagedaten und rechnet die zusammen. Und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, das am Boden zu validieren. Ob das denn stimmt, was der Deutsche Wetterdienst berechnet oder auch was man aus Satellitendaten abschätzt.
Gast J: Sieht so analog aus. Funktioniert das ganz ohne Satelliten?
Prof. Dr. Forkel: Das funktioniert ganz ohne Satelliten. Man braucht nur einen Sensor und da ist allerdings dann auch eine Batterie drin. Und es gibt dann auch eine SIM Karte drin und das wird über das Mobilfunknetz ins Internet geschickt. Sonst wüsste man es ja nicht, sonst müsste man immer hingehen und nachschauen.
Gast K: Der misst das über die elektrische Leitfähigkeit?
Prof. Dr. Forkel: Genau der misst das. Also man hat die zwei Metallstäbe und über die elektrische Leitfähigkeit da drin wird dann der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt. Und wie gesagt, das Holz ist aus einer nordamerikanischen Kiefer. Das ist im Prinzip so der Standard, das wurde auch dort entwickelt. Das ist also standardisiertes Holz. Inwieweit das repräsentativ ist für Holz hier in Mitteleuropa, also Fichte oder Kiefer, das muss man tatsächlich mal sehen. Da gibt es bisher kaum Untersuchungen dazu, ob denn das Kiefern- oder Fichtenholz genauso schnell auf Änderungen in der Feuchtigkeit reagiert wie dieser Holzstamm.
Moderation: Okay, super, danke schön. Dann sind wir am Ende der Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den anschaulichen und informativen Vortrag. Auch gilt mein Dank Ihnen, dass Sie da sind, waren, Fragen gestellt haben, sich beteiligt haben. Danke für Ihr Interesse. Es gibt im Botanischen Garten regelmäßig öffentliche Führungen, die Sie sich gerne antun können. Antun klingt jetzt so gemein. Die Sie, an denen Sie gerne teilnehmen können. Und dieses Format wird nächstes Jahr dann auch wieder stattfinden. Wir rechnen wir mit so drei oder vielleicht auch vier Veranstaltungen. Das heißt, halten Sie gerne Ohren und Augen offen und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder.
Gäste: Dankeschön.
Applaus
Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg - Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher
Auch 16 Jahre nach dem Ende eines langen Bürgerkriegs (1983-2009) ringt Sri Lanka noch mit der Frage, wie ein neuer, inklusiver Gesellschaftsentwurf aussehen könnte. Die Kunst rückt als Raum für gesellschaftliche Visionen in den Fokus. Ob und wie Kunst innovative Konzepte der (Neu-)Aushandlung nationaler, ethnischer und religiöser Identitäten entwerfen kann, untersucht Stefan Horlacher, Professor für Englische Literaturwissenschaft an der TU Dresden.
Transkription der Audioaufnahme:
Moderation, Caroline Fuhr: Wir haben unsere Koryphäe jetzt auch am Start. Prof. Dr. Stefan Horlacher, Professor für englische Literaturwissenschaft an der TU Dresden, hat an mehreren Universitäten studiert, habe ich gelesen in Mannheim Street, Glide an der Sorbonne, in Cornell in den USA, hat den Habilitationspreis des Deutschen Anglistikverbandes 2004 bekommen und hat mehrere Gastprofessuren in verschiedenen Ländern innegehabt, unter anderem. Und das wird dann fürs Thema auch relevant in Indien und Sri Lanka. Und du arbeitest gerade an einem neuen Buch. Möchtest du kurz nochmal sagen oder den Titel nennen?
Prof. Dr. phil. habil. Stefan Horlacher: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und schön, dass Sie / ihr alle da seid. Ja der Titel dieses Buches. Da muss ich gucken. Das ist immer etwas Längeres bei wissenschaftlichen Sachen. Nennt sich „Contemporary Sri Lankan Literature and Art“, also Gegenwartskunst in Sri Lanka. Und das Ganze hängt zusammen mit oder die Frage, die da dahinter ist, inwiefern kann Kunst, egal ob das Literatur ist, Malerei, Theater oder Performance – Inwiefern kann Kunst dazu beitragen, sagen wir, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern? Also sprich so, es ist relativ anwendungsbezogen, auch so ein bisschen, um meinen Studis zu zeigen, dass wenn man Literatur studiert, dass nicht nur irgendwie so ein Reiche Töchter Studium ist, sondern dass auch selbst so Nette soziale Macht entfalten können.
Moderation: Ja, perfekt. Wir werden uns jetzt 30 Minuten lang unterhalten und dann habt ihr 30 Minuten lang die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn euch innerhalb der nächsten halben Stunde irgendwelche Fragen kommen oder Gedanken oder irgendwas nicht ganz klargeworden ist, dann macht euch gerne eine mentale Notiz oder schreibt es euch wirklich auf und dann habt ihr danach 30 Minuten Zeit, das alles loszuwerden und unsere Koryphäe dahingehend auszuquetschen. Cool. Bevor wir jetzt noch mal so richtig reinsteigen, kannst du noch mal erklären, was das Thema jetzt konkret mit englischer Literaturwissenschaft zu tun hat und wie du auf das Thema gekommen bist?
Prof. Dr. Horlacher: Also englische Literaturwissenschaft umfasst im Endeffekt Texte, die in Englisch verfasst sind. Das heißt, es geht ja nicht nur um Texte aus UK oder England, Irland etc., sondern bis auf die Amerikanistik, die ausgenommen ist, also sprich United States, würde alles, was in Englisch publiziert wird, unter englische Literaturwissenschaft fallen. Das ist der erste große Rahmen und der zweite wäre dann, dass man sagen müsste was ist Literatur, was ist Text? Und da gibt es dann so eine Verschmelzung hin zu den Cultural Studies, dass man eben sagt, Text ist auch oder kann auch Malerei sein. Auch ein Werbespot kann als Text gelesen werden, weil es ihm im Prinzip ja, sagen wir, Bedeutungsgeflechte sind, die wir untersuchen. Und daraus ergibt sich dann eine Literaturwissenschaft, die zum einen durch Englisch weltweit aufgestellt ist und die sich eben nicht nur auf klassische Literatur konzentriert, sondern die sagt alles, was in Zeichenform daherkommt, kann potenziell Gegenstand der Analyse werden. Und dadurch wird das Fach, denke ich, auch sozial oder gesellschaftlich sehr viel relevanter, weil es eben jetzt nicht darum geht, eine traditionelle Literaturgeschichte von Joyce oder Shakespeare bis in die Gegenwart nachzuverfolgen. So als erster Einstieg.
Moderation: Ja, und wie bist du auf das Thema konkret gekommen? Auf Sri Lanka?
Prof. Dr. Horlacher: Auf Sri Lanka? Ja, ich war 86 mit dem Rucksack in Sri Lanka für drei Wochen und habe das dann danach ad acta gelegt, aber war sehr beeindruckt. Und dann hatten hatte eine Nachbar Professor hier, Thomas Kühn, hatte einen Austausch mit Hyderabad in Indien und ich war dann 2008 und 2010 in Indien. Und als der Austausch dann zu Ende ging, was normal ist, wenn immer nur gewisse Perioden gefördert, sind wir noch mal nach Sri Lanka gereist, also zum ersten Mal seit Langem. Und ich fand es wieder genauso faszinierend wie damals und habe danach einfach geschaut, Welche Universitäten gibt es in Sri Lanka, Welche Kollegen sind dort, Was machen die? Und habe die dann gezielt angeschrieben und gefragt, ob sie an einem Austausch Interesse haben und bin dann hingeflogen mit Unterstützung der TU Dresden. Und wir haben einen Austausch vereinbart. Also seit 2019 gehen immer im Wintersemester drei Studierende aus Sri Lanka nach Dresden, werden hier komplett, also mit einem Vollstipendium für ein Semester. Und im Sommersemester gehen drei Studierende aus Dresden nach Colombo. Die sind jetzt vor drei Tagen dort angekommen und entdecken gerade die Stadt und haben mir heute ihre Learning Agreements geschickt, wo wir jetzt nachrechnen. Und das läuft jetzt seit 2019, das läuft, ist total erfolgreich und gleichzeitig haben wir noch einen Austausch auf Professorenebene, dass einmal im Jahr jemand aus Sri Lanka zu uns kommt und unterrichtet, ein Seminar anbietet und jemand von uns nach Colombo fliegt und daran ankoppelt, hatten wir dann ein Forschungsprojekt, aus dem das Buch hervorgegangen ist.
Moderation: Perfekt. Danke fürs Einordnen. Ich lese noch mal das komplette Thema vor, was wir heute haben, weil ich nicht weiß, ob das alle so auf dem Schirm haben. Und zwar der Titel lautet: „Die Macht der Kunst: Sri Lankas Neuanfang nach 26 Jahren Bürgerkrieg“. Jetzt ist Sri Lanka, glaube ich, nicht ein Thema, was in Deutschland super präsent ist, wo jeder viel Ahnung von hat. Könntest du kurz uns einen kurzen geschichtlichen Abriss geben, was so, also nicht die komplette Geschichte von Sri Lanka, also rund um die Bürgerkriege.
Prof. Dr. Horlacher: Also jeder kennt ja Sri Lanka wegen Ayurveda. Das ist der Hotspot überhaupt und die haben auch ganz tolle Hotels. Also wenn jemand hinfliegen will, ich kann es nur empfehlen. Aber darum geht es hier eigentlich nicht, sondern wobei der Fokus des Projekts ist weder geschichtlich noch historisch. Das ist einfach jetzt nur so als grobe Rahmung. Es gibt, glaube ich, weltweit kein Land, das länger Kolonie war als Sri Lanka. Und das ist wirklich schon ein Weltrekord. Die wurden, ich glaube um 1506 / 1508 zum Ersten Mal von Portugal kolonialisiert, die sich an der Küste breit gemacht haben für Handelswege. Danach kamen die Niederländer und danach kamen die Briten. Und das dauerte bis 1948. Und das heißt, dass es da durch die Kolonialisierung auch zu einer internen Verschiebung gekommen ist, was die Bevölkerung betrifft.
Also zum Beispiel gab es früher in Sri Lanka keinen Tee. Und die hatten Kaffee. Der wurde versucht anzubauen. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist, die Engländer sind dann zu Tee umgeschwenkt und brauchten natürlich auch Arbeiter. Und haben dann sehr viele Tamilen aus Südindien im Prinzip importiert, die dort auf den Teeplantagen im Innern des Landes arbeiten, was dazu führt, dass sich das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen verschoben hat.
Also es gibt, in Sri Lanka gibt es Singhalesen, das sind über 70 %. Dann gibt es Tamilen, das sind so knapp 15 %, ein Teil davon im Norden von Sri Lanka in Jaffna. Die waren schon immer da. Also die rivalisieren mit den Singhalesen. Wer ist länger dort? Aber es gibt auch rund 5 % der Gesamtbevölkerung, die eben über die Engländer importiert wurden. Und die hatten kurz nach der Unabhängigkeit von Sri Lanka 48 hatten die nicht mal die Staatsbürgerschaft. Also die wurden schon immer eigentlich abgelehnt von den Singhalesen und von den Tamilen, die schon immer da waren genauso, weil die haben einfach runtergeschaut und gesagt, das ist eine ganz andere Kaste, ganz andere Klasse, mit denen haben wir nichts zu tun. Und das Problem war dann, dass zusätzlich haben sie in Sri Lanka noch Bürger, das sind Nachkommen der Portugiesen, der Niederländer. Sie haben auch unheimlich viele portugiesische Namen, wenn Sie sich das angucken. Das heißt nicht, dass alle, wenn die einen portugiesischen Namen haben, jetzt auch noch wirklich irgendwie von dort stammen. Aber das ist ein ganz interessantes Gemisch.
Und was passiert ist dann 48 mit der Unabhängigkeit war, dass die Singhalesen, die die Mehrheit sind und die in der Regel buddhistisch sind, sich ihre tamilische Minderheit angeguckt haben und haben gesagt, die haben eigentlich die bessere Ausbildung zum Teil, die sind in besseren Positionen und wir möchten das ändern, weil die Briten hatten Tamilen nicht nur als Plantagenarbeiter, die hatten auch Tamilen in der Verwaltung und von daher waren diese Tamilen, die eben schon länger in Sri Lanka waren, seit 2000 Jahren oder so und die Teil der Verwaltung der Briten waren, hatten die sehr gute Position in der Regierung und hatten viel mehr Bildung als die meisten Singhalesen. Und daraufhin hat die singhalesische Mehrheit beschlossen, im Endeffekt dagegen vorzugehen und hat, das erste war, dass diese 700.000 Arbeiter, die im Landesinnern waren, dass die um ihre Staatsbürgerschaft fürchten mussten. Und dann kam es eigentlich immer wieder zu Pogromen oder zu Verfolgungen.
Also es gab 1956 ein Sinhala Only Act, das hieß, dass die Verwaltungssprache auf Sinhala geändert wurde und Sinhala ist eine, finde ich, extrem schwierige Sprache. Also ich versuche gar nicht erst, mich daran zu probieren. Tamil auch. Und die beiden Sprachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Vorher hat man Englisch noch gehabt, als Verwaltungssprache wegen den Briten. Das haben viele ehemalige Kolonien gemacht, dass die sagten, wir wollen erst mal von der Sprache der coloniser weg. In dem Moment, wo aber dann Sinhala als einzige Verwaltungssprache propagiert wird, hieß das, dass die ganzen Tamilen, die noch irgendwo Funktionen hatten, genau zwei Jahre Zeit hatten, Sinhala zu lernen. Mündlich und schriftlich. Ansonsten wurden sie entfernt. Gleichzeitig hat man den Zugang der Tamilen zu Universitäten, zur höheren Bildung usw. kategorisch restringiert. Das heißt man hat die systematisch eigentlich an den Rand gedrängt.
Und dann gab es natürlich Widerstände und es gab, also es gibt so eine ganze Reihe, das ist eine Riesentabelle, wenn man sich das anguckt, seit 48. 1983 zum Beispiel, wo in Colombo viereinhalbtausend bis fünftausend Tamilen gestorben sind, weil der Mob aus den Erlösen einfach quer durch die Stadt gezogen ist. Da haben ganze Häuserreihen gebrannt, und die wussten auch haargenau wo wohnen tamilische Familien und wo sind singhalesische. Das heißt, sie hatten zehn niedergebrannte Häuser, zwei blieben stehen, weil die wussten einfach von der Stadtverwaltung, wo welche Gruppe wohnt. Und bis dann die Regierung eingeschritten ist, hat das noch mal zwei Tage gedauert. Das heißt, man kann sagen, dass da über 20, 30 Jahre immer wieder mal systematisch gegen diese Minderheit sehr gewaltsam vorgegangen wurde. Und das führte letztlich dann 83 zum Ausbruch des Bürgerkriegs. Also vorher hatten sich, glaube 75, wo die Library, die Bibliothek in Jaffna niedergebrannt wurde, 90.000 Bücher verbrannt plus also Palm-Manuskripte etc., die alle nur einmal existierten. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass es irgendwann dann, wie gesagt 83 in den Bürgerkrieg gemündet ist, der bis 2009 mit Unterbrechungen eigentlich anhielt und extrem blutig beendet wurde. Vielleicht noch mal zurück zur Frage, weil ich glaube, ich bin jetzt etwas...
Moderation: Die Frage war die geschichtliche Einordnung. Ich glaube, das passt ganz gut.
Prof. Dr. Horlacher: Das ganz Spannende dann zur Einordnung, ich schaue mir ja eigentlich in der Arbeit die Zeiten nach dem Bürgerkrieg an. Weil Sri Lanka ist, das muss man auch sagen, ist eine Demokratie und sie funktioniert als Demokratie. Also USA ist auch eine Demokratie, also in der Demokratie ist sehr viel möglich.
Moderation: Wie funktioniert denn die Demokratie? Also inwiefern funktioniert die denn da?
Prof. Dr. Horlacher: Es gibt wehrhafte Demokratien und es gibt Demokratien, wo man sagen muss, solange das innerhalb des, schauen Sie sich das AfD-Verbot an in Deutschland, solange das innerhalb des Grundgesetzes ist oder der Verfassung, muss man damit auch demokratisch umgehen. Und das Spannende an Sri Lanka, wobei ich sagen muss, es ist eine Demokratie, war, dass nach 2009, nach der Beendigung des Bürgerkrieges, sich eine Regierung an der Macht gehalten hat über zehn Jahre. Also da gab es wechselnde Premierminister, wechselnde Präsidenten, aber letztlich war das fast clanähnlich in der Demokratie. Also sie haben in den USA auch, dass sie Bush haben und dann kommt irgendwann wieder ein Bush, der Präsident wird. Und wenn man sich rein statistisch ausrechnet, wie wahrscheinlich das ist, dass in einer Demokratie zweimal die gleiche Familie innerhalb von 15 oder 20 Jahren Präsident wird, das ist nicht sehr wahrscheinlich, oder Clinton. Und in Sri Lanka war das so, dass, da hieß damals der Präsident Mahinda Rajapaksa, der den Bürgerkrieg 2009 beendet hat. Der dann fünf, sechs Jahre später abgewählt wurde. Und danach kam sein Bruder an die Macht Gotabaya Rajapaksa. Das heißt, wenn man sich das anguckt, war das wie eine Clique oder ein Clan, die sich gegenseitig die Macht zugeschoben haben, obwohl es eine Demokratie ist. Und die letztlich die Kluft, die geblieben ist, aus dem Bürgerkrieg, aus 26 Jahren Bürgerkrieg mit 100.000 Toten, mit Unmengen von Leuten, die Displays also, sprich im Land, zum Teil in Konzentrationslagern waren, die geflohen sind nach Kanada und egal wohin. Dass da nicht wirklich eine Aussöhnung stattgefunden hat und dass das Land gleichzeitig in dieser, in der Hand dieser Familie geblieben ist. Und da fragt man sich dann schon, wenn man sich das anschaut: Warum? Ich habe das auch direkt gemerkt. Wir hatten 2019 den ersten Austausch mit Studierenden und es gab, bevor die kamen, ich glaube einen Monat vorher ein Machtwechsel. Und dann hieß es erst mal alle Fonds, also alle Mittel, die die Regierung ausgibt, um auch Akademiker zu unterstützen für Partnerschaften, die sind erstmal mal eingefroren. Und dann haben wir erstmal zwei, drei Monate gewartet, bis die neue Regierung dann sagte okay, wir lassen der Wissenschaft wieder mehr oder weniger freien Lauf. Und das Spannende ist eben, dass in der Zwischenzeit ist das Regime weg. Da gab es eine Art friedliche Revolution. Aber es hat aber über zehn Jahre gedauert, bis sich in dem Land das Potenzial so aufgestaut hatte, dass die Massen bereit waren, etwas dagegen zu tun. Und das Spannende ist meines Erachtens, dass sich sehr viel davon über die Kunst nachverfolgen lässt. Das heißt, um zur Kunst zu kommen, dass Literatur oder Malerei oder Theater dafür sorgen kann, dass Probleme, die man öffentlich vielleicht nicht diskutieren kann. Ja, weil sie. Also, Sie könnten. Nehmen Sie gay oder queer. In Sri Lanka ist das vom Gesetz her verboten. Es wird toleriert, aber es ist verboten, nach wie vor. Und Sie könnten auch einen Film über Queerness nicht wirklich groß in die Kinos bringen. Also wenn, dann wirklich nur ganz kleines Auditorium. Dessen ungeachtet gibt es Bücher, die durchaus erfolgreich waren und die dadurch ein Thema, sagen wir im öffentlichen Bewusstsein bearbeiten, das von der Zensur oder der Regierung noch halbwegs akzeptiert wird, weil es nicht schwarz auf weiß in der Zeitung steht als Sachtext. Aber im Bereich der Kunst wird es meistens akzeptiert, dass solche Dinge zumindest mal angesprochen werden. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Potenzial für Kunst. Schauen Sie sich an Frankreich im 18. Jahrhundert mit Zensur. Da haben sämtliche Philosophen etc. ihre Werke anonym publiziert, weil sie Angst hatten und haben die dann nach über Amsterdam, dort wurden die gedruckt, nach Frankreich geschmuggelt. Und das sieht man aber, wenn es Zensur gibt, wie sehr die Mächtigen Angst haben vor, sagen wir, dem subversiven Potenzial, das Kunst, Literatur, Malerei, Film enthält, das dem innewohnt.
Moderation: Ist es das, was du meinst, wenn du davon sprichst, dass Kunst als Raum genutzt wird, um gesellschaftliche Visionen zu entwickeln? Oder steckt da noch was Anderes mit drin?
Prof. Dr. Horlacher: Es gibt so eine These, die sagt von Don Juan Matus, dass Kunst der Raum ist, in dem eine Gesellschaft über sich selbst reflektiert. Das heißt Kunst oder, wenn Sie es psychoanalytisch, ich mache relativ viel Psychoanalyse, betrachten von Winnicott, könnte man sagen Kunst ist so ein Übergangsraum, in dem die Zensur des Über-Ichs nicht wirklich greift. Das ist so, wie wenn Sie morgens aufwachen, sind noch nicht ganz wach, da können Ängste kommen, da kann, meistens sind es wahrscheinlich Ängste, aber da kommt genau das, was man im Tag dann wieder schön verpackt und irgendwie einrangiert. Das dann aber in den Momenten, wo man nicht so wirklich aufpasst, dann vielleicht doch sich Bahn bricht. Und Kunst funktioniert so ähnlich. Das ist also, wenn Sie, zu Freud zurückgehen oder so, als Übergangsobjekt ein Raum, in dem ein spielerisches Umgehen mit Problemen möglich ist, das nicht, sagen wir, an die Realität gebunden ist. Seit es Science-Fiction oder Kunst ist, ja fiktiv oder andere Fiktion, die man einfach mal durchspielen kann und schauen kann, was passiert dabei. Was man aber jetzt in einem Aufsatz oder in einem Prosatext, der nicht literarisch ist, so nicht tun könnte. Also von daher, denke ich, hat Kunst ein wahnsinniges Potenzial, wenn man sich darauf einlässt. Zum einen zum Ausdruck dieser. Das muss ja nicht durchdacht sein, das ist ja gerade spielerisch, das ist ja das Ja. Oder da kann Magie sein oder so. Zum einen das, dass man Dinge denken kann in Kunst, die man sonst nicht formulieren kann. Vielleicht eben auch, weil sie nicht komplett rational sind. Und zum anderen spricht Kunst dann, glaube ich, auch den Leser oder den Zuschauer wieder an, weil es eben nicht wie ein Sachtext über Ratio funktioniert, sondern weil, wenn sie Kunst interpretieren. Und da ist, glaube ich, egal ob Film oder Malerei oder Literatur, sie den Text eigentlich im Lesen erst selbst schreiben. Es ist ja nicht, dass das, was im Kunstwerk dargestellt ist, in irgendeiner Form irgendwas abbildet außerhalb. Das ist einfach ein Fehlverständnis von Kunst oder von Literatur. Auch ein realistischer Roman bildet nicht die Realität ab, sondern er tut so, als würde er sie abbilden. Das ist die Konvention. Aber das, was da abgebildet ist, ist ein komplett neues Konstrukt. Und das Konstrukt entsteht, indem sie eben dann ihren Zeichenketten danach gehen. Sie lesen das und verbinden das mit der Bedeutung, die diese Worte oder Sätze für Sie haben. Das heißt, Sie werden Roman aus Sri Lanka anders lesen, wenn Sie mal dort gewesen sind, weil Sie Dinge wiedererkennen, weil Sie Erfahrungswerte einbringen, die Sie sonst vielleicht nicht haben. Und dieses die Tatsache, dass diese Bedeutung erst durch ihr aktives Zutun entsteht, führt dazu, dass sie viel enger mit dem, was da geschaffen wird, verbunden sind, eben auch emotional. Also das sieht man auch bei Tragödien, dass man mit dem Protagonisten mitleidet, weil man sich damit emotional verbinden kann, weil man sich zum Teil identifizieren kann. Und das ist der Trick eigentlich, denn Kunst macht mit uns, dass er uns auf der affektiven Ebene erreicht. Und das ist sehr viel stärker, als wenn das einfach nur ein Artikel ist, der logisch argumentiert, warum man was tun müsste. Oder Ich finde immer dieses Bild von Aylan Kurdi, das bringe ich so bei jeder Gelegenheit. Wo ich denke, diese Fotografie, die Art, wie das aufgenommen ist, erreicht viel mehr, als wenn sie einfach nur eine Statistik hinlegen und sagen so und so viele Kinder sind ertrunken. Ja, oder Wenn Sie sich Hungersnot in Afrika anschauen, macht es einen Unterschied, ob Sie eine Statistik lesen oder ob Sie Bilder von Kindern sehen, die am Verhungern sind. Und das ist genau die Ebene, auf der Kunst arbeiten kann.
Moderation: Ja, okay, wir können ja mal versuchen, das an einem konkreten Beispiel nochmal zu besprechen. Und zwar du erwähnst auch die Protestbewegung Aragalaya. Kannst du noch mal kurz erklären, was das für eine Bewegung ist und welche Rolle Kunst da konkret gespielt hat?
Prof. Dr. Horlacher: Die Aragalaya fand statt 2022. Und zwar hatten wir vorher, seit, ich sagte ja 2009, Ende des Bürgerkriegs, da gab es die Rajapaksa Regierung, die wurde dann für fünf Jahre abgelöst von einer anderen Regierung unter Sirisena. Dann gab es Bombenattentate in Colombo. Das führte dahin, dass die Bevölkerung eigentlich verunsichert war und dann wieder jemand ins Amt gewählt hat, der, was man im Englischen sagt einen Strongman, also jemand, der für Gewalt, für Ordnung usw. steht. Und das war wieder ein Rajapaksa, diesmal der jüngere Bruder des damaligen Präsidenten Gotabaya und der hatte ohnehin schon Anklagen wegen Menschenrechtsverstößen usw., weil der war vorher, glaube ich, mal Verteidigungsminister während des Bürgerkriegs. Also eine ganz dunkle Figur, hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Die sind international, sind die vernetzt. Das ist ganz spannend. Und der hat es hingekriegt, dass das Land dann Anfang 22 bankrottgegangen ist. Komplett. Also zum Beispiel wurde da Dünger verboten. Das ist, wenn ein Land, wenn die Ökonomie auf Agrikultur, Agriculture, also auf Farming basiert, etwas kurz gegriffen, wenn man nicht irgendwas hat, was man stattdessen einsetzen kann. Und er hat da jede Menge Fehler gemacht. Das Land ist komplett in den eigenen Schulden untergegangen. Das war jetzt nicht direkt nur darauf zurückzuführen, weil es gab vorher schon jede Menge Prestigeprojekte, also White Elephants, die halt gemacht wurden, einen Flughafen im Nirgendwo, weil der Präsident von dort kam. Aber bis heute fliegt dort kaum ein Flieger ab. Aber das Ding ist so groß wie der BER also und das hat die irgendwann eingeholt. Und da die Gesellschaft relativ militarisiert ist durch den Bürgerkrieg noch. Also ich war 2019 dort, das war kurz nach Attentaten und wenn sie da nachts auf der Straße waren, stand alle 100 Meter jemand mit einem MG, also komplett. Sri Lanka ist auch seit Jahren dabei, wenn es irgendeine UN Mission gibt, wo Soldaten hingeschickt werden, schicken die Soldaten, weil sie einfach viel zu viel Soldaten noch haben aus dem Bürgerkrieg. Und das Problem damals, also von daher war eine gewalttätige Revolution wäre hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und was die dann gemacht haben ist, dass die Galle Face Green ist so ein großer grüner Rasenplatz mitten in Colombo, wo sich am Sonntag immer die Familien treffen und wo in der Nähe auch die Regierungsgebäude sind. Und dort haben sich die Menschen zur Demonstration versammelt und sind einfach auch nicht mehr weggegangen. Und dann kam, da kamen Künstler dazu und die einen haben eine Art Galerie aufgemacht und haben mit denen angefangen zu malen. Es gab Restaurantbetriebe usw. und ich glaube, das war für drei Monate haben die diesen Platz besetzt und haben dann auch friedlich Regierungsgebäude besetzt und haben dabei eben auch Kunst produziert. Also es gibt ein Wandgemälde und es gibt, das habe ich hier mal ausgedruckt. Es ist jetzt nicht besonders gut von der Qualität her, aber ich zeige Ihnen das mal. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Das ist von JC Rathnayake. Das ist der Künstler, der dort eine Art Galerie betrieben hat und der mit dem Publikum vor Ort gemalt hat. Ich gebe dir gerade mal alle hier. Das sind die Gemälde. Das ist ein Mensch. Man muss dreimal hingucken. Ist eine Silhouette. Und die haben dort zusammen gemalt. Die haben geschrieben. Die haben im Endeffekt zusammengelebt und haben gesagt, wir besetzen das, um zu protestieren. Und dann hat die Regierung, Truppen, konnte sie nicht schicken. Die haben das dann so gemacht, wie das solche Regime manchmal machen. Die haben dann einfach gegen Geld Leute von außen hingefahren, dass die einfach gewalttätig versuchen, das aufzulösen, hat aber nicht funktioniert. Und was man hier noch sieht, das eine sind jetzt Gemälde auch von Rathnayake, der die Art Gallery dort betrieben hat. Das andere ist Performance Art. Das heißt, es gab auch, dass sich jemand einfach hier mit goldenen Ketten mit Maulkorb an eine ganz befahrene Straßenkreuzung gesetzt hat und sitzt natürlich auf, das Sofa, ist überdeckt mit der Fahne von Sri Lanka. Oder wir haben Performance Art, das haben Sie jetzt. Das Orga Kollektiv, das einfach eine Gruppe von Menschen sich in, also mit wie sagt man, in Sackleinen gehüllt plus die Fahne von Sri Lanka um zu sagen wir sind entrechtet, wir sind entmündigt, wir sind dagegen. Und das war ein friedlicher Protest, der sich trotz dem, dass die Regierung versucht hat, das mit Gewalt zu unterbinden oder Gewalt reinzubringen. Denn sobald es in Gewalt umgeschlagen wäre, hätte man es auflösen können, der sich gehalten hat und der gleichzeitig sich wirklich aus der Kunst gespeist hat. Und das fand ich faszinierend, dass so was geht. Und das belegt im Nachhinein, das ist ein bisschen einfach, ist wahrscheinlich komplexer, aber es belegt im Nachhinein, dass Kunst wirklich in einer zivilisierten Gesellschaft der Raum ist, wo solche Dinge angedacht oder vorbereitet werden können, die sich dann tatsächlich materialisieren.
Moderation: Die auch ja super gemeinschaftsstiftend sind. Wenn ich das so höre.
Prof. Dr. Horlacher: Dass auch. Vor allem zeigt sich das darin, dass es gab, dann kam ein Regierungswechsel in dem Moment während der Aragalaya, weil der Präsident zurücktreten musste und derjenige, der dann die Macht übernommen hatte, gehört aber auch indirekt zu dem Clan. Das heißt, da hat sich erstmal nicht viel geändert. Er hat nur versucht, das so möglichst schnell zu beenden. Es gab aber dann im November, Oktober / November 2024 Wahlen und dabei ist eine Partei, JVP heißen die, von dreieinhalb Prozent auf über sechzig Prozent, ich müsste mir die genauen Prozentzahlen angucken, gestiegen, was ist noch nie vorher gab. Und das war auch das erste Mal, dass eine Partei im Norden und Osten Stimmen hatte, also die Partei ist aus dem Süden im Endeffekt. Wenn Sie sich angucken Süden Sri Lanka wäre singhalesisch, Norden und Osten ist eher mit Tamil Majority, also tamilisch und zum Teil eben auch was, was man Moors nennt, Muslime. Und zuerst, und normalerweise traditionell wählen die Tamilen ihre Partei. Also es wird streng im Prinzip nach Ethnie oder Religion gewählt. Tamil sind Hindu, wählen ihre tamilische Partei, Sri Lanka, die Singhalesen sind Buddhisten, wählen ihre Partei und die Muslime wählen ihre. Und das ist zum Ersten Mal überhaupt, dass eine Partei aus dem Süden, die eigentlich für Sinhala steht, auch im Norden und im Osten die Mehrheit gewonnen hat. Und von daher wäre das wirklich gemeinschaftsstiftend. Die Frage ist, wo geht das hin? Das ist jetzt wirklich spannend. Zum Ersten Mal, auch werden jetzt auch Politiker verurteilt wegen Korruption, das war bekannt, aber die kamen halt damit durch. Wenn Sie in Sri Lanka irgendwo Tuk-Tuk fahren und da fährt ein Ferrari an ihnen vorbei. Dann sagt der Tuk-Tuk-Fahrer: „Oh, das ist ein Politiker“. Ja, also es ist relativ klar und offensichtlich und zum Ersten Mal im Moment wird das scheinbar, werden die Regeln geändert. Ob das so bleibt, muss man mal abwarten. Aber es ist sicher ein Neuanfang und ich denke, die Kunst hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Moderation: Klingt so. Ich würde jetzt den Moment ergreifen, wir sind jetzt eine halbe Stunde durch, mal zu öffnen und euch / Sie zu fragen, ob irgendwelche Fragen aufgekommen sind, irgendwelche Unklarheiten sind, irgendwo noch ein paar mehr Details gewünscht sind? Genau. Nehmt euch kurz zwei Minuten Zeit. Also, du hast dir gerade schon selber eingegossen. Na gut, ich wollte das jetzt ganz elegant, weißt du, als Pause nutzen. Okay. Gibt es da gerade schon irgendwas? Irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Gedanken auch gerne?
Gast 1: Genau. Meine Frage wäre die Auslegung, die Sie jetzt quasi dargelegt haben. Die war ja in einer prodemokratische antikorruptions-führende Richtung und wo Kunst ja als etwas durchaus Positives dargelegt würde. Meine Frage ist jetzt geht das auch in die andere Richtung, sozusagen, dass Kunst Ihrer Einschätzung nach in eine undemokratische oder zynische Richtung Gewalt entwickeln kann oder eine Wirkung entwickeln kann, die dann in die Gegenrichtung geht, sozusagen und vielleicht ein demokratisches System angreifen kann?
Prof. Dr. Horlacher: Ich würde sagen, Kunst ist moralbefreit. Kunst hat auch keine moralische Funktion. Kunst ist Kunst, also l'art pour l'art. Und was wir aus der Kunst machen, das ist letztlich das, was die Gesellschaft daraus macht. Nur wird man wahrscheinlich oft sehen, dass die Kreise, in denen Kunst stattfindet oder Künstler kreise, dass die wahrscheinlich vom Mindset her eher liberal demokratisch aufgeschlossen sind und weniger in die andere Richtung gehen. Aber natürlich gibt es auch, Drittes Reich, gibt es auch andere Arten von Kunst. Sie können Kunst und Ideologie, das eine schließt das andere nicht aus. Ich hatte auch hier mit Rathnayake ein Interview geführt, der diese Gemälde gemacht hat und die sind alle bedrohlich. Die sind jetzt sie hier nur in klein, die sind alle fast zwei Meter groß und ich hatte mal überlegt, ob ich mir eins davon kaufe und dachte, das willst du eigentlich nicht im Wohnzimmer hängen haben. Der hat vorher nichts Politisches gemacht. Und er hat zu mir gesagt, er versucht das jetzt abzuschließen und würde dann lieber gerne wieder einen Bereich gehen, wo er Kunst macht um der Kunst willen, aber nicht, um irgendwie gegen, also Protest auszudrücken oder sonstiges. Und von daher denke ich, Kunst ist erstmal offen und es gibt auch, das ist mein Standardtipp Louis Ferdinand Celine „Voyage au bout de la nuit“. „Reise ans Ende der Nacht“ ist ein radikaler, ein rechtsradikaler Roman, der ästhetisch unheimlich gut funktioniert, aber inhaltlich total bedenklich ist. Also das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch eine Dritte Reich Ästhetik Riefenstahl oder so gut finden. Die Frage ist was hält man von den Werten, die daran gekoppelt sind?
Gast 1: Okay, danke.
Moderation: Hat vielleicht jemand was zum Nachschieben? Gedanken, Fragen. Alles erlaubt. (…) Gut, dann guck ich mal, was ich bei mir noch so draufstehen habe. Gibt es gerade, weißt du das, ob es von Regierungsseite aus eine Art Aufklärung Richtung Bürgerkrieg gibt oder Bestrebungen in die Richtung? Oder wie verhält man sich da momentan zu?
Prof. Dr. Horlacher: Von Regierungsseite. Also die Regierungsseite hat das Problem, dass die diese Partei JVP, dass die, die sind eigentlich marxistisch und dass die, glaube 71, müsste gucken, wann es genau war, 71 und 87 ganz blutige Aufstände damals gegen die Regierung gemacht haben, mit ganz vielen Toten. Also da, das war selbst problematisch, als ich in Sri Lanka war vor zwei Jahren, wo viele sagten, es ist die einzige Hoffnung dieser Partei, aber ich kann die nicht wählen, weil die haben die und die Vergangenheit. Ich denke, im Moment sind die eher damit beschäftigt, Sri Lanka vom Bankrott zu retten, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, das abzuwickeln, was an Korruption von der letzten Regierung noch da ist. Die Frage ist dann ohnehin wie gehe ich mit einem Bürgerkrieg um, der dann inzwischen 16 Jahre her ist? Ich würde mir natürlich hoffen, dass die dann mit NGOs zusammenarbeiten und da im Sinne von Transitional Justice aktiv werden. Aber ich kann dazu im Moment nichts sagen. Das ist halt ein Minenfeld, weil, ich würde sagen, es gibt kein Vorwärts, ohne dass man die Vergangenheit bearbeitet. Aber wenn man diese Kiste jetzt aufmacht, weiß man auch nicht: Welche Auswirkungen hat das auf die Gegenwart? Ja, aber es sieht, wie Sie vorhin sagten, nach Community Building aus, weil zum Ersten Mal, wie gesagt, Moslems und Tamils wirklich auch für eine Partei gestimmt haben, die nicht jetzt ihrer religiösen oder ethnischen Angehörigkeit entspricht.
Moderation: (...) Wann warst du das letzte Mal in Sri Lanka?
Prof. Dr. Horlacher: Vor zwei Jahren. Eineinhalb. Zwei Jahren? Ja.
Moderation: Wie ist da so die Stimmung an der Uni?
Prof. Dr. Horlacher: An der Uni ist die eigentlich immer gut, würde ich sagen. Also die klagen immer alle, dass sie zu viel arbeiten. (...) Die Uni ist natürlich. Also, wenn es um die politische Einordnung geht, sind die alle eher links, das ist klar. Ja, aber das jetzt pauschal irgendwie. Also die Kontakte, die ich im Moment habe, die freuen sich alle, sind alle happy, dass es, dass es zum Regierungswechsel gekommen ist. Aber die Vergangenheit der Regierungspartei lässt sich nicht ganz wegdiskutieren. Ja, die werden jetzt keinen Marxismus mehr einführen, das können die sich auch nicht leisten. Aber diese blutigen Aufstände, da gibt es ja noch Überlebende. Ja, da gibt es, da gibt es Familien, da sind die Väter oder Mütter gestorben. Das ist immer noch da. Und das geht eigentlich vor den Bürgerkrieg zurück und wird zum Teil, glaube ich, auch während des Bürgerkriegs. Es ist eine extrem verworrene, im Englischen sagt man convoluted, also eine extrem komplexe Situation.
Moderation: Ja, absolut. Sind gerade noch Fragen? Ja, du möchtest.
Gast 2: Mich würde mal interessieren, wie so ihr Forschungsalltag dort aussah, als sie diese Forschungsreise gemacht haben. Und ja, wen sie da treffen und wie sie das dokumentieren, um dann hier in Dresden weiter daran zu arbeiten.
Prof. Dr. Horlacher: Das hat viele Facetten. Also zum einen, was toll ist, ist dort direkt zu unterrichten und mit den Studis in Kontakt zu sein und dann, wenn ich dort bin, gucke ich nicht. Also es hat mehrere Komponenten. Das eine wäre der Unterricht, der ist natürlich weniger forschungsbasiert jetzt. Wobei es total spannend ist, wenn die Studis aus Sri Lanka kommen und ich hier dann Literatur aus Sri Lanka unterrichte, weil das ist natürlich ein ganz anderes Publikum als die deutschen Studis und die haben auch ein ganz anderes Wissen darüber. Der nächste Punkt, wenn ich in Sri Lanka bin, was ich mache ist, dass ich gucke, dass ich mit der deutschen Botschaft Kontakt habe, dass ich mit dem Goethe-Institut Kontakt habe, dass ich nach Jaffna also auch fahre und dort an der Uni, wo ich Ansprechperson habe, dass man möglichst aus der Uni rauskommt. Und auch, dass man guckt, dass man ein gewisses Netz hat, wenn die eigenen Studis dort sind. Dass ich, wenn die sich melden und sagen, da geht was ganz schief, dass ich da auch Kontakte habe und irgendwie von außen noch was machen kann. Und dann haben sie natürlich sehr viele Treffen persönlich mit Kollegen. Ja, dass man zusammen essen geht oder dass man einen Workshop macht zusammen. Und für das Projekt hier habe ich dann, als ich da die Kontakte hatte und die Ideen hatte, hatte ich dann Projektantrag gestellt bei Thyssen und hatte dann Mittel, um 15 Kollegen, im Prinzip weltweit, die meisten kamen aus Sri Lanka oder wären gekommen, wenn Covid damals nicht überall gewesen wäre. Dass wir dann in Dresden eine Konferenz gemacht haben. Und ich hatte mir vorher überlegt, welche Themen finde ich spannend und habe dann gefragt: Wären Sie bereit, zu dem und dem Thema einen Vortrag zu halten? Aus dem Vortrag, Sie haben dann den Vortrag, wir hatten das, hatten vielleicht 20 Kollegen hier und ein paar dann zugeschaltet über Zoom oder Big Blue Button oder whatever und haben die dann im Plenum diskutiert und haben das dann zu einem Buchprojekt entwickelt. Ja, und zwischendurch fliege ich dann hin oder es kommen Kollegen aus Sri Lanka hierher. Das ist dann so ein laufender Dialog.
Moderation: Beantwortet das deine Frage?
Gast 2: Ja, Danke.
Moderation: Ja. Achtung, Mikro kommt.
Gast 3: Ich versuche es mal zu formulieren. Wovon Lebt Sri Lanka heutzutage hauptsächlich wirtschaftlich um sein, um seine…
Prof. Dr. Horlacher: Tourismus.
Gast 3: Tourismus.
Prof. Dr. Horlacher: Tourismus, und zwar ganz gezielt
Gast 3: Landwirtschaft nicht?
Prof. Dr. Horlacher: Haben Sie mal, wenn Sie hier eine Mango kaufen gehen, haben Sie je eine gekriegt aus Sri Lanka? Also ich finde es immer interessant, dass wir, es ist Brasilien meistens. Aber sie bekommen fast nichts aus Sri Lanka. Sri Lanka lebt nur zum einen vom Tourismus, und zwar upper class - high class, also sprich die wollen weniger Studierende, die wollen Luxushotels, dass es sich rentiert. Die leben von Textil. Also es gibt diese Zonen, wo Textilfabriken sind. Das Problem ist aber, dass der Lebensstandard und der Lohn in Sri Lanka zum Beispiel höher ist als Bangladesch. Das heißt, für KiK oder Primark macht es keinen Sinn, in Sri Lanka einzukaufen. Ein anderes Problem sind Zölle. Das hat nicht nur Trump erfunden, auch die EU ist da gut drin. Wenn die EU, wo die EU lange sagt, dass solange ihr nach dem Bürgerkrieg mit euren Minderheiten nicht so umgeht wie wir als EU das für richtig empfinden, zahlt ihr mehr Zölle als ihr zahlen müsstet. Das heißt, die sind da genauso abhängig vom Wohlwollen von politischen Organisationen, welche Zölle sie zahlen, ob dann ein Produkt aus Sri Lanka konkurrenzfähig ist oder nicht. Naturschätze haben die so gut wie nichts. Sie haben ihre Häfen Trincomalee und Colombo, die sind beide chinesisch für 99 Jahre. Das heißt, sie haben zum Teil ihre Häfen verkauft für Infrastruktur.
Gast 3: Ja, und in Verbindung mit dieser Frage eben. Inwieweit hat denn dann Kunst als, als Machtmöglichkeit oder Einflussmöglichkeit in diesem wirtschaftlichen Kontext eine Chance für die lebende Bevölkerung?
Prof. Dr. Horlacher: Ich denke, die Chance, die Kunst hatte, war, dass die Aragalaya friedlich geblieben ist. Dass es nicht zu Blut oder kaum zu Blut, es wurden Mal zwei, drei Range Rovers angezündet. Aber ich glaube, das gehört bei sowas dazu. Aber es blieb friedlich und die haben sich auch nicht provozieren lassen durch die Schlägertruppen der Regierung. Inwiefern Kunst hilft, wenn ein Staat bankrott macht, das ist eine andere Sache. Ja, aber trotzdem. Was ich immer spannend finde ist, wenn Sie sich Indien anschauen, Sie haben in Indien. Wie sagt man die Bevölkerung, die in der Lage ist zu lesen, zu schreiben, das ist bei 63/64 % so in etwa, plus minus. Sri Lanka ist deutlich über 90 %. Und das merken Sie auch, wenn Sie dort sind, dass da ein anderes soziokulturelles Netz da ist. Ob das immer hält, ist eine andere Frage. Aber ich denke, das merkt man. Das macht sich auch bemerkbar, auch darin, dass die Demokratie gehalten hat.
Gast 3: Danke.
Moderation: Akut gerade noch Fragen aus dem Publikum? Oder Gedanken? Cool, dann mach ich weiter. (...) Du beschäftigst dich ja, Du hast es gerade auch schon angesprochen, auch mit Indien. Was hast du denn da für Projekte am Start?
Prof. Dr. Horlacher: Also Indien haben wir im Moment zwei Projekte. Zum einen hat die TU Dresden, das nennt sich ein Transcampus mit Chennai, also im IIT in Madras. Und Transcampus heißt, dass es da eine Zusammenarbeit gibt auf Universitätsebene in verschiedenen Bereichen. Da ist die Geisteswissenschaft, ich würde fast sagen, wie meistens nicht dabei und da bin ich dabei zu versuchen, ob wir das auch auf GSW, also sprich Geisteswissenschaften, ausdehnen können, das heißt gemeinsame Forschung. Da muss man gucken, inwiefern die Kollegen interessiert sind oder Kolleginnen und Kollegen und Studierendenaustausch, das ist eine Baustelle. Und die zweite Baustelle war ein vergleichendes Projekt, was Inklusion angeht. Inklusion an deutschen Schulen und Inklusion an indischen Schulen. Das hatten wir im letzten September/Oktober mit Bhubaneswar. Bhubaneswar liegt in, muss man es immer visualisieren, liegt in man könnte sagen Nordostindien in Odisha. Der Bundesstaat hieß früher Orissa, vielleicht sagt das jemand was. Und da haben wir, habe ich dann über sechs Wochen hinweg Schulen besucht und eben geschaut: Unter welchen Bedingungen lernen die Schülerinnen und Schüler, was wir da angeboten, Wie sind die, wie ist die Ausstattung und auch wie ist der Umgang mit Inklusion? Also inwiefern? Weil Indien hat auf dem Papier ganz hohe Standards, wo man sich verpflichtet hat, das auch einzuhalten. Und die Frage ist dann, was ist vor Ort wirklich möglich? Und da haben wir eine vergleichende Untersuchung von drei, vier Schulen in Indien und ausgewählten Schulen hier in Dresden und Umgebung. Da haben wir aber noch keine Ergebnisse, weil, das muss ich gestehen, die Realität war dann so unterschiedlich, dass sich die Frage stellt inwiefern ist ein Vergleich wirklich noch sinnvoll oder inwiefern macht man da zwei getrennte Untersuchungen und sagt okay, das können wir zur Inklusion in diesem Bundesstaat sagen, der vielleicht stellvertretend für Indien ist, zu einem gewissen Grad und koppelt davon ab, wie sieht es mit Inklusion hier in Dresden und Umgebung aus?
Moderation: Kann man die Schulstandards in Indien miteinander vergleichen? Ich hatte immer so den Eindruck, dass sich die Bundesstaaten sehr krass unterscheiden in vielen Sachen. Aber ich habe da keinen Einblick drin, wie das auf pädagogischer, schulischer Ebene so aussieht.
Prof. Dr. Horlacher: Den Eindruck, den ich gewonnen habe, wäre: Es gibt das staatliche Schulsystem und es gibt ein privates Schulsystem und wenn Sie sich die Universitäten anschauen und um eine Stufe höher zu gehen, die IITs sind richtig, richtig gut. Es sind Partner für die TU Dresden, die spielen in einer richtig, also bei IT spielt Indien richtig in einer hohen Liga mit und sie haben auch manchmal entsprechende Schulen. Die Frage ist, sind die wirklich für die breite Gruppe der Bevölkerung zugänglich oder sind es dann, wir haben uns auch Privatschulen angeguckt, sind das dann wieder Privatschulen, für die ich mich entweder über Geld oder über besondere Ausbildung oder besondere Begabung qualifizieren muss? Aber ich denke, die Bandbreite in Indien ist sehr viel breiter. Ich weiß, was wir in Deutschland haben, glaube ich, ist auf Universitätssystem wie auch im Schulsystem eine gewisse Ausgeglichenheit. Ja, vielleicht nicht die Spitzen wie in Amerika oder mit Yale und Harvard, aber dafür sehr, sehr viele Universitäten, die alle in etwa gleich gut sind. Und ich glaube, im Schulsystem ist das so ähnlich. Man kann natürlich immer noch sagen, es gibt Bundesländer und da gibt es Unterschiede, aber im Vergleich zu Indien ist das, glaube ich, vernachlässigbar.
Moderation: Ja, ok. Ich hatte nicht mit der pädagogischen Ebene gerechnet. Wie bist du darauf gekommen? War das ein Angebot?
Prof. Dr. Horlacher: Es war eine Anfrage aus Indien von einem Kollegen. Und ich war da gerade in Sri Lanka. Da kam die rein. Da dachte ich Nee, machst du mal, du bist eh schon unterwegs, lass mal! Weil die ging noch an andere Kollegen und dann hat natürlich keiner reagiert. Und dann fand ich Indien spannend. Und dann habe ich reagiert. Und dann haben wir einen Antrag geschrieben beim DAAD, und dann kam es zu dieser Ebene.
Also von daher war, also es war wahnsinnig spannend die Schulrealität. Sich eine indische Schulküche anzuschauen, die dann im Offenen stattfindet, mit zwei großen Kesseln und drei Damen, die da kochen. Und dann zu lernen, dass sie in dem Bundesstaat, wenn sie über die achte Klasse hinausgehen oder über die zehnte ein Fahrrad bekommen von der Regierung, damit sie selbstständig zur Schule können. Weil das Problem, das die haben, ist, dass viele Eltern, die jetzt sagen wir nicht viel Geld haben, eigentlich schauen, dass sie ihre Kinder sobald als möglich aus der Schule nach Hause holen, dass sie dort irgendwo arbeiten können. Das heißt, das sind andere Problemstellungen als wir die haben, die sich aber natürlich auch mit sozialer Klasse und Kaste dann wieder verändern.
Moderation: Mega spannend.
Prof. Dr. Horlacher: Ja, also wir waren auch in einem Heim für geistig behinderte Kinder. Das war eindrucksvoll.
Moderation: Inwiefern eindrucksvoll?
Prof. Dr. Horlacher: Nicht unbedingt im Positiven, aber wo man einfach sagen muss, es ist Gesellschaften zu gewissen Zeitpunkten vielleicht nicht immer möglich, alles zu leisten, um es mal so zu sagen. Dass man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt und sagt okay, Inklusion ist was Anderes. Aber ich glaube, da müssen wir bei uns mal hinschauen, da haben wir auch noch genug zu tun, weil wir vergleichen da schon sehr verschiedene kulturelle Kontexte.
Moderation: Ja, absolut. Okay, ich frag - Ja. Dann nehmen wir die noch. Und dann.
Gast 4: Genau. Und zwar, weil es jetzt auch gerade um den Vergleich mit deutschen Problemstellungen gibt. Wo sehen Sie denn noch Potenzial für die Kunst, eine Bedeutung oder eine Macht zu entwickeln in Deutschland, wo sie sich vielleicht auch mehr Kunst wünschen würden oder mehr Impact, mehr Durchschlagskraft von Kunst wünschen würden?
Prof. Dr. Horlacher: Also das große Potenzial sehe ich in den Schulen und an den Universitäten, dass man weggeht zum Teil von Cultural Studies. Also wenn Sie jetzt (...) Literatur studieren oder auch wenn Sie Literatur Leistungskurs haben oder so, und dann wird da, glaube ich, weniger Shakespeare gelesen und weniger Romane als vor zehn oder 20 oder 30 Jahren. Und wenn ich die Schüler, Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden nicht darauf vorbereite, wie Kunst funktioniert, wie Literatur funktioniert, wie ästhetischer Zeichengebrauch funktioniert, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich da, dass da später so eine Art Abkopplung erfolgt und dass das immer mehr in einer Blase stattfindet für diejenigen, die was mit anfangen können und dass die anderen das eigentlich relativ stark ablehnen. Oder wir haben so viele Studierende, die studieren Englisch, englische Literaturwissenschaft wegen der Sprache. Wir sind aber keine Sprachausbildungsschule, sondern eigentlich was wir machen ist, dass man zeigt auf einer abstrakten Ebene, wie, sagen wir, ein ästhetisch dicht codierter Sprachgebrauch funktioniert und was der in der Person oder im Einzelnen auslösen kann. Aber das muss man sich erarbeiten. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, dass jemand vom Gemälde steht und es trifft ihn der Blitz, eine Epiphanie. Und jetzt tut sich da was auf. Das ist Training. Und das ist auch nicht ganz einfach. Also ich habe im Moment auch wieder so ein Theorieseminar, habe mit dem englischen Text geködert und wir machen vier Wochen Literaturtheorie, um zu sagen Sprache ist schwierig und hat aber ein Riesenpotenzial, wenn man damit umgehen kann. Und was ich auch sagen würde, wenn Sie ein Shakespeare Sonett dekodieren können, kritisch lesen können, können Sie jeden politischen Diskurs kritisch lesen. Wenn Sie es aber nicht können, dann gehen Sie eben auch, sei es im Bundestag oder sei es in Operation Speech oder wie auch immer. Gehen Sie diesen primitiven Metaphern und Vergleichen auf den Leim, weil Sie gar nicht sehen, was da eigentlich geschieht. Und deshalb, glaube ich, ist sich mit Kunst, also mit diesem komplexen Zeichengebrauch auseinanderzusetzen, elementar wichtig, um auch kritisch Diskursanalyse oder Gesellschaftskritik betreiben zu können.
Gast 4: Ja, Vielen Dank.
Moderation: Danke dir. (…) Finde ich, ist ein schönes Schlusswort.
Prof. Dr. Horlacher: Danke.
Moderation: Also Danke dir für den Einblick über die Geschichte und aber auch für die Komplexität der Situation in der Vergangenheit und in der Gegenwart gerade so in Sri Lanka. Und ich finde es super spannend, also die Macht der Kunst dahingehend auch mal zu beleuchten und zu gucken, was da für Potenziale drinstecken. Dass es eben Räume sein können zum Neudenken, zum Visionieren, dass es aber auch Begegnungen schafft und Menschen zusammenbringt und dann vielleicht sogar tatsächlich ganze Gemeinschaften stiften kann. Also Danke, dass du hier warst und bist und uns daran teilhaben lassen hast.
Prof. Dr. Horlacher: Vielen Dank für die Einladung.
Der Duft des Textes: Gerüche in der antiken Literatur - JProf. Dr. Mario Baumann
Unser Geruchssinn ist aufgrund seiner engen Verbindung zu Erinnerungen und Emotionen besonders dazu geeignet, uns die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Jun.-Prof. Dr. Mario Baumann vom Institut für Klassische Philologie der TU Dresden lädt dazu ein, mithilfe unseres Geruchssinns in die literarische Welt der Antike abzutauchen und sich ihr sinnlich anzunähern.
Intro: Hallo und Herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere". Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator Tobias Dombrowski: Herzlich Willkommen zu "Triff die Koryphäe unter der Konifere", heute, der vierten Veranstaltung am 3.09. Zu Gast ist heute Professor Mario Baumann. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich lade auch alle ein, die übers Internet dann zuhören werden und auch die Gäste jetzt hier redlich Fragen zu stellen. Es wird eine Dialogveranstaltung sein zwischen unserem Gast und euch als die Interessierten, die wir hier zusammengekommen sind. Ebenso mich. Ich habe auch meine Fragen mit dabei. Ähm. Und so eröffne ich nun zunächst einfach mal die Veranstaltung. Danke, dass Sie da sind.
Professor Dr. Mario Baumann: Ja, gerne. Danke. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Danke schön.
Moderator: Wir sprechen heute über das Thema "Der Duft des Textes-Gerüche in der antiken Literatur". Auch darüber, wie sich der Sprachwissenschaftler einer alten Kultur nähert und was er dort findet. Der Sprachwissenschaftler heute, Mario Baumann, ist an der TU angestellt, hat den Lehrstuhl inne für, muss ich blättern, Inhaber für, Inhaber der Juniorprofessur Kulturen der Antike und griechische Literatur. Und begonnen hat es damals. Begonnen hat es damals mit einem Studium griechischer und lateinischer Philologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Das Studium haben sie dann fortgezogen mit einem zusätzlichen Schwerpunkt der Germanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen und haben dieses Studium 2006 mit ihrem ersten Staatsexamen für das gymnasial, gymnasiale Lehramt abgeschlossen. Angeschlossen hat sich eine wissenschaftliche Mitarbeit, eine Zeit im Gießener Sonderforschungsbereich für Erinnerungskulturen. Anschließend eine noch längere, von 2006 bis 2018 dauernde wissenschaftliche Mitarbeit am Institut für Altertumswissenschaften der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Während dieser Zeit haben sie promoviert mit dem Thema "Die schöne Paideia. Bildung und ästhetisches Programm in Philostrats Eikónes'", wobei Philostrat der Name ist, der Eigenname, die Person und Eikónes das Werk. 2018 haben sie habilitiert mit dem Werk "Welt erzählen: Narration und das Vergnügen des Lesers in der ersten Pentade von Diodors Bibliotheke". Was das alles bedeutet können wir noch übersetzen.
Prof. Baumann: Ja, sehr gerne.
Moderator: Von 2018 bis 2021 haben Sie eine eigene Stelle mit dem Projekt "Ein Kommentar zu Herodians „Geschichte des Kaisertums nach Marc Aurel“ innegehabt, nämlich auch am Institut für Altertumswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und von 19 bis 20, also 2019 bis 2020, haben sie eine Professur vertreten. Das war dann in Bonn an der Universität Bonn, auch für klassische Philologie und Gräzistik. Und wie hat es Sie nun hierher verschlagen nach Dresden? Seit 2021 sind Sie hier Juniorprofessor und lehren dort, ja, alte Sprache und die Entschlüsselung, wenn ich das so abstrakt stehen lassen darf?
Prof. Baumann: Ja kann man schon sagen. Und vielleicht kann man sagen, was das Besondere an dieser Juniorprofessur ist, die ich da innehabe. Die nennt sich ja "Kulturen der Antike" bewusst auch im Plural Kulturen. Und die Idee dabei ist eben eigentlich das, was du gerade richtig sagtest Tobias. Also Sprache, das Lesen, Entschlüsseln. Wie sagtest du vorhin so schön? Die Exegese. Dazu kommen wir dann nachher noch. Genau das erklären sozusagen. Das ist ein Punkt, aber das auch irgendwie im Kontext der materiellen Kultur zu sehen. Denn natürlich gehört ja zu so einer Kultur mehr als Sprache und Text und Literatur. Und das haben wir auch alles aus der Antike, die die Gebäude, die verschiedenen materiellen Hinterlassenschaften, die berühmten, keine Ahnung griechischen Vasen, wenn sie da eine schon mal gesehen haben und Ähnliches. Das ist ja alles da, da haben wir eigentlich eine ganze Menge und wissen auch viel drüber und das irgendwie zu verbinden, also schon vom Text her zu kommen, das ist irgendwie so die Idee. Aber das dann auch im Kontext zu sehen und alles das zusammenzuführen, das ist eigentlich die Idee und das finde ich attraktiv. Ein schöner Zugriff auf die Antike, finde ich. Und das wird nicht überall so gemacht. Nicht unbedingt selbstverständlich, aber hier mit dieser Professur geht es eben so und das finde ich super. Ja.
Moderator: Hast du schon immer gern gelesen?
Prof. Baumann: Ja, das kann man schon sagen, doch.
Moderator: Bei mir fing das erst später an. Gegen die elfte Klasse würde ich sagen so, aber da hat sich ein großes Feuer entbrannt für die Sprache. Was ist bei dir so das Feuer in der Sprache? Ich habe ja vorhin bemerkt, es -bist ein heiteres Gemüt. Da fließt bestimmt mal ein Lächeln raus, wenn du zu Hause auch das eine oder andere sprach, sprachliche, die sprachliche Schönheit siehst. Was ist das, was dich daran interessiert an? Allein, an der Sprache jetzt?
Prof. Baumann: Also das eine, du sagtest ja gerade schon Schönheit ist natürlich ein Punkt. Sprache hat ja was. Also Sprache klingt, wenn man sie spricht oder wenn man sie hört. Sie entfaltet ja auch irgendwie so eine Art Ästhetik, wenn man sie liest. Das können wir auch gleich noch mal ausprobieren. Ich habe einen Text mitgebracht, wir reden ja noch drüber. Und ich finde aber besonders faszinierend. Und ich glaube, das bringt uns auch jetzt irgendwie zum Thema hier, Sprache erschafft ja sozusagen etwas. Also ich kann jetzt was sagen oder wir können etwas lesen, dann passiert ja da irgendwas. Sinneseindrücke zum Beispiel kann man sprachlich vermitteln, man kann was beschreiben und irgendwie entsteht so ein Bild vor unserem inneren Auge, wie wir gerne sagen. Also irgendwie selber ein Bild natürlich, das so zu formulieren. Und das finde ich toll, dass Sprache so was zeigen, vermitteln, deutlich machen kann und dann passiert da irgendwie was. Das ist ziemlich interessant, auch ziemlich kompliziert, manchmal gar nicht leicht in Worte zu fassen, finde ich. Aber irgendwas ist da immer im Spiel, sozusagen. Man hört nicht nur was oder liest was, sondern irgendwie passiert, dann noch ein Mehr sozusagen. Und das fand ich immer besonders interessant, da mal hin zu schauen, was ist das eigentlich, das auch selber zu empfinden natürlich wenn man Leser ist oder etwas hört. Und ich glaube, so würde ich es auf den Punkt bringen, was mich an Sprache und zumal natürlich an Literatur fasziniert.
Moderator: Es klingt fast so, als spielte da noch was Mystisches mit rein, etwas, was nicht immer im Lichten sich zeigt, sondern etwas dunkel verbleibt?
Prof. Baumann: Ich glaube, das ist schon richtig und ich denke, man kann das durchaus so formulieren. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den man schon beschreiben kann. Es kommt der Wissenschaftler, der sagt natürlich: Doch klar, kann ich erklären, kann ich vermitteln, können wir drüber diskutieren. Ich kann eine These aufstellen, über die können wir streiten, die kann man bestätigen oder widerlegen. Klar, das geht. Aber ich finde auch, irgendwie ist so in diesen Prozessen von Erfahrungen, die man so macht, wenn man sich mit einem ästhetischen Gegenstand wie einem literarischen Text beschäftigt, da geht es auch immer irgendwie so einen Rest, der irgendwie da bleibt und den man, glaube ich, nicht so hundertprozentig erklärt bekommt. Also das denke ich schon, dass es da irgendwie was gibt. Und klar, das macht es schon auch besonders faszinierend.
Moderator: Na schön, wir haben heute wirklich Anschauungsmaterial und Lesematerial dabei. Es soll, ähm, wie nennt man das haptisch werden?
Prof. Baumann: Na irgendwie schon, oder? Ich glaube, wissenschaftlich würde man sagen olfaktorisch, wenn es so in die Nase geht in das, was man riecht. Kompliziertes Wort, aber das wäre so der Begriff. Ganz genau. Wobei, ganz witzig, da hake ich gerade ein. Man hat in der Antike natürlich auch schon sehr intensiv drüber nachgedacht, was sind das so für Sinne, die wir haben und wie kann man die verbinden oder voneinander abgrenzen? Und für den Geruchssinn ist das gar nicht so einfach, weil die irgendwie so zwischen was steht. Also wir haben Sinne, die wirken zum Beispiel stark auf die Ferne. Man kann relativ weit sehen mit so einem menschlichen Auge. Wir können durchaus auch weit hören. Und dann gibt es andere Dinge, die verlangen einen ganz unmittelbaren Kontakt. Haptisch, was du gerade sagtest, da muss man wirklich was eben anfassen. Und ein Geschmack empfinden wir auch nur dann, wenn wir wirklich etwas im Mund haben. Dann arbeiten die entsprechenden Sinneszellen etc. etc. und die Wahrnehmung kommt in Gang. Die Gerüche sind irgendwie so dazwischen, man kann schon auf Distanz irgendwie riechen, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr körperlicher Vorgang. Da muss ja irgendwas auch rein, sozusagen, ins Sinnesorgan und Ähnliches. Deswegen hat man schon der Antike überlegt, ob nicht so die Gerüche auch sozusagen was Haptisches haben in dem Sinne, dass da irgendwie eine Art von Nähe oder eine Art von wirklich so einem ganz physischen Kontakt auch irgendwie sein muss. Von daher würde ich sagen, haptisch passt vielleicht schon als Begriff. Doch, ja.
Moderator: Wollen wir den Weihrauch und die Myrrhe?
Prof. Baumann: Ja, gerne.
Moderator: Was ist das noch?
Prof. Baumann: Weihrauch mit Rose, kommt gleich, zur Nase. Versprochen.
Moderator: Wollen wir das mal eröffnen und in die Menge geben?
Prof. Baumann: Finde ich gut. Ganz genau. Also, wir fangen mit der echten Geruchswahrnehmung an und dann schauen wir zur Literatur und können mal so ein bisschen checken, was dann eigentlich passiert. Ich glaube, da passiert auch was, aber da können wir dann gerne drüber sprechen. Vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie das jetzt am besten funktioniert. Das sind einfach kleine Gläschen und die wandern jetzt buchstäblich durch die Reihen. Das Duftmaterial lassen Sie bitte einfach drin, aus verschiedenen Gründen und Sie können einfach daran riechen. Sie kennen vielleicht dieses berühmte Fächeln und das chemische Riechen. Das ist hier nicht unbedingt nötig, weil es so stark und hart ist, es sozusagen nicht. Also wenn Sie wollen, können Sie auch so ein bisschen ran, sozusagen mit der Nase. Und ich habe drei, wie eben schon gesagt wurde, Beispieldüfte ausgewählt, die auch in Verbindung zu dem stehen, was ich auch gleich noch über den Text sozusagen mache. Alles Gerüche, die geographisch gesehen irgendwie so aus dem südlichen Arabien oder aus dem heutigen Somalia, aus dem Horn von Afrika kommen. Das eine ist eine Myrrhe, die aus dem Jemen kommt, ein Harz, das andere ist ein Weihrauch, der aus dem Oman kommt, auch eine Art Harz. Aber man sieht schon beim bloßen Hinschauen so ein bisschen anders. Und das Dritte ist, glaube ich auch ganz wichtig, das zu riechen: Ein Weihrauch, der versetzt ist mit Rosenöl. Ich sage deswegen, dass es wichtig ist, weil man Gerüche in den meisten Kulturen das gilt auch für unsere heute aktuell aber auch für die antiken Mittelmeerkultur, mit denen sich so der antike Profi beschäftigt, weil man Gerüche eigentlich in den meisten Kulturen irgendwie mischt und dann auch großes Interesse daran hat, zu erproben, was passt wie zusammen? Was ist dann der Effekt sozusagen, wenn man Dinge kombiniert? Und so eine einfache, aber ich glaube doch auch irgendwie anregende Mischung, mal so als Beispiel ist genau das. Ich will dazu erst mal gar nicht so schrecklich viel sagen, außer einer Sache: Ob das jetzt genau der Geruch ist, den man auch in der Antike hat, ist eine spannende Frage, zu der man vieles sagen kann. Ich würde es mal vorsichtig so formulieren. Wahrscheinlich irgendwie schon, aber Unterschiede kann es auch gegeben haben. Diese Pflanzen entwickeln sich. War das die exakte Weihrauch Spezies? Davon gibt es verschiedene heutzutage, die man auch in der Antike hatte. Wie genau hat man es angebaut, wie hat man es geerntet? Wäre das so eine Darreichungsform gewesen? Aber trotzdem glaube ich, können wir ganz zuversichtlich sein, dass auch jemand, wenn wir aus der Antike einen her beamen könnten sozusagen, doch sagen würde: Ja, das ist ein Weihrauch und das erkenne ich irgendwie auch. Also ich glaube, man kann das jetzt schon auch mal so als Transportmittel benutzen, so ein bisschen in diese ferne Welt zu reisen. Und wie gesagt, es kommt dann auch gleich noch über die textuelle Schiene gewissermaßen. Ich gebe diese drei Gläschen einfach mal durch. Ganz genau. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Und das dritte irgendwie auch noch ganz genau. Und wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, ruhig eine Nase voll zu nehmen. Das ist nicht Gefährliches, beißt nicht oder ähnliches. Ganz richtig. Genau. Ich glaube, es vermittelt einen gewissen Eindruck. Ich kann vielleicht noch einen Punkt dazu sagen: Die Kulturtechnik des Räucherns ist natürlich auch wichtig und die gab es definitiv in Antike auch schon. Dann riecht es natürlich noch mal anders. Es ist klar, wenn man das jetzt wirklich verbrennt, auf einer Kohle oder was auch immer, entfaltet sich noch etwas ganz anderes. Auch eine sehr gute Technik, gerade für die Myrrhe, ist es einfach nur zu erhitzen, also gar nicht im chemischen Sinne zu verbrennen. Auch dann riecht es noch mal anders. Das ist jetzt sozusagen eine sehr sanfte und vorsichtige Version, wenn man es wirklich einfach nur so hat. Aber ich glaube, ein bisschen was transportiert sich schon und sie können es auch einfach mal anschauen. Das ist die typische Struktur sozusagen eines Harzes, das man dann eben von Bäumen, an denen es wächst, erntet. Und das erfahren wir auch schon in der Antike, dass man da ganz bestimmte Formen hatte und Qualitäten unterschieden hat und Ähnliches. Also das Auge riecht sozusagen auch mit, wenn man das so formulieren kann. Ja, genau.
Moderator: Gibt es etwas für die Besucher? Was, worauf Sie jetzt ihr Augenmerk legen dürfen?
Prof. Baumann: Wenn das das richtige Bild ist. Das ist, das ist ganz witzig, Tobias. Das passiert ja permanent. Man redet über Sinne und verwendet so Metaphern, wie man sprachlich sagen würde. Und meistens sind sie irgendwie visuell. Wir haben etwas vor unserem Auge, wir stellen etwas vor Auge, vor unserem inneren Auge. Wie ich schon sagte, da passiert was. Oder wir haben jetzt wissenschaftlich gesprochen, eine Imagination, aber das ist ja auch eigentlich ein Bild sozusagen. Das ist ganz interessant. Wir haben nicht so viele Metaphern, die gibt es schon auch, aber es sind nicht so viele, die sich auf Gerüche beziehen. Und das ist so ein Punkt, über den man immer auch nachgedacht hat. Das Auge quasi als Leitsinn, die visuelle Wahrnehmung. Warum eigentlich muss das so sein? Und in vielen kulturellen Kontexten hat man auch geradezu so eine Rangfolge, sozusagen von Gerüchen, kann man auch für die antiken Kulturen durchaus sagen. Und typischerweise steht das Auge so, das ist eine starke Tradition, irgendwie so oben, und die anderen sind so ein bisschen weiter unten, Gerüche vielleicht so mitten drin, aber schon auch eher so weiter unten angeordnet. Und vielleicht ist das der Punkt, den man mal sich bewusst machen kann. Unbewusst tun wir das alle, aber was ist das Besondere? Da geht es so ein Glas rum, man hält das so vor die Nase und riecht das. Und was passiert da eigentlich? Hat man da eine Idee? Gibt es irgendwas, eine Assoziation? Ist es irgendwie, was passiert? Hat man ein Gefühl oder ähnliches oder ist es eher so was Rationales, was da passiert? Da kann man vielleicht mal so ein bisschen drauf fühlen, wenn sie jetzt gerade an diesen Gläsern mal riechen. Ich glaube, das ist das Augenmerk in dicken Anführungszeichen, dass man hier vielleicht gerade mal haben kann.
Moderator: Und wenn du später in deinen Texten sitzt oder vor der Veranstaltung früher. Und warum war für dich der Geruch jetzt das Objekt der Forschung?
Prof. Baumann: Also ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine betrifft meine eigene Forschungsgeschichte sozusagen. Du hast das eben schon zitiert Tobias. Ich habe mich während meiner Promotionsphase beschäftigt mit diesem sogenannten Eikónes des Philostrats. Eikónes heißt einfach Bilder, das altgriechische Wort für Bilder. Und das ist ein Text, der auch eine sehr starke Sinnlichkeit hat, aber ganz auf das Visuelle bezogen. Weil da nämlich Bilder, konkret Gemälde einer Gemäldegalerie, beschrieben werden. Ein wichtiges Thema in der Forschung und hat immer wieder auch interessiert, aus ganz verschiedenen Gründen Literatur und Visualität. Was passiert da eigentlich? Wie geht das? Wie kann man mit Worten Bilder sozusagen hervorrufen und kommunizieren und Ähnliches? Also da war schon sozusagen auch in meiner eigenen Forschungstätigkeit irgendwie so ein Punkt mit den Sinnen irgendwie angelegt. Und in gewisser Weise knüpft jetzt dieser dieses neue Ding, was mich aktuell gerade sehr beschäftigt mit den Gerüchen daran an. Also ein anderer Sinn, aber in gewisser Weise vielleicht eine verwandte Fragestellung. Man hat Worte oder einen Text und dann hat man so eine Sinnlichkeit. Und wie funktioniert das sozusagen? Das ist vielleicht ein Punkt. Tja, und dann der zweite Punkt, das haben sie jetzt vielleicht auch alle schon, dass das kommt. Also Gerüche haben mich halt auch interessiert, das ist ja klar. Man hat so seine Interessen und Dinge sprechen einen an und dann passen vielleicht auch Dinge zusammen. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, ganz klar. Ja.
Moderator: Wie kommen die Gerüche an? Wohlig?
Gast: Noch gar nicht.
Prof. Baumann: Ja, ja, aber das ist ja okay.
Gast: Was war das?
Prof. Baumann: Myrrhe. Das ist ein bisschen gröber aussehend. Das etwas glattere, in tropfenförmig sozusagen, das ist der Weihrauch. Ja.
Gast. Was ist die Myrrhe dann für eine Pflanze?
Prof. Baumann: Die Myrrhe ist das Harz des Myrrhebaums.
Gast: Also ein Baum?
Prof. Baumann: Genauso es ist ein Baum. Ein Harz vom Baum. Ganz genau. Beim Weihrauch ist es ganz ähnlich. Es gibt diese Weihrauchbäume. Sehr knorrige, sehr, sehr, sehr stark geformte Bäume sozusagen, die in bestimmten Klimata wachsen. Da gibt es dann bestimmte Voraussetzungen, die man auch benennen und beschreiben kann. Und dann produzieren die gewissermaßen die Bäume, dieses Harz. Das kann man dann ernten. Und das ist eine sehr alte Kulturtechnik, die wirklich schon Jahrtausende zurückreicht. Und auf diese Weise gewinnt man das, auch in der Antike schon in den Regionen, in denen man es auch heute gewinnt. Also schon der Antike war das die Assoziation, man hat Myrrhe oder Weihrauch und verbindet das mit dem südlichen Teil der arabischen Halbinsel. Dem, was man in der Antike gerne das glückliche Arabien nannte. Glücklich, weil es eben diese ganzen Dinge hervorbringt und damit sozusagen gesegnet ist. Genau. Also das sind Harze. Das ist eine Art sozusagen, wie Geruchsstoffe sich für uns zeigen in der Natur, wie man sie gewinnen kann. Es gibt natürlich auch andere, nämlich ätherische Öle, die in anderen Teilen einer Pflanze sein können, die man anderer Weise rauszieht. Aber das, was jetzt gerade herumgeht, ist alles ein Harz. Und im Falle dieses Rosenweihrauches dann ein Harz, das noch mit einem ätherischen Öl versetzt ist, nämlich mit Rosenöl. Ja, genau, aus Jemen. Genau.
Moderator: Warten Sie kurz das man entsprechend das hört. Genau das alles hören.
Gast: Ja, wenn man die Myrrhe und den Weihrauch vergleicht, dann ist die Myrrhe noch das Kostbare von beiden, oder?
Prof. Baumann: Also letzten Endes wahrscheinlich sogar schon. Ich glaube das schon. Das ist auch eine Frage des Marktes natürlich irgendwie, nicht? Und dann sind wir bei einem Punkt, wo wir erstaunlich präzise Informationen schon aus der Antike haben. Ganz interessant. Schon da gibt es Texte, die sagen, welche Qualitäten es gibt, worauf man achten soll, wie die besten aussehen, wo die herkommen und Ähnliches. Ja, ich glaube in der Tat, dass der Myrrheanbau oder das Vorkommen noch ein bisschen restriktiver gewissermaßen ist als der Weihrauch und es insofern vielleicht das Kostbarere ist. Was jetzt so der aktuelle Großhandelspreis ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber ich glaube auch, dass es vielleicht insofern noch mal das etwas Speziellere gewissermaßen ist.
Gast: Und die ist irgendwie auch feiner.
Prof. Baumann: Also ich finde das tatsächlich auch. Ich finde, das ist nochmal so vom Geruchsspektrum her nochmal ein bisschen ja ich finde auch feiner vielleicht. Myrrhe ist auch etwas, wenn man das wirklich verbrennt, kommt es finde ich gar nicht so gut zur Geltung wie wenn man es einfach nur erhitzt. Das ist dann ein langsamerer Prozess nicht so stark natürlich, verteilt sich nicht so stark im Raum, aber dann finde ich, hat man dieses wirklich sehr komplexe Aroma der Myrrhe wirklich ganz ganz gut da. Für den Weihrauch ist es andererseits so, dass sich verschiedene Weihrauchsorten und Qualitäten auch wirklich sehr stark unterscheiden. Also das, was man zum Beispiel in der Kirche so dargeboten bekommt, ist dann oft aus naheliegenden Gründen nicht unbedingt die beste oder teuerste Qualität. Es ist aus verschiedenen Gründen auch gar nicht sinnvoll oder möglich. Da gibt es verschiedene, verschiedene Dinge, die man da auch ins Spiel bringen kann. Und das ist ein ganz erstaunliches Spektrum. Unterschiedliche Weihrauchsorten riechen tatsächlich stärker anders, als man es vielleicht denken würde. Also auch da, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, probieren Sie mal, wie es ist, wenn man es nicht verbrennt, sondern dann irgendwie ein bisschen erhitzt und anders macht. Das gibt dann ganz unterschiedliche Entfaltung. Ist auch ziemlich spannend, das mal zu testen. Ja.
Moderator: Mario, du sagtest, du redest von Kulturtechniken. Ist zu texten, Texte zu schreiben auch eine Kulturtechnik?
Prof. Baumann: Ja definitiv das ist auch eine. Ja. Ganz genau.
Moderator: Und unterscheidet sich das? Also, der Autor, der damals einen Text verfasst hat, hatte der etwas anderes vor Augen und im Sinne, als wir das heute tun?
Prof. Baumann: Tja, wahrscheinlich schon. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tiefe Frage, Tobias, zu der man viel Vieles sagen kann. Was macht man mit dieser großen historischen Distanz? Und und welche Änderungen sind da zu verzeichnen? Man kann die Frage für die Autoren stellen. Fürs Publikum natürlich genauso. Haben antike Leserinnen und Leser eigentlich auf einen Text ähnlich reagiert, wie wir es heute auch tun? Können wir unsere Erfahrungen nehmen und sagen: Okay, das ist das, was ein Text tut? Und war das dann auch damals so? Gar nicht so ganz leicht zu beantworten ehrlich gesagt. Und ich glaube, wie so oft fällt die Antwort vermutlich gemischt aus. Es gibt da schon Konstanten. Das ist schon so und ich glaube wir dürfen schon das Zutrauen haben, dass wenn wir ein bestimmtes Grundempfinden zu einem Text haben, das jetzt nicht völlig anders sein muss von dem, was man auch in der Antike irgendwie empfunden haben kann. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch klar Es ist ja doch eine andere Kultur. Das sind Dinge, zum Teil auch deutlich unterschiedlich. Da kann man jetzt auf die sozialen Strukturen schauen. Wir können auf so was schauen, wie antike Religion. Also im antiken Kult ist ja dann genau das auch beheimatet, dass man Weihrauch verbrennt, zum Beispiel um ihn den Göttern zu opfern. Das ist etwas, was wir in sehr vielen Kulturen natürlich finden. Das kennen wir durchaus ja auch, wenn wir etwa an den Gebrauch von Weihrauch, etwa in der Kirche denken und Ähnliches. Das hat eine lange, lange Kulturgeschichte. Aber das sind Dinge natürlich auch anders. Und von daher müssen wir schon in Rechnung stellen, das vom inneren oder äußeren Auge doch auch möglicherweise andere Dinge dagewesen sind. Ich glaube, aus dieser Spannung heraus- Einerseits gibt es Dinge, die sind irgendwie ähnlich und darauf können wir auch in gewisser Weise bauen und andererseits sind Dinge eben auch anders- Ich glaube, das ist es, was es so spannend macht, sich mit diesen alten Texten zu beschäftigen, weil beides irgendwie da ist. Aber das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss und die man irgendwie auch immer wieder neu beantworten muss. Was ist da, was ist ähnlich, wo kann man auch reingehen, was ist irgendwie anders? Manchmal kann einen das auch echt befremden kann ich aus Erfahrung sagen, was einem so geboten wird aus diesen alten Kulturen. Und damit kann man umgehen, auch als Wissenschaftler. Muss man aber glaube ich auch irgendwie, das ist schon so.
Moderator: Okay interessant ja. Gibt es noch beschreibende Worte aus dem Publikum für die Geruchsempfindung, die geteilt werden möchte?
Gast: Ich habe jetzt keinen großen Unterschied festgestellt zwischen dem Weihrauch mit dem Rosenöl und dem Weihrauch ohne das Rosenöl. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass der Weihrauch, der pur war, noch ein bisschen intensiver war. Und ja, man hat jetzt aus der Substanz heraus auch nicht ablesen können. Wenn Sie das nicht dazu gesagt hätten, dass der eine mit Rosenöl versetzt ist und der andere nicht.
Prof. Baumann: Ja, ja.
Gast: Das ist meine Empfindung gewesen. Und ich, ich habe mir die Frage gestellt, ob man mit der Myrrhe vielleicht auch ähnliche Effekte erzielen könnte, wenn es so- vielleicht ist das Öl schon ein bisschen verflogen und dadurch ist der Duft ein bisschen flüchtiger geworden. Ob das dann auch noch eine andere Dimension ist vom Geruchsempfinden her ist, als wenn man es verbrennt, wenn räuchert?
Prof. Baumann: Bestimmt, ganz sicher. Natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall so.. Ja.
Moderator: Ich komme erst noch hier hinten lang. Bitteschön
Gast: Danke, um da anzuknüpfen. Ich fand es genau andersrum. Ich fand den mit dem Öl sehr viel intensiver tatsächlich. Ich habe den anderen kaum gerochen, fand den Weihrauch aber allgemein nicht so wohlriechend wie die Myrrhe. Ja, meine Meinung.
Gast: Also ich kann mich ja genau anschließen an meinen Vorgänger. Ich fand auch das mit Rosen wesentlich angenehmer als das ohne Rosen. Und wenn ich vorher, wenn ich wählen sollte, eins von den dreien zu behalten, dann würde ich die Myrrhe behalten.
Gast: Ja, und jetzt sind es schon drei. Ich fand auch mit den Rosen versetzte. Das hat mich fast umgehauen. Das fand ich so was von hoch potenziert. Also sofort Buff und ganz viel, extrem. Das andere, das erste war, weiß ich nicht mehr, Myrrhe?
Prof. Baumann: Myrrhe, genau, das allererste.
Gast: Das fand ich sehr hoch, fein schwingend, so für mich. Und das Andere fand ich so dazwischen. Aber die Rose war so Bum-Peng also total genial so. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches ich am liebsten hätte. Ich fand alle genial für sich, also jedes für sich fand ich hat so seine Stärke und sein Ja, ja, macht mein Gehirn so ist es, so hat so jeder seine seine Aufgabe, finde ich. Das habe ich so gemerkt für mich.
Prof. Baumann: Ja, ja, schön.
Gast: So ist die ganz praktische Frage. Wir sind ja nicht zufälligerweise jetzt im Botanischen Garten. Gibt es die Gewächse hier?
Mitarbeitende des Botanischen Gartens: Also Weihrauch haben wir, eine Myrrhe haben wir nicht.
Gast: Okay, und wo ist der Weihrauch?
Mitarbeitende: Hinter den Kulissen.
Gast: Ne ich will einfach nur mal sehen, wie er aussieht.
Mitarbeitende: Kann ich holen wenn Sie möchten.
Prof. Baumann: Na, das wäre doch was.
Mitarbeitende: Wenn dann jemand die Technik bewacht dann?
Prof. Baumann: Ja, doch, doch ich glaube, das bekommen wir hin. Ja. Guter Punkt. Exakt. Wo wir im Botanischen Garten sind. Ich habe ihn nämlich gestern noch gesucht und auch nicht gefunden. Ich wusste nicht, dass er hinter den Kulissen steht. Aber das ist ja schön, dass er jetzt so kommt. Also ich kann vielleicht, Tobias, vielleicht ganz kurz. Ich muss das jetzt ja nicht im Einzelnen kommentieren, oder? Oder man hat ja auch eine Wahrnehmung und dann ist die erst mal so da. Ich finde das toll, was alles so gesagt worden ist. Vielleicht kann man einfach so ein, zwei Punkte noch dazu sagen. Ja, also Geruchswahrnehmung hat sicherlich auch stark damit zu tun, welche Erfahrungen man überhaupt schon hat mit Gerüchen. Ist das was ganz Neues? Riecht man es zum ersten Mal oder ist das irgendwie etwas, was man vielleicht auch auffrischt als Eindruck? Hat man so ein bisschen ein Vergleichsbeispiel im Kopf oder irgendwie gar nicht? Ich glaube, das spielt spielt eine große Rolle, irgendwie immer natürlich bei Sinneswahrnehmung, aber ich glaube, so bei Gerüchen vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als bei anderen, anderen Sinneseindrücken. Und dann sind Gerüche sicherlich was. Und das hat einfach konkret auch mit der Physiologie des Geruchssinn zu tun, wo so Umgebungsfaktoren auch eine große Rolle spielen. Das das wurde eben schon gesagt, ja dann wird es geräuchert und das weht jetzt so durch den ganzen Raum oder hat man das so relativ konzentriert? Das ist auch ganz anders ob man das Glas frisch aufmacht und dann kommt das, das wäre vielleicht der Effekt noch einmal verstärkt, den Sie beschrieben haben, dass man so diesen Knalleffekt sozusagen hat, oder ist das ist schon so ein bisschen breiter sozusagen? Manche Gerüche stehen stärker im Raum, andere wandern sozusagen, und das ist ganz interessant, dass es da viel gibt, was da sozusagen passiert. Und das ist etwas, was man interessanterweise, da können wir fast schon so ein bisschen auch so auf die Textrichtung einbiegen. Das findet man in den literarischen, sagen wir mal Darstellung von Gerüchen auch durchaus gespiegelt. Das ist interessant. Also diese antiken Texte, die ich da aktuell so untersuche, die wissen das auch irgendwie, dass es genau darum geht. Dann wird drüber nachgedacht, wie kommt der Weihrauchduft eigentlich zu den Göttern hoch? Also er steigt auf durch den Rauch und dann kommt der Wind und verwirbelt das und trägt es hoch auch zu einem Medium sozusagen, dass es irgendwie überträgt. Und das kann klappen oder vielleicht auch mal nicht. Das ist dann auch so ein Punkt. Also das ist eben interessant, dass es darauf doch auch irgendwie ankommt. Und da kann man was draus machen, sozusagen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, von daher toll, Danke für diese Eindrücke!
Moderator: Ich möchte kurz noch was dazu sagen, bevor wir in die Auswertung gehen des Textes. Weil ich überrascht war zunächst. Das Thema ist der Duft des Textes und ich ging zunächst davon aus, dass wir letzten Endes ein Buch in die Hand bekommen. Und das riecht. Das riecht nach Bibliothek, zum Beispiel, nach alten, vergilbten, nach der Tinte, nach der vergilbten, nach den Blättern, die lange in der Sonne standen. Und das ist gar nicht so, nee? Wir schließen jetzt über die Gerüche nicht darauf zurück welche Art der Tinte haben Sie benutzt, welche Techniken der Zivilisation steckt dahinter?
Prof. Baumann: Das hat eigentlich einen ganz schlichten Grund. Also klar spielt der Titel "Der Duft des Textes" genau mit dieser Doppeldeutigkeit. Klar, dass das ist auch irgendwie der Witz. Für die Antike ist das ein bisschen schwierig, weil ehrlich gesagt Bücher, die direkt noch aus der Antike kommen? Eigentlich eher nicht na, leider. Also schon, gibt es einzelne. Ja, das kann schon mal sein, dass man Einzelfälle hat. In der Regel dann aus der späteren Antike, also aus den nachchristlichen Jahrhunderten, ist es schon so, dass uns da auch mal einzelne Texte wirklich in Form von antiken Büchern überliefert sind. Und da könnte man die Nase dran halten. Und es wäre wahrscheinlich schon auch irgendwie aufschlussreich. Denke ich schon. Man kann das schon irgendwie riechen. Die altern natürlich, das Alter, ist das dann irgendwie auf Papyrus oder auf Pergament? Das hat dann schon auch durchaus olfaktorische Eigenschaften sozusagen. Okay, aber für den Großteil der Texte, die wir aus der Antike erhalten haben, kommen wir so weit gar nicht zurück. Da sind die ältesten konkreten Exemplare der Texte, die wir haben, in der Regel dann mittelalterlich und weiter zurück kommt man nicht. Oder nur in Form von kleinen Fragmenten, da gibt es vielleicht mal ein Stück Papyrus sozusagen. Der ist da vielleicht auch noch ein bisschen älter als aus den nachchristlichen Jahrhunderten, und da ist dann vielleicht mal ein bisschen was drauf. Aber in der Regel sind wir eben auf nachantike Überlieferungsträger angewiesen. Und auch da kann man die Nase ranhalten. Definitiv, das geht. Aber so kommen wir riechend direkt in die Antike, glaube ich nur schwer zurück. Das ist, glaube ich der sachliche Punkt, der dahinter steht. Aber das ist, das ist schon auch wirklich ein ganz spannender Punkt. Also Bücher als Gegenstände haben ja auch so irgendwie ihre Geschichte, ihre Eigenheiten und das auch sinnlich. Das ist ganz interessant, was man sieht, Abnutzungsspuren, die sind benutzt, abgerieben, irgendwie umgeblättert, da waren Finger drauf oder ähnliches. Das kann man schon alles sehen. Das ist ganz spannend, da war die Haptik wieder genau das Stichwort. Ja, schöner Zugriff auf Bücher.
Moderator: Okay. Und unser Zugriff ist jetzt sehr gut. Da kommt die Myrrhe oder der Weihrauch. Was war das nochmal? Weihrauch?
Prof. Baumann: Ja, genau.
Mitarbeitende: Steht der da gut oder soll ich?
Prof. Baumann: Ja der steht gut.
Gast: Wird nicht größer der bleibt so?
Prof. Baumann: Ne der wird definitiv-
Mitarbeitende: Wir haben nur einen begrenzten Platz im Gewächshaus und er wächst langsam, das ist ein kein großer Baum, mehr was baum-strauchiges. Ja, der kann schon fünf, sechs Meter hoch werden. Aber er wächst sehr, sehr langsam. Ich glaube, das Ding ist 25 Jahre alt oder so.
Moderator: Okay, noch mal -
Gast: Und das Harz, ist das dann im Stamm oder wo ist das?
Mitarbeitende: Im Stamm drin. Das wird angeschnitten wie bei Kiefern auch. Die Kiefern ritzen sie ja auch. Und dann kommt das Harz raus.
Moderator: Genau. Ich resümieren noch mal, vielleicht hat man es nicht gehört. Wenn man den Stamm anritzt, dann kommt das Harz aus dem Stamm rausgeflossen. Es verhärtet sich über die Zeit und dann kann man daran riechen und es räuchern. Genau. Kurz zurück zum eigentlichen Thema, wie wir jetzt die Erschließung der Gerüche vollziehen, ist, dass wir den Text einmal in die Menge geben. Ähm, und wir gucken uns eigentlich an, wie der Autor den Geruch empfindet, durch das wir ihn beschreibt.
Prof. Baumann: Genau, ein klassisches Handout, wie der Philologe gerne so arbeitet. Es passt, dass der Wind gerade etwas nachgelassen hat, dass das Papier hoffentlich da bleibt. Genau. Sie können sich einfach ein Exemplar greifen. Ja, der Autor in der Tat, der ist natürlich da irgendwie im Spiel. Aber dann werden wir gleich sehen, gibt es auch im Text sozusagen Figuren, auf die die Wahrnehmung hin bezogen ist. Also das ist jetzt so ein Punkt, da spricht der Literaturwissenschaftler, nicht, Autor ist eine Sache. Und dann gibt es ja Figuren in einem Text, die können zum Autor in diversen Verhältnissen stehen, aber zunächst mal sind sie was Eigenes, sozusagen. Und was wir hier in diesem Text vorgeführt bekommen, ist die Vorstellung gewissermaßen. Was passiert eigentlich, wenn jemand mit dem Schiff in einer bestimmten Gegend der antiken Welt entlangfährt? Konkret der Gegend die wir Rotes Meer nennen, also das Meer zwischen Ägypten und der arabischen Halbinsel. Und das wird sehr konsequent in diesem Text so beschrieben. Wirklich man fängt da irgendwie am Nordende des Roten Meeres an und schippert dann da irgendwie so allmählich runter. Und dann kommt man eben irgendwann in diese Zone des, wie ich eben schon sagte, der Antike gerne so genannten glücklichen Arabiens, wo eben dann dieser Baum und andere Dinge beheimatet sind und schon in der Antike beheimatet war. Und dann passieren eben bestimmte Dinge, die geruchsmäßig sind. Und das meine ich. Also da gibt es einen Autor, das ist ein gewisser Diodor von Sizilien, ein Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, so ungefähr in der Zeit von Gaius Julius Caesar. Wenn Sie so irgendwie so einen, so ein Anker haben wollen, wo man den so hintütet sozusagen, das ist so die zeitliche Ecke. Kam eben aus Sizilien, schreibt, wie Sie hier unschwer erkennen können, auf Griechisch. Und das ist ein ganz spannender Text, weil das nämlich der sehr unbescheidene Anspruch ist, einmal die gesamte Geschichte der Menschheit niederzuschreiben. Holla! Eine Universalgeschichte, wie man so schön sagt. Und man fängt an, so bei den ersten Menschen, die laut Diodor wahrscheinlich irgendwie so aus Ägypten gekommen sind. Eine in der Antike weit verbreitete Hypothese, dass das so die älteste Kultur ist, wo das mal so angefangen hat mit den Menschen. Und dann führt er diese Geschichtsschreibung fort bis in seine eigene Zeit. Da ist dann eben dieser Caesar, eine sehr wichtige Figur. Und am Anfang dieses, am Anfang dieses Textes gibt es so mehrere Bücher, in denen ja gewissermaßen die Bühne, auf der diese menschliche Geschichte spielt, also die Geografie, die ganze damals bekannte und bewohnte Welt und wer da so gelebt hat und was die Lebensweise der Völker sind, mal so vorgestellt werden, gewissermaßen. Und in diesen großen Kontext gehört auch diese Schilderung dieser Seefahrt sozusagen durch das Rote Meer rein. Ist das gut, wenn man das mitdenkt, gewissermaßen als Kontext. Und sehr viel mehr will ich eigentlich vorher gar nicht sagen. Wir können gleich völlig frei ins Gespräch darüber kommen. Und ich gebe mal die eine und sozusagen entscheidende Partie dieses Textes, das, was Sie auf Seite eins auf dem Handout finden, zum Besten sozusagen. Und Sie können einfach mal ein bisschen sagen, so bewusst mitlaufen lassen in Ihrem Kopf die Frage, was passiert da jetzt eigentlich, wenn man das so liest oder hört? Nach diesem, und das bezieht sich jetzt auf andere Stämme der Araber, die vorher schon beschrieben worden sind in dieser Beschreibung dieser Seefahrt, kommen die sogenannten Karben und danach die Sabäer der volksreichste der arabischen Stämme. Sie leben im sogenannten glücklichen Arabien, das das meiste von dem hervorbringt, was bei uns als wertvoll gilt und zudem eine unbeschreibliche Menge Vieh aller Arten ernährt. Und ein natürlicher Wohlgeruch durchzieht das ganze Land, weil fast alle Pflanzen, die die besten Düfte erzeugen, dort ununterbrochen wachsen. An seiner Küste nämlich wachsen der sogenannte Balsam, der zu Kassia und ein anderes Kraut von eigentümlicher Natur. In frischem Zustand bietet es die herrlichste Augenweide, hebt man es aber eine Zeit lang auf, dann verwelkt es plötzlich. Im Binnenland wiederum findet man dichtes Gehölz, darunter große Weihrauch- und Myrrhebäume, außerdem Palmen, Kalmuspflanzen, Zimtbäume und die Arten, die einen ähnlichen Wohlgeruch besitzen. Fülle und Übermaß dieses Geruchs, der von ihnen allen zusammenströmt, machen es nämlich unmöglich, die besonderen Eigenschaften und die Natur jeder einzelnen dieser Pflanzen aufzuzählen. Denn es herrscht offensichtlich ein geradezu göttlicher, mit Worten nicht fassbarer Duft, der dort auf die Sinne jedes einzelnen eindringt und sie erregt. Selbst Vorüberfahrende, weit vom Festland entfernt, werden dieses Genusses noch teilhaftig. Zur Sommerzeit nämlich, wenn der Wind vom Lande weht, geschieht es, dass sich die von den Myrrhebäumen und den anderen derartigen Gewächsen freigesetzten Düfte bis in die nahen Regionen des Meeres ausbreiten. Und zwar handelt es sich dabei nicht, wie bei uns etwa, um den Geruch abgestandener alter Gewürze, sondern um die starke Kraft frischer Blüten, die bis zu den feinsten Partien des Geruchssinn durchdringt. Denn der Wind weht diese Ausströmung wohlriechenster Pflanzen davon und trägt den Seeleuten, die sich der Küste nähern, ein angenehmes und volles, dazu gesundes und exotisches Gemisch vom Besten zu. Und dies kommt weder von einer zerschnittenen Frucht, deren eigentümliche Kraft schon verflogen ist, noch von einer, die in Gefäßen aus einem anderen Material eingelagert wurde, sondern unmittelbar von der frischen Blüte, wenn die göttliche Natur den Trieb in seiner reinen Form darbietet. Daher glaubt, wer an diesem einzigartigen Duft je teilhat, die Ambrosia zu genießen, von der die Mythen erzählen, kann man doch aufgrund der überragenden Qualität des Wohlgeruchs keine andere passende Bezeichnung finden. Eine sachliche Erklärung vielleicht, wenn Sie den Begriff nicht kennen. Ambrosia ist eine der Speisen der Götter, Nektar und Ambrosia, also etwas ganz Besonderes, das dem Menschen eben eigentlich nicht zur Verfügung steht. Aber das kommt offenbar an, dieser Geruch in dieser Gegend von Arabien. Ich lass es mal kurz hier. Wir können dann, wenn Zeit, Interesse besteht, auch gleich noch auf die zweite Seite schauen, aber vielleicht erst mal so weit. Und ich will mal zwei, drei Punkte einfach so ein bisschen zur Blicklenkung sagen und dann können wir aber wie gesagt sehr gerne auch einfach frei ins Gespräch kommen, wie es ja auch die Idee dieser Veranstaltung ist. Was ich hier interessant finde, ist, dass eigentlich die konkrete Qualität dieser Gerüche vom Text überhaupt nicht beschrieben wird. Und das wird ja sogar noch explizit gemacht. Das heißt ja ausdrücklich: Geht gar nicht. Das ist so überragend gut, so gewaltig wohlriechend und so überwältigend, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Trotzdem ist aber mein Eindruck, wir können gleich drüber reden, wenn Sie es anders sehen und mir widersprechen wollen, dann die herzliche Einladung, das auch gleich zu tun. Trotzdem gibt es schon aber natürlich irgendwie einen Anstoß an uns als Leser, dass wir uns schon was vorstellen. Und das finde ich interessant, wie das hier läuft, nämlich irgendwie über diesen Trick sozusagen, dass es heißt nicht wie bei uns, also nicht wie hier im Glas sozusagen. Das ist, das ist das exportierte Zeug. Also das wird dann geerntet, wie es eben schon hieß, man ritzt das an und zieht das raus, dann trocknet es usw., dann wird es auch noch verpackt und am Ende noch gemischt oder irgendwas. So, dann landet es dann irgendwie da, wo so ein Diodor schreibt, Also sagen wir mal Sizilien, so im Mittelmeerraum. Ist aber eben nicht mehr dasselbe. Also das finde ich interessant. Also der Impuls ist sagen wir so an die Leserinnen und Leser: Stellt euch mal das vor, was ihr kennt. Ja irgendwie Gewürze so, die man aus dem Regal zieht oder eben so was hier, wie ist das hier gerade dargeboten wurde. Wenn man sich das jetzt noch mal in der ganz frischen Originalversion vorstellt, in einem natürlichen Kontext, dann zur Hauptblütezeit und dann alles zusammen, irgendwie, dann kommt man vielleicht so irgendwie an diese Vorstellung heran, wie es da gewesen ist. Aber es ist interessant, keine Beschreibung: Ach, das riecht jetzt aber nach Blume oder irgendwie nach Orange oder irgendwie scharf oder irgendwie aromatisch in der Weise, oder das ist ein Harzgeruch oder wie auch immer. Das wird überhaupt gar nicht versucht vom Text dann. Es ist ganz stark dieses Beschreiben einer Wirkung, das weht so raus aufs Meer, dringt ein in den Geruchssinn und dann ist das Wuff dann wie Ambrosia. Das, das finde ich eben sehr interessant. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo es für den Philologen, Literatur- und Kulturwissenschaftler spannend wird. Wie kommt das jetzt sozusagen zusammen? Also einerseits wissen wir über diese antiken Mittelmeerkulturen, dass die, vielleicht nicht buchstäblich so ein Glas, aber jedenfalls irgendwie Weihrauch auch da hatten und Myrrhe. Also wenn ein Leser damals irgendwie in Griechenland oder in Italien, wie auch immer diesen Text jetzt liest oder hört und denkt so ein bisschen nach, dann haben die schon irgendwie Erfahrung damit. Aber klar, da im südlichen Arabien war vermutlich praktisch niemand aus dieser Leserschaft. Nicht ausgeschlossen, dass irgendwelche griechische oder römischen Händler da mal hingeschippert sind. Aber im Prinzip ist das schon sehr weit weg. Und das ist das Interessante sozusagen, dass Literatur es irgendwie hinkriegt, so eine Distanz dann doch in gewisser Weise zu überbrücken. Und so schwer es ist, Gerüche irgendwie zu beschreiben und und so wenig dieser Text das auch konkret versucht, ist es doch die Einladung an uns, uns schon da irgendwie was vorzustellen und wie das sozusagen zusammenkommt. Also so was Konkretes, Materielles hier, so eine Kultur, wo das irgendwie da ist und dann soll das, was so ein Text macht, der einfach so was beschreiben, vor Augen vor die Nase stellen? Kann man das sagen? Eigentlich nicht, aber ich glaube, sie verstehen, was ich meine. Da wird es interessant und da hakt sozusagen jetzt dann der Philologe ein und dann geht es los, gewissermaßen. Also das vielleicht, um so ein bisschen den Blick zu lenken, warum mich so was interessiert und auch, was da vielleicht im Schwange ist, wenn man sowas hört oder liest.
Moderator: Kann das nachempfunden werden? Die andere Dimension statt der reinen Beschreibung, die ist ja eigentlich eine dynamische Dimension dann?
Prof. Baumann: Stimmt ja, ist richtig? Genau.
Moderator: Welche Textstelle ist besonders interessant für dich Mario? Die mit dem Herauswehen aufs Meer hinaus?
Prof. Baumann: Ich finde, das glaube ich tatsächlich, wenn ich jetzt hier noch mal so einen Punkt benennen sollte, wo ich finde, da ist es irgendwie das, was mich interessiert und so. Ich glaube wirklich das. Das ist einerseits der Punkt, den ich eben schon nannte, dass die erstaunlich stark in der Antike damit umgehen, wie so unsere Großwahrnehmung funktioniert. Das ist ganz spannend, dass hier sich mal konkret so vorzustellen, also unmöglich ist es nicht, aber schon irgendwie krass. Also es muss, müsste schon ein wirklich sehr, sehr starker Geruch sein, dass das wirklich buchstäblich so vorstellbar sein sollte. Man schippert da an der Küste lang und dann riecht man dass da noch draußen auf dem Meer. Ja, vielleicht, aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen so und so funktionieren Texte ja ganz oft. Da haben sie mal vom berühmten Begriff der Fiktionalität gehört. Das ist so das, was der Literaturwissenschaftler so im Munde führt, dass Texte schon irgendwie natürlich mit der Wirklichkeit umgehen. Klar. Man kann sie ja dann auch in einen historischen Kontext stellen, in eine Kultur und Ähnliches. Aber irgendwie machen sie auch so ein eigenes Ding. Weil manchmal glaubt man es ja auch irgendwie nicht, was so im Text steht. Oder wir wissen rundheraus, ist vielleicht dann doch nicht ganz das, aber so dazwischen, irgendwie so was. Ja, aber das ist hier auch genau so ein Ding. Irgendwie ist das nicht unplausibel, aber es macht schon auch irgendwie klar, dass hier eine ganz besondere Konstellation da ist. Und wenn wir uns das wirklich vorstellen wollen, da muss dieser Geruch schon wirklich sehr groß und wirklich sehr, sehr gut sein, sonst würde das so nicht gehen. Und das wird herausgegriffen und da macht der Text auch irgendwie was draus. Das finde ich spannend.
Moderator: Okay, als du den Text lasest, wie ist der der, der wie nennt man das? Das Vergangenheitsverbum? last?
Prof. Baumann: Ich glaube ja.
Moderator: Als du das last, gelesen hast und last
Prof. Baumann: Vielleicht so..
Moderator: Was ist denn jetzt das Werkzeug, das du an die Hand nimmst, um-. Gehst du weiter in eine Analyse oder verbindest du das mit anderen, ich weiß nicht, Themenbereichen? Mit anderen, noch anderen Werkzeugen, die du als Philologe hast?
Prof. Baumann: Genau. Ich kann ja mal so ein bisschen einfach so schildern, was man damit so machen könnte. Das kann man jetzt nicht immer in jeder konkreten Analyse alles gleich so kombinieren. Da gibt es auch so ehrlich gesagt so zeitliche Einschränkungen und solche Dinge. Aber so verschiedene Richtungen kann man ja mal schildern. Zum Einen kann man natürlich die Frage stellen: Wie gehört das jetzt eigentlich in den großen Zusammenhang dieses konkreten Textes? Ich sagte schon Universalgeschichte und eigentlich der Anspruch, so die Menschheitsgeschichte zu schildern. Und das ist ja offenbar Geschichte erzählen mit allen Sinnen. Ziemlich interessant. Und das kann man dann natürlich fragen. Da wäre dann literaturwissenschaftlich betrachtet so eine Kategorie wie Textsorte, Textgattung irgendwie im Spiel. Was ist das für eine Vorstellung von Historiografie? Nicht alle historiographischen Texte aus der Antike funktionieren so, vielleicht kommt es uns auch überraschend vor. Das ist ein Beitrag zum historischen Verständnis, dass da Leute lang schippern, das so riechen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Was heißt das eigentlich? Das wäre zum Beispiel mal so eine Fragerichtung. Man kann natürlich die Frage stellen, wie ich es eben schon andeutete, man hat es diesen Text. Und dann wissen wir ja auch bestimmte Dinge über diese antike Kultur, dass da Dinge auch da waren. Ähnliches kann man sich auch fragen. Und da Tobias, ist vielleicht auch dann die Möglichkeit, sich der Frage zu nähern, die du eben schon gestellt hast. Wir sitzen jetzt hier als Zuhörer oder Leserin oder wie auch immer, im Jahr 2023 ist das jetzt eine ähnliche Wahrnehmung bei uns wie damals eigentlich? Müssen wir für die antiken Leser noch mal was anderes veranschlagen, können wir das benennen? So eine Frage kann man natürlich auch stellen. Und dann wird es aber natürlich besonders interessant, wenn man jetzt mal versucht, wirklich konkret zu benennen, was macht dieser Text jetzt eigentlich ganz genau? Wie geht das sozusagen, wie wird unsere Vorstellung da eigentlich angeregt? Da gibt es dann bestimmte Begriffe, dann muss ich dann schon als Philologe auf die linke Spalte dieses Papiers schauen und nicht nur auf die rechte, das ist irgendwie auch klar. Wie geht das damit, was sind also die Argumente, diese Technik sozusagen, die kann man auch gut literaturwissenschaftlich beschreiben, dass man in einem Text Figuren hat, die etwas wahrnehmen? Das ist interessant, ist das dann sozusagen die Perspektive, die uns auch nahegelegt wird? Wahrscheinlich schon oder? Man kann ja versuchen, sich mal gedanklich auf dieses Schiff zu setzen, das da langfährt. Und wie würde sich das anfühlen? Weil ja hoffentlich schon ziemlich gut. Man würde diesen Geruch bekommen so irgendwie. So Einladungen sozusagen die so ein Text ausspielt. Das kann man beschreiben. Was sind das so für, für Potentiale und und Mechanismen die dem Leser angeboten werden? Wie geht man da rein? Da kann man auch noch mal fragen, was passiert denn eigentlich ganz genau? Was ist das eigentlich konkret für eine Wirkung? Kann man die genauer benennen? Was heißt das denn eigentlich? Und was sagt das dann auch über diesen Text aus? Denn er will ja offenbar auch genau so einen Eindruck bei uns erzeugen. Dieses Insistieren darauf, das ist der Geruch der Gerüche, sozusagen das das will ja irgendwas bei uns auch bewirken. Und das, glaube ich, sind vielleicht mal so bestimmte Schritte, die man, die man benennen kann, die man dann geht, wenn man so einen Text hat und versucht, da irgendwie reinzugehen. Aber eines sage ich schon ganz ehrlich dazu, das ist jetzt für den Wissenschaftler immer so ein bisschen, so ein heikler Punkt. Ich glaube, in Wahrheit arbeiten alle Textwissenschaftler so, man will es aber oft nicht ganz so einräumen, weil es natürlich sofort die Frage aufwirft: Kannst du das objektivieren? Natürlich kommt man auch von seinem eigenen Empfinden her. Das ist ja schon so, ich lese so einen Text und schaue erst mal, was macht der jetzt mit mir eigentlich? Natürlich, das kann nicht, das ist noch keine Analyse, logisch, das ist ein Einstieg sozusagen. Da muss man schauen, kann ich das festmachen? Kann ich argumentieren, dass das irgendwie jetzt grundsätzlich so ein Punkt für diesen Text ist? Kann man, glaube ich, durchaus an der Stelle. Aber ich glaube, das ist schon eine gute Technik und das gebe ich gerne auch als Einladung in die Runde. Ich glaube, man kann Texte so lesen, ist dann sehr spannend, wenn man auch andere Eindrücke dieser Art gewinnt. Man kann sie nebeneinanderhalten, man kann sie diskutieren. Manchmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass andere den Text irgendwie anders lesen. Das kommt vor. Auch in der Wissenschaft. Und dann muss man eben sehen, was heißt das und wie geht man damit um? Aber eigentlich ist dann so dieses hier mal der, der Nase nachzugehen keine schlechte Technik, glaube ich. Zumal für so einen Text, der das ja offenbar auch will und uns dazu irgendwie anstößt. Das tue ich schon auch und das muss man ja vermitteln natürlich. Da hat man diese konkreten Analyseschritte, wenn es dann wirklich richtig wissenschaftlich wird und Ähnliches. Aber dieses eigene Empfinden und was das tut und so, ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, irgendwie braucht es das glaube ich auch.
Moderator: Also ist der Text ein plastisches Feld oder wie ein Tor in dir, dass du hindurchschreibst und dahinter liegt die Landschaft?
Prof. Baumann: Finde ich eigentlich ein schönes Bild, in der Tat. Und eigentlich tun Texte das. Das ist auch so eine Grunderkenntnis, würde ich sagen von Literaturwissenschaft, Texte laden uns zu etwas ein. Was wir konkret damit machen, ist vielleicht für den Text auch gar nicht 100 % steuerbar. Wollen vielleicht Autorentexte gar nicht? Aber darüber könnte man auch diskutieren, mit Leuten, die Texte schreiben. Aber irgendwie gibt es da Einladungen und die kann man annehmen. Ich glaube, das macht in der Regel Sinn, dass man das tut. Man kann sie auch verweigern oder vielleicht hat man kein Interesse oder ja natürlich hat nicht die Zeit, das kann alles auch eine Rolle spielen. Aber eigentlich ist das schon so und ich glaube, das ist ein wichtiger Zugriff, jetzt auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive mal zu versuchen, das zu beschreiben: Was ist eigentlich diese Einladung, sozusagen die ein Text ausspricht? Und wenn man mal einen Leser oder einer Leserin unterstellt, der gerade Zeit sich zu beschäftigen, irgendwie Interesse hat und diese Einladung annimmt, was passiert dann eigentlich? Der Modellleser, wie man das mal genannt hat, zum Beispiel. Das wäre so ein Zugriff, wie man ihnen tatsächlich dann irgendwie gehen könnte.
Moderator: Okay, eine eine These, die du zum Schluss dann aufstellst, die ist also keine wiederholbare Objektivität, die für, sage ich mal, die jetzt unbedingt gelten muss, sondern in deinen Werken, die du da veröffentlichst, gehst du anders dann vor. Du beschaust den Text von all den Seiten, du piekst dir eine Stelle, Satzstelle raus, die vielleicht du wieder auf den Text selbst auch anwendest. Also pars pro toto. Ja, und dann kommt dein Gefühl für den dahinterliegenden Gehalt, der dadurch transportiert wird. Und das Ergebnis sind dann selber wiederum Beschreibungen?
Prof. Baumann: Ein Stück weit schon. Ja, ich glaube, dass das stimmt. Also es ist schon so, dass man natürlich auch, man kann natürlich schon auch aus der Literaturwissenschaft heraus Methoden formulieren und dann auch wirklich Konzepte und Begriffe haben, die man dann konstant sozusagen anwenden kann auf literarische Texte. Da gibt es dann schon eine Ebene, wo man Dinge ein Stück weit stärker doch, sagen wir ruhig mal, objektivieren kann als jetzt halt eine Hypothese die formuliere ich jetzt und jemand anderes könnte es anders sehen. Man kann da schon noch einen Schritt weitergehen. Aber du hast natürlich schon recht, dass man wirklich am Ende einen sozusagen empirischen Befund hat und der ist dann eindeutig und klar wiederholbar. Solche Ansprüche hätte man natürlich in vielen grundlegenden Methoden der Naturwissenschaft zum Beispiel ganz klar. Das ist für solche Gegenstände natürlich schwierig, denn wo sollte eigentlich die Ebene gewissermaßen liegen, wo man das wirklich so festmachen kann? Gar nicht so leicht. Texte werden ja für Leserinnen und Leser geschrieben und irgendwie realisieren sie sich ja dann in so einem Akt des Lesens gewissermaßen. Da hat man ja immer auch so einen Menschen dann irgendwie im Spiel, der das jetzt irgendwie konkret liest. Da kommt man, glaube ich, nicht so ganz raus. Dann gibt es noch die Herausforderung natürlich der großen historischen Distanz. Das habe ich eben auch schon gesagt. Auch die Fragen, die sich daraus stellen, kann man nicht immer hundertprozentig beantworten. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, mal wirklich das empirische Leseverhalten oder die Reaktion eines antiken Lesers zu checken. Das geht halt irgendwie nicht. Da müssen wir die Zeitreise machen, die vielzitierte oder jemanden irgendwie herholen oder so was. Ehrlich gesagt, wie schlau uns das wirklich machen würde, kann man auch mal fragen. Das ist eine spannende Frage, aber es geht halt nicht. Irgendwie müssen wir damit lesen, dass wir jetzt erst mal die Leser sind und da müssen wir schauen und man kann da durchaus Antworten geben, das schon. Und wie gesagt, das kann man schon auch, kann man systematisieren, kann man mit Kategorien arbeiten, Ähnlichem. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur so in der Subjektivität stehenbleibt, Das wäre auch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Aber es stimmt schon, es bleibt sozusagen etwas, wo wir nicht rauskommen, sozusagen, dass es doch auf der Ebene: Wir sitzen da jetzt eben als Leserin und Leser dieser Zeit, dieser Kultur und ähnlichem und haben diesen Text und dazwischen passiert was. Und irgendwie bleibt es vielleicht auch auf der Ebene doch ein Stück weit. Ich glaube, das kann man schon sagen, ja.
Moderator: Aber es hat ja auch was Schönes. Also wenn wir hatten zum Beispiel, Entschuldigung, wir hatten zum Beispiel das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung schon mal in der Reihe hier. Und da ging es ganz viel darum, das weg von Frontalunterricht, eine eigene Sensibilisierung für komplexe Situativi-, Situativität nenne ich es jetzt einfach mal so in diesem Abstraktum entstehen kann. Und das ist ja auch ein Skill, den man heutzutage oder grundsätzlich braucht, wenn man Welt erfahren möchte. Und ob die Welt an sich eine wissenschaftliche ist oder die immer Objektivität liefern kann, sei ja mal dahingestellt. Und so ist der der Weg so, oder dass die Sprachwissenschaft als Philologe. Wie soll ich das sagen? Sie Sie ist ja dann eine weiche Wissenschaft. Und es führt zur Sensibilität hin, mit verschiedenen Eindrücken interaktiv umzugehen. Ja, sage ich mal.
Prof. Baumann: Ja, das leuchtet mir völlig ein. Ich glaube, gerade der Begriff der Erfahrung ist ein schöner Begriff, mit dem man ganz gut auch für solche irgendwie auch herausfordernden Gegenstände arbeiten kann. Ich glaube, da kann man was draus machen. Sowohl in der wissenschaftlichen Perspektive ist ein wichtiger Begriff in der Tat, mit dem wir auch wissenschaftlich tatsächlich arbeiten, aber auch jetzt einfach so. Also so für sie alle irgendwie, jetzt auch auch hier oder weiß ich nicht woanders. Nicht unbedingt jetzt nur in einem wissenschaftlichen Sinne kann man damit, glaube ich, viel machen. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass solche Texte genau dazu einladen. Ja, das tun sie ja.
Moderator: Ich gucke jetzt gerade mal ins Publikum. Es gibt da eine Wortmeldung.
Gast: Ja, ich wollte mal fragen, woran denn unsere Textstelle hier eingebettet ist. Also wir sind ja in der Historiografie. Wird es jetzt einfach als ethnografische Stelle, dass man gerade nach also irgendwas über Kleinasien beschreiben möchte, ist das einfach Geografie?
Prof. Baumann: Genau das ist genau das ist der Punkt. Also das ist eine größere Textpartie, das sind gleich mehrere Bücher in der antiken Bucheinteilung. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man kurz erklären muss. Die antiken Texte waren in Bücher eingeteilt. Das muss nicht unbedingt unserer Logik von Büchern entsprechen. In der Regel ist es ein bisschen weniger, als wir in ein modernes Buch packen würden. Das kommt ursprünglich mal von diesen Papyrusrollen her. Was für eine Rolle geht, ist dann eben ein Buch. Und wenn Werk halt zu groß ist für eine, hat man eben mehrere, dann sind es mehrere Bücher. Es gibt so eine Einheit von so fünf Büchern am Anfang dieses Werkes, die offenbar genau so diese Funktion, so einer Art Einführung haben. Und Ethnographie war gerade so ein Stichwort, Geografie auch durchaus Mythographie, also auch die Frage, was wird eigentlich so erzählt über die Welt, ihre Entstehung, ihre Wesen usw. Das ist in der Tat der Punkt an der Stelle. Noch gar nicht das, was Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie sich je mit der antiken Historiografie beschäftigt haben, das dann da kommt, da so Herrscher und Kriege und solche Geschichten. Das kommt auch und ist dann auch für viele dieser 40 Bücher waren das insgesamt 40 Stück. Für die Geschichte der Menschheit braucht man auch Platz. Das kommt dann alles aber am Anfang ist es ein bisschen anders und das ist in der Tat der Kontext. Und interessant ist, dass es hier aus Sicht des Mittelmeerraums um die Ränder dessen geht, was man erstmal so kennt. Die werden abgeschritten, sozusagen. Und das ist, sagen wir so, der südliche Rand gewissermaßen. Das endet dann so eben mit dem südlichen Arabien und dann irgendwo in Afrika hört das dann mal so auf, würden wir sagen. Noch nicht ganz wirklich im Süden Afrikas, nach unserem heutigen Weltbild, aber so irgendwie, wie man eben Kenntnis hatte im damaligen Mittelmeerraum. Und das interessant ist, dass das irgendwie interessiert. Wie ist die Welt beschaffen sozusagen wenn man an die Ränder dessen geht, was man da kennt? Was wohnen da für Leute, was ist das so für eine Gesellschaft, was machen die, wie leben die, was gibt es da, die natürlichen Ressourcen? Und das zu schildern ist der größere Kontext. In der Tat. Ja, genau, da gehört es rein. Ja. Und das ist ein ziemliches Panorama. Interessant na, das das interessiert und das irgendwie jetzt aus der Perspektive eines Geschichtsschreibers, das aufgenommen wird. Das ist schon für sich, finde ich, einen Punkt, den man auch mal machen kann. Ja, genau.
Gast: (...)
Prof. Baumann: Es stammt aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Genau. Also wahrscheinlich ist das so, wenn wir versuchen, es genauer zu datieren, das wahrscheinlich so ums Jahr 30 vor Christus, dürften diese 40 Bücher dann fertig gewesen sein. Viele Jahre dran geschrieben. Das überrascht ja auch nicht. Aber das ist so ungefähr der der der zeitliche Punkt, auf dem man es zuspitzen kann. Und das besagt natürlich was. Da ist das Römische Reich dann natürlich schon da. Das ist auch zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich groß, noch nicht so Maximum, aber ist schon da irgendwie. Und dann wird es natürlich auch interessant, was sind das dann alles für verschiedene Gebiete, die da reinkommen? Was heißt das, dass es da so ist? Und hier ist es anders und so, da kann man sicherlich auch über den Kontext nachdenken, warum man genau in so einer Zeit eigentlich so eine Art von Geschichtsschreibung macht.
Gast: Aber wir leben heute auch in dem Luxus. Also es ist auch ein Luxus, hier zu sitzen und wir leben jetzt in dem Luxus, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Text zu lesen. Zu der Zeit und viele hunderte Jahre später ist es ja nur wenigen Menschen überhaupt möglich gewesen, genau das zu lesen und überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen. Und ich denke jetzt, wenn ich das jetzt in die Geschichts- und Handelsentwicklung einbeziehen würde, wird es vielleicht ein, zwei Menschen gegeben haben. Das ist, grob geschätzt, die die Kostbarkeit dieses Duftes erkannt haben und dann daraus entwickelt haben den Gedanken, dass man so etwas ja besorgen könnte und sich daraus Handelswege entwickelt haben.
Prof. Baumann: In der Tat also dazu kann man vielleicht zwei Punkte sagen. Handelswege sind zu dieser Zeit schon ziemlich etabliert. Also das ist sozusagen was, was man nicht neu schaffen muss. So Weihrauchexport, den gibt es schon ziemlich lange. Jetzt aus der Perspektive des ersten Jahrhunderts vor Christus gesprochen, das ist irgendwie schon da. Aber es ist schon richtig, die Frage, wer konnte jetzt eigentlich so einen Text lesen ist ganz interessant? Wir können fragen: Wer hat Kenntnis vom südlichen Arabien? Ich wage zu behaupten, kaum jemand aus der Leserschaft dieses Textes. Selbst wenn es Handelsrouten gibt, aber da werden nicht viele gewesen sein natürlich. Die spannende Frage ist natürlich auch: Wer konnte diesen Text eigentlich damals lesen? Und das ist notorisch schwer zu beantworten. Nein, ich kann keine Prozentzahl nennen, das geht gar nicht. So viele Informationen haben wir nicht. Aber eines ist interessant: Wir wissen, dass gerade das Medium Historiografie in dieser Zeit im erste Jahrhundert vor Christus eines ist, das, soweit überhaupt eben Leute lesen und schreiben konnten, sich durchaus an ein breiteres Publikum richtete. Und die Frage kann man auch mal stellen Ist vielleicht dieses so, dass das so sinnlich hier ist und gar nicht der Text anfängt mit: Und dann kam da der und der Herrscher und dann war das der Krieg und so was dann. Man kriegt so diese Weltbeschreibung irgendwie und auch so diese Einladung, sich das vorzustellen und hier sogar diese Gerüche und Ähnliches. Ist das vielleicht genau Teil so einer Art von Schreiben, die sich durchaus auch an ein größeres Publikum richtet? Also nicht nur an eine politische Elite oder an Leute, die selber vielleicht in Machtpositionen kommen. Es gibt Form antiker Geschichtsschreibung, die funktionieren offenbar so, da geht es darum, so praktisches Handwerkszeug zu vermitteln, Beispiele zu geben usw. für Leute, die selber in Macht- und Entscheidungspositionen kommen. Das scheint ein bisschen eine andere Art von Geschichtsschreibung zu sein, eine, die sich wirklich als Lesetext versteht. Und jeder, der lesen kann, kann dann auch die Erfahrung sozusagen dieser Seereise im Medium des Lesens immerhin machen. Da kann man auch mal nachdenken: Ist Literatur die Brücke sozusagen? Die, so weit das erst einmal weg ist und so wenig man da vielleicht selber hingehen kann, jetzt so im erste Jahrhundert vor Christus, als Grieche, Römer oder wie auch immer. Aber Reisen im Text und in der Vorstellung kann man ja dann schon. Wenn man lesen kann, geht einem diese Welt sozusagen auf. Damit scheint dieser Text auch zu arbeiten und das ist interessant, dass das auch schon in der Antike ein Mittel ist, sozusagen, das man nutzt.
Gast: Wahrscheinlich nicht nur das. Also bei mir war es jedenfalls so, als ich das gelesen habe, hatte ich gleichzeitig und das will der Text ja offensichtlich auch den Wunsch verspürt, das in echt riechen zu wollen.
Prof. Baumann: Das will der Text sicher. Da haben Sie Recht. Ja, das glaube ich auch. Ja.
Gast: Ähm, wo wir jetzt schon auch von dieser lebhaften Reise sehr lebhafte Bilder bekommen, ist ja vielleicht auch eine berechtigte Frage. Wissen wir genug über Diodor, um sagen zu können, ob der diese Reise überhaupt selber gemacht hat?
Prof. Baumann: Ja das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also diese vermutlich nicht. Ich glaube nicht, dass der im südlichen Arabien war. Aber irgendwie gereist ist er schon. Das ist in der Forschung lange auch eine umstrittene Frage gewesen. Es ist ja auch Job sozusagen der Wissenschaft, solche Texte kritisch zu lesen. Und dann ist so ein Autor und der sagt das und das habe ich gesehen, weil er sagt das eben auch. Ich habe Reisen gemacht und habe mir Dinge angeschaut und Ähnliches. Und da kann man auch mal gegenfragen. Aber alles in allem ist das ziemlich plausibel. Also zu diesem Zeitraum sind Reisewege gut etabliert. Es gibt Handelsbeziehungen, auch sehr weiträumiger Natur, aber auch konkret, um als Mensch so irgendwo zu reisen. Übrigens durchaus auch schon in einer frühen Form des Tourismus. Da gibt es eine gewisse Infrastruktur. Man kann mit dem Schiff eigentlich ziemlich effektiv irgendwo hinfahren, braucht dafür auch gar nicht so viel Zeit. Das ist ganz interessant. Okay, klar, nicht so schnell wie im Flugzeug heutzutage, geschenkt. Aber letzten Endes geht das durchaus. Also das Mittelmeer zu überqueren, um dann nach Ägypten zu kommen, da vielleicht noch den Nil rauf zu schippern und so was. Das kann man schon irgendwie machen. Also das man zumindest mal so in Ägypten war und sich da Sachen angeschaut hat und da ist man ja schon geografisch in die Nähe, sozusagen dieser Zone, um die es jetzt hier geht. Das können wir auch für diesen lebensweltlichen und biografischen Autor durchaus unterstellen. Ja. Doch, doch.
Moderator: Gibt es weitere Fragen? Ja.
Gast: Dann würde ich nochmal auf diese, auf diese Textquelle zurückkommen. Sie sagten ja, also die meisten Quellen sind nicht mehr im Original vorhanden, sondern als Abschriften. Das wäre hier für mich schon die Frage: Wie authentisch sind denn die Abschriften? Oder wie viel Fantasie hat der Abschreiber selber eingebracht?
Prof. Baumann: Klar, das hängt davon ab. Also da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Es gibt natürlich das Phänomen, dass Texte sozusagen leben. Man schreibt sie weiter, man verändert sie, man knüpft an Texte an, man setzt sie fort usw. Aber alles in allem ist das etwas, was schon funktioniert, also in dem Sinne, dass ein Text im Wesentlichen tatsächlich als der Text weitergegeben wird, im Kleinen natürlich mit einer ziemlich bunten Fülle von einzelnen Abweichungen, Ähnlichem. Das schon. Aber es gibt frühzeitig ein Interesse daran, Texte zu bewahren und weiterzugeben, und zwar eben auch in ihrer Form, die sie haben. Das ist ziemlich interessant, dass das schon in der Antike passiert. Und das hängt auch damit zusammen, dass es ja schon in der Antike auch so so Leute gab wie unsereinen, also Philologen, die auch Textwissenschaft betrieben haben und deren Aufgabe irgendwie auch genau das war. Zu schauen was ist die wahrscheinlich Originalversion eines Textes und die dann auch wirklich weiterzugeben, zu beschreiben natürlich, zu kommentieren und Ähnliches. Also es gibt im Wesentlichen schon eine Überlieferung, die so funktioniert, dass die Idee dabei ist, Texte wirklich weiterzugeben. Und dann, wie gesagt, sich mit diesen Details zu beschäftigen, was kommt da an Abweichungen rein, was gibt es auch an schlichten Fehlern, die passieren natürlich auch. Man schreibt einen Text ab und dann ist irgendwas falsch oder Kürzungen usw. und so fort. Das ist auch eine Aufgabe sozusagen der Philologie. Das ist dann die gerne so genannte Editionsphilologie, das zu machen. Und da kommt man aber schon zu Texten, von denen wir sagen können, das sind im Wesentlichen schon die, dürfen wir von ausgehen, wie sie auch in Antike da waren. Im Einzelfall kann es mal schwierig sein, aber alles in allem klappt das eigentlich soweit ganz gut. Das mal so als, auch eine Frage über die man immer sehr viel sagen könnte, aber mal so als als kurze Antwort. Und deswegen ist das schon etwas, was wir erst mal so als Leseeindruck auch nehmen können, dass das schon irgendwie das ist was, vielleicht nicht buchstäblich ist in jedem Wortlaut, das können wir jedenfalls nicht beweisen aber grundsätzlich ist das schon der Text. Die Zuversicht dürfen wir haben, der irgendwie auch im erste Jahrhundert vor Christus da war, das schon. Wenn man Griechisch kann, machts das einfacher natürlich sich dann noch wirklich an diesen antiken Zustand weiter irgendwie anzunähern, das ist klar. Ja. Genau.
Moderator: Mario, möchtest du noch Werbung machen für die Studenten, die vielleicht Interessent, Interesse haben an Philologie? Was magst du denn in deinem Symposium?
Prof. Baumann: Also vielleicht ist Symposium insofern das richtige Stichwort. Also wenn eine Studentin jetzt tatsächlich da ist, forschend ist. Großartig, genau. Wird tatsächlich mit den Sinn auch bei uns arbeiten, sozusagen in der Lehre. Ich mache das jedenfalls sehr gerne. Die Einladung auszusprechen, sich diese Antike auch wirklich in ihrer sinnlichen und konkreten Form anzunähern, natürlich mit dem Anspruch, dass es wissenschaftlich passiert. Was eigentlich schön ist, diese beiden Seiten zusammenzubringen, sozusagen. Sich diese, dieser wissenschaftlichen Perspektive zu bedienen, aber zugleich auch die Frage zu stellen, was entsteht da wirklich als etwas, das man sinnlich wahrnehmen kann? Und was im Symposium Mainz, ist eben ein Projekt, das wir hatten, wo tatsächlich eine Studierendengruppe, ein sogenanntes Symposion, das ist ein wichtiger sozialer Ort sozusagen gewesen in der ganzen griechisch-römischen Antike. Man sitzt zusammen, und liegt zusammen, genauer gesagt, isst und trinkt und Ähnliches. Und da geht es hoch her, natürlich, wie man sich vorstellen kann. So was wirklich mal zu rekonstruieren und auch, ja, wir haben es auch dann umgesetzt sozusagen und haben das zusammen gewissermaßen gefeiert. Das heißt ja, ja, auf jeden Fall und das ist das ist schön mal zu fragen: Was, was wissen wir, was wissen wir nicht? Warum wissen wir Dinge und warum wissen wir Dinge nicht? Was machen wir, wenn wir was nicht wissen? Was passiert dann eigentlich? Was lernen wir eigentlich, wenn man sich, wenn man das so macht, sich das wirklich noch mal ganz konkret auch irgendwie vor Augen zu stellen, vor die Nase zu führen. Gegessen haben wir auch usw. natürlich. Das das ist schön und das schätze ich eben auch an so einem Forschungsthema das funktioniert sozusagen wissenschaftlich, das ist ein Punkt aber es ist auch auch eine Einladung an die Studierenden oder an Interessenten wie auch immer diese Antike irgendwie auch noch konkret auf diese sinnliche Weise zu nehmen. Ich glaube, das ist toll. Und wir haben halt so viel. Es gibt diese Texte sehr viel mehr als man denkt und natürlich auch die materiellen Überreste, selbstverständlich. Und das ist im Grunde selber wie eine große Einladung, das mal so zu nehmen und damit auch was zu machen.
Moderator: Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Mario. Vielen Dank! Das ist super spannend. Leider müssen wir zeitlich jetzt wirklich Schluss machen. Deswegen bedanke ich mich jetzt noch einmal an alle, die auch mit hier gewesen sind und Teil hatten. Wir hatten ja in der ersten Veranstaltung den Herrn Professor Manfred Curbach da, in der zweiten Veranstaltung die Frau Professorin Jana Markert und die Doktorin Simone Reutemann. In der dritten Veranstaltung dann den Herrn Professor Andreas Hartmann. Danke dafür, dass Sie da waren! Und heute dürfen wir jetzt noch mal Applaus geben für Professor Mario Baumann!
Prof. Baumann: Danke schön. Danke Ihnen. Ja. Schön, dass Sie da waren. Freut mich.
Grundwasser und Wald - Prof. Dr. Andreas Hartmann
Welche Auswirkungen könnte die Klimakrise auf unser Grundwasser haben? Prof. Dr. Andreas Hartmann, Professor für Grundwassersysteme und Direktor des Instituts für Grundwassermanagement der TU Dresden erforschte weltweit, welchen Weg Regenwasser in unterschiedlichen Böden und Gesteinsunterlagen nimmt. Die Erkenntnisse aus seiner Forschung haben dazu beigetragen, Wasserressourcen besser abschätzen und vorhersagen zu können.
Intro: Hallo und Herzlich Willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere". Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator Tobias Dombrowski: Schön, dass ihr alle da seid! Und ich möchte auch noch mal an diesem Punkt anmerken: Bringt eure Fragen aktiv hervor, auch spontan gegenüber einer Wortmeldung. Wir kommen dann und gliedern sie ein. Es soll ja eine Dialogveranstaltung oder ist eine Dialogveranstaltung. Das funktioniert auch sehr gut. Und daher ich denke, das ist okay Herr Professor Hartmann, wenn wir die Fragen aktiv mit einbeziehen.
Professor Dr. Andreas Hartmann: Ja, sehr gerne.
Moderator: Guten Tag erstmal! Hallo! Wir sprechen heute über Trinkwasserqualität, unter anderem zum Beispiel im Großraum Dresden, über die Rolle der Heide als bewaldetes Gebiet und natürlich auch über die Klimakrise und Veränderungen. Oder wollen wir eher sagen Klimaveränderungen, die einfach auftreten? Dazu heiße ich Sie auch herzlich willkommen.
Prof. Hartmann: Hallo, dankeschön, auch danke für die Einladung.
Moderator: Sehr gerne! Andreas, für den Vortrag siezen wir uns für. Für das Format-
Prof. Hartmann: Wem ein Du rausrutscht ist kein Problem.
Moderator: Für das Format. Genau. Und ich würde jetzt einfach einfach mal starten mit einer kleinen Einführung. Groß geworden sind Sie ja in Hof und dann hat Sie etwas nach Freiberg verschlagen Freiburg, entschuldigung Freiburg, im Süden Deutschlands. Dort haben Sie studiert und waren eine lange Zeit dann im Nachgang in Bristol auch und im kanadischen Montreal, haben dort ihren Postdoc gemacht. Anschließend sind Sie aber wieder zurückgekommen nach Freiburg. Und zwar haben Sie dort eine Assistentenstelle angenommen, für, ähm, für einen Professor in die Hand zu spielen und zuzuspielen. Ja, zu welchem Thema war das denn?
Prof. Hartmann: Das ging eigentlich seit meiner Doktorarbeit um die Erforschung und auch die Vorhersage von Wasserressourcen im Karstgebieten. Soll ich dazu gleich mal sagen, was Karst ist?
Moderator: Sehr gerne, Ihr, Ihr Promotionsthema, der selbiges zum Thema?
Prof. Hartmann: Ja genau also im Grunde mit meiner Promotion habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Es lag auch ein bisschen daran, dass dieses Thema gerade - ein bisschen lauter, ja?
Moderator: Ein wenig eindrehen.
Prof. Hartmann: Drehen Sie kurz, näher ran oder weg? Ja, alles klar, super gut. Karst ist im Grunde eine Landschaftsform, die entsteht, wenn Kalkstein verwittert. Und wir kennen das alle. Also viele von ihnen haben vielleicht schon in Kroatien Urlaub gemacht oder irgendwo im Mittelmeer und haben riesige Quellen gesehen, also Flüsse, förmliche Flüsse, die aus dem Untergrund hinauskommen. Oder Höhlen, die die Hunderte von Metern oder Kilometer lang sind. Und das sind alles Karsthöhlen gewesen, weil dort sich der Stein aufgelöst hat aufgrund von Verwitterungsprozessen. Und das ist ein sehr interessantes Thema zu erforschen, weil Karstgrundwasser ungefähr 1/4 der Weltbevölkerung mit Trinkwasser versorgt. Genau.
Moderator: Ist aber jetzt an ihrer jetzigen Stelle, die sie ja innehaben, als Leiter seit dem Wintersemester 2021/22 am Institut für Grundwasserwirtschaft an der Fakultät Umweltwissenschaften. Ist das noch ein Gebiet der Forschung oder ist das?
Prof. Hartmann: Es ist immer noch ein Gebiet der Forschung. Aber jetzt natürlich als Institut stehen wir viel breiter da, insbesondere was die Wasserwirtschaft angeht. Das heißt, ich mache natürlich weiter meine Karstforschung, auch ein paar Kollegen von mir. Aber wir haben eine große Expertise, auch schon von meinem Vorgänger, was die Wasserwirtschaft angeht. Das heißt, die Erforschung und Förderung von Grundwasser zur Trinkwasserversorgung, zur Versorgung von der Wirtschaft, zur Landwirtschaft und auch die Tagebauproblematik oder generell den Tagebau, ist ja nicht immer eine Problematik. Genau.
Moderator: Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was für Wasservorkommen gibt es denn überhaupt, wenn wir die einteilen in Grundwasser? Können Sie uns dazu was sagen? Gibt es da verschiedene Grundwässer?
Prof. Hartmann: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Grundwässer. Also erst mal so ganz grob. Vielleicht darf ich meine Einführung jetzt machen? Das würde jetzt passen.
Moderator: Bitte, bitte.
Prof. Hartmann: Also, weil wir jetzt über Wasser direkt reden. Erst mal wollte ich in das Publikum fragen. Einfach mal so frei heraus: Was ist der größte menschengemachte Wasserspeicher, den Sie kennen? Fällt einem was ein? Ja. Große Talsperre. Ja. Also ein, ein großer den, der oft genannt wird, ist der Hoover Dam in den USA. Das ist einer von den Größten. Ich glaube, in Brasilien gibt es auch dieses, ein sehr großes, den Foz do Iguaçu. Das ist auch ein sehr großer Staudamm. Auf jeden Fall ist es meistens ein Staudamm, das dann kommt. Und die zweite Frage, die ich an sie habe: Was ist der größte Trinkwasserspeicher der Welt, den Sie kennen? Oder wo ist der? Besser gesagt, wo ist der? Direkt unter uns. Das Grundwasser ist der größte Trinkwasserspeicher, den die Welt hat. Und der ist von der Natur aus, der ist überall. Und das geht's wieder zurück zur Frage, was für Wasser wir kennen. Grundwasser ist natürlich eine Form von Wasser. Und dann gibt es die Oberflächengewässer zum Beispiel, die dann auch zur Nutzung von Staudämmen zum Einsatz kommen. Und natürlich der Niederschlag. Das ist das Allererste: Der Niederschlag, kommt herunter, erreicht den Boden, kann infiltrieren, muss nicht infiltrieren. Man sieht es hier, wie es geregnet hat als hier, ein bisschen so, dass das Gestein weggetan, also den Kies. Das ist so eine Art kleine Erosion, die stattgefunden hat. Es gibt Oberflächenabfluss, der kann bei Hochwässern sehr wichtig werden und auch sehr gefährlich werden. Das Wasser kann infiltrieren, kann von dort aus immer noch in die Flüsse fließen, ohne dass es direkt zum Grundwasser kommt. Aber zum Glück kommt ein großer Anteil des Wassers unten beim Grundwasserspiegel an. Das wäre die sogenannte Grundwassererneuerung und ist dort potenziell verfügbar zur Wasserversorgung. Ich kann weitererzählen, wenn Sie wollen.
Moderator: Ja, bitte. Ansonsten hätte ich jetzt die Frage gehabt: Ja, was, was für Aspekte oder was für Aufgaben hat dieses Wasser?
Prof. Hartmann: Also Grundwasser ist sehr wichtig. Weltweit hängen ungefähr 50 % der Weltbevölkerung am Trinkwasser aus Grundwasserressourcen. Deutschlandweit sind es sogar 70 %, Dresden ist ein bisschen ein Spezialfall. Wir haben zwar auch sehr viel Grundwasser hier, sogar mehr als die Hälfte. Aber nicht ganz diese 70 % von Deutschland, weil wir Wasser aus den Talsperren im Erzgebirge bekommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Dresdner Wasserversorgung. Und der andere Teil der Wasserversorgung ist zwar per Definition Grundwasser aber ist in Wirklichkeit größtenteils Wasser, das von der Elbe ins Grundwasser infiltriert und dann recht schnell wieder herausgenommen wird. Es hat den Vorteil durch die Infiltration und durch diese Verweilzeit im Untergrund wird das Wasser gefiltert. Es erreicht eine Qualität, die uns dann nützlich ist für die Wasserversorgung. Aber es ist Wasser eigentlich, das vom Fluss abhängt. Das heißt die Elbe, das Elbewasser bestimmt ob wir dann genug Wasser haben, zum filtrieren oder nicht.
Moderator: Okay.
Gast: Wie ist das? Ist das Grundwasser im Untergrund immer in ähnlichen Schichten gespeichert oder ist es immer mal irgendwie im feuchten Sand oder ist es mal in einem-? Also wie, ist das immer ähnlich oder ist das sehr unterschiedlich, wo das Grundwasser gespeichert ist?
Prof. Hartmann: Also wie nützlich Grundwasser zur Wasserversorgung ist, hängt in der Tat davon ab, wie der Untergrund aufgebaut ist. Der beste Grundwasserversorger vom Untergrund her ist schotterartiges Material. Deswegen sind Flussauen sehr beliebt für die Grundwasserversorgung, weil der Fluss halt dieses ganze Schottermaterial anbringt. Und es hat sehr gute Speicherfähigkeit und man kann vor allem auch sehr viel pumpen. Also es muss ja auch zufließen zum Brunnen. Sie kennen ja, also das wird bei Brunnen gefördert. Wenn wir jetzt zerklüftetes Gestein haben, wie im Erzgebirge zum Beispiel, das ist kristallines Gestein. Da kann sich das Wasser nur in Klüften bewegen, die halt nicht sehr gleichmäßig verteilt sind und vor allem auch viel weniger Hohlräume haben als jetzt im Lockergestein im Grundwasser. Leider. Und deswegen ist eben Grundwasser im Erzgebirge zum Beispiel nicht so wichtig, sondern mehr das Oberflächenwasser. Und das wird gesammelt in Talsperren und wird dann zum Teil auch nach Dresden zur Wasserversorgung geleitet.
Moderator: Wie ist das hier in Dresden? Ein selbiges Thema finden wir hier, also wir haben hier Sandstein hier oder wie?
Prof. Hartmann: Wir haben Sandstein im Untergrund. Aber das Grundwasser kommt aus den Lockergestein, also aus dem Schotter der, der Elbe. Es fließt teilweise von den Seiten zu, zum Beispiel auch von der Dresdner Heide. Aber dieser Grundwasserzufluss ist eigentlich relativ gering im Vergleich zu dem Grundwasser, das durch die Elbe auch in diesen Lockergestein hineinfließt. Also Sie können sich das so vorstellen, dass die Elbe einfach, wenn das Wasser hoch ist, drückt das Elbwasser in den Untergrund und füllt unseren Grundwasserstand auf.
Moderatot: Wie tief liegt denn der zurzeit?
Prof. Hartmann: Das ist immer relativ einfach zu sagen. Sie müssen nur an den Fluss gehen und der Fluss fließt, weil da Grundwasser reinkommt. Das heißt, der Flusswasserstand ist ungefähr der Grundwasserstand am Ufer. Und dann können Sie sich vorstellen, dass es meistens so ein bisschen hochgeht zum, von der Elbe weg. Ja, okay, Ja.
Moderator: Jetzt leiten Sie ein ganzes Institut für Grundwasserforschung. Wie hat man das denn früher betrieben? Ich kann mich noch erinnern, mein Opa hatte öfters mal so Wünschelrutengänger bestellt, um Wasser zu finden. Kann man das verlachen? Kann man das mit einbeziehen? Können Sie dazu was sagen?
Prof. Hartmann: Also ich. Es ist keine Praxis in der Wissenschaft, aber der mal der Vorgänger meines Professors in Freiburg war ein Schweizer, der war auch Professor dort, ist schon in Rente gegangen. Und der war damals, noch bevor er in die Wissenschaft gegangen ist, staatlich ausgebildeter Wünschelrutengänger in der Schweiz. Da war das damals noch ein Beruf. Er ist dann in die Wissenschaft gegangen, da ging es dann nicht mehr um Wünschelrutengänge. Da ging es wirklich um messbare Dinge. Das heißt also, geschichtlich gesehen war das früher mal ein bisschen verschwommen, aber heutzutage ist es ganz klar getrennt. Also es gibt natürlich, es ist immer sehr wichtig, wenn man Brunnen baut, das Grundwasser zu finden. Und es gibt wissenschaftliche Methoden und nicht wissenschaftliche Methoden, das zu machen. Ich würde das Wünschelrutengehen jetzt ganz klar zu den nicht wissenschaftlichen Methoden rechnen.
Moderator: Kommt noch eine Frage. Ja.
Prof. Hartmann: Ja, gern.
Gast: Wünschelrutengänger zum Beispiel. Wenn Leute schlecht schlafen, dann kommt ein Wünschelrutengänger. Ihr Bett steht schlecht. Stellen Sie es mal dahin und Sie können besser schlafen. Das ist ja nicht nur Hokuspokus. Da ist schon auch was Wahres dran an der Sache?
Prof. Hartmann: Ja, ja, also habe ich auch geredet-
Moderator: Ja also ich vertrete das auch, ganz wie Sie das sagen, also unter den Aspekten der Wissenschaftlichkeit, können wir das nicht mit einbeziehen. Noch nicht.
Prof. Hartmann: Ja, es ist schwer. Also es gibt keinen messbaren Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Grundwasser. Weil Grundwasser ist überall. Also Sie haben das, deswegen ist es schwer, halt zwischen hier und dort oder jetzt, wenn mein Bett dort stehen würde, es würde keinen Unterschied machen. Das Wasser ist so oder so da. Deswegen. Also ich würde es mal so sagen: Wenn man durch Wünschelrutengängen einen Brunnen findet und da ist wirklich viel Wasser drin, dann ist es dem Brunnennutzer egal, ob das wissenschaftlich ist oder nicht. Wenn ich jetzt besser schlafen kann, weil ein Wünschelrutengänger mir sagt, ich sollte mein Bett so hinstellen und ich kann danach besser schlafen, dann ist mir der wissenschaftliche Zusammenhang auch ziemlich schnuppe, würde ich sagen. Ja. Ja genau. Also nur so halt wissenschaftlich kann man das nicht missen. Ja.
Moderator: Was sind denn Faktoren, die ihr messt? Was sind Kennziffern, wenn es um die wirkliche Forschung geht?
Prof. Hartmann: Die wichtigste Messgröße für die Grundwasserforschung ist natürlich der Grundwasserstand. Das heißt eigentlich über ganze Land tagsüber, über ganz Deutschland verteilt sind Grundwassermessstellen. Das sind wenn Sie ein bisschen durch die Landschaft schauen, finden Sie manchmal so Betonklötze, die im Boden eingelassen sind und schaut ein Rohr raus und Deckel drauf. Das ist eine Grundwassermessstelle. Und da hängt meistens- nicht immer, meistens ein Sensor drin und der sendet Daten direkt oder indirekt, wenn man hinfährt und die ausliest, dann an die Landesämter und an die Forschungsstellen.
Moderator: Und wird darüber auch die Qualität gemessen oder im Nachgang?
Prof. Hartmann: Die Qualität des Grundwassers, wird meistens bestimmt, indem man Wasserproben nimmt und diese dann im Labor untersucht und schaut, ob die die nötigen Standards haben. Wenn wir jetzt die Trinkwasserversorgung anschauen, dann wird es natürlich in den Fassungen gemacht. Das Rohwasser wird gefördert durch die Förderbrunnen hier im Elbtal oder es wird gefördert durch die Talsperren und wird meistens dann noch ein bisschen aufbereitet, um dann auch sicher zu stellen, dass die Trinkwasserqualität so gut ist, wie wir sie schon kennen. Und die ist sehr gut. Also trinken sie Leitungswasser, das ist das billigste und am am strengsten überwachte Wasser in Deutschland. Ich trinke auch Leitungswasser.
Moderator: Ja, ich auch sehr gerne. Was finden wir da für Stoffe? Sind da auch Mineralien drin? Dinge, die uns gut tun?
Prof. Hartmann: Ja. Also dadurch, dass das Trinkwasser in Deutschland größtenteils aus dem Grundwasser kommt und das Grundwasser per Definition mit dem Untergrund in Kontakt ist, findet man dort die Stoffe, die gelösten Stoffe, die aus dem jeweiligen Gestein kommen. Und wenn man jetzt-. Wenn ich jetzt anfange mit dem Kalkstein zum Beispiel, dann findet man natürlich sehr viel Kalk im Wasser, was man sich freut, weil es gut für die Zähne ist. Was man sich nicht so drüber freut, ist nicht so gut für die Geräte. Also wenn ich jetzt eine tolle Kaffeemaschine betreiben will oder meine, meine Waschmaschine, Spülmaschine, dann finde ich halt diese Kalkränder. Wie ich nach Dresden gezogen bin von Freiburg. In Freiburg hatten wir ein bisschen Kalk im Wasser weil das aus dem Schotter vom Rhein kam, habe ich gedacht: Ja, jetzt habe ich eigentlich kein Problem mehr mit dem Kalk. Aber wir haben es halt trotzdem, weil wir halt diese Mischwässer haben und infiltriertes Flusswasser haben, wo halt zum Beispiel auch Kalk, aber auch andere Mineralien mit drin sind. Das heißt, Sie kennen es wahrscheinlich auch. Sie müssen manchmal auch mit der Natronlauge rangehen, wenn Sie Ihre Geräte putzen wollen. Ja.
Moderator: Jetzt, wenn das so ist, dass unser Grundwasser in Dresden. Ich bin ja übrigens auch aus dem Raum Bayreuth/Hof eher angesiedelt. Also ich wohne aber jetzt lang genug hier und habe mich, fühle mich gut eingegliedert. Kleiner Randfaktor, um zu sagen, wenn wir das hier in Dresden jetzt also das Wasser beziehen und das kommt aus Flüssen. Ja, können Sie uns sagen, können Sie ein bisschen was über die Eigensinnigkeit der Flüsse sagen? Ja.
Prof. Hartmann: Also es gibt einen Grund, warum Deutschland größtenteils das Trinkwasser aus dem Grundwasser rausnimmt, weil das Grundwasser halt besonders sauber ist und vor allem sehr langsam auf Umwelteinflüsse reagiert. Das heißt, wenn es jetzt mal eine Trockenheit gibt, dann sinkt ein bisschen die Grundwasserstände, aber der Speicher ist nicht sofort leer. Bei Flüssen ist es anders. Also Flüsse die reagieren sehr schnell auf äußerliche Faktoren. Das heißt, bestes Beispiel sind die Hochwässer. Da kann es innerhalb von Stunden passieren, dass ein kleiner Fluss zu sehr gefährlich wird. Stichwort Ahrtal und auch die Trockenwetterabflüsse von Flüssen. Die können auch sehr schnell kommen. Also wenn es jetzt sehr trocken ist, jetzt gerade so, ich glaube auch die Elbe ist eher ein bisschen auf der trockenen Seite, aber noch nicht auf der extrem trockenen Seite. Aber am Rhein wird jetzt die Schifffahrt schon runtergefahren und das kann jedes Jahr wieder passieren. Und das Grundwasser ist als Wasserversorger dadurch etwas langsamer. Natürlich braucht es auch etwas länger, um sich dann wieder zu erholen von Trockenzeiten. Aber es ist für die Wasserversorgung deutlich besser, wenn man halt nicht so schnelle Reaktionen hat. Und man hat auch die Filterwirkung natürlich im Oberflächengewässer nicht, weil das ja nicht gefiltert wird durch den Untergrund.
Moderator: Können wir das dann überhaupt vorhersehen, wie das kommen wird mit Wasserständen?
Prof. Hartmann: Ja, also man, man man kann ja schon. Also die Klimamodelle, die waren ja bis jetzt die laufen ja. Die meisten laufen seit den 90er-Jahren und gehen dann so bis 2099/2100. Es gibt jetzt schon einen sehr langen Überlappungsraum zwischen den Klimaszenarien und den Messdaten. Und man kann sogar schon ziemlich genau sagen, auf welchem, auf welchem Szenario wir sind. Und leider halt nicht auf dem Einfachsten, sondern eher auf dem, was so ein bisschen so in Richtung schlimmere Auswirkungen liegt. Und was wir jetzt merken in den letzten Jahren ist einerseits natürlich die Zunahme von Hochwässern, die leider nicht so gut sind für die Trinkwasserversorgung. In Dresden würde sie sogar die Trinkwasserversorgung stark stören, weil die ganzen Trinkwasserflusswerke, die sind ja in den Elbauen und die werden natürlich gleich am Anfang mit überschwemmt und 2000 bzw. 2002 beim Hochwasser sind die auch alle ausgefallen. Da waren wir quasi zum Glück noch an den Erzgebirgsstaudämmen dran. Die haben uns dann quasi oder Dresden weiter mit Wasser versorgt. Und natürlich auch die Trockenheiten, weil die Grundwassererneuerung, die hängt stark davon ab, was die Koniferen an Wasser sich vorher schnappen. Denn wenn das Wasser zum Grundwasser runterwandert, kommt es erst mal an, dann an den Pflanzen vorbei. Ein Kollege von mir in den USA, der hat immer gesagt: The plants turn on the tap or turn off the tab. Weil die Pflanzen bestimmen, wie viel übrig bleibt für die Grundwassererneuerung. Und die Grundwassererneuerung bestimmt auch, wie viel dann in den Trockenzeiten dem Fluss noch zufließt. Weil der Fluss fließt in Trockenzeiten nur, weil das Grundwasser in den Fluss hineinfließt. Und wenn das Grundwasser nicht mehr stark erneuert wird, dann sinken die Grundwasserstände und dadurch fließt dem Fluss weniger zu und die Flusswasserstände sinken und können auch trockenfallen. Was wir in Sachsen jetzt auch schon hatten, teilweise zu den kleinen Zuflüssen. Ich glaube, für die Spree war das, habe ich gehört, da wurde dann auch schon, sind kleine Gerinne trockengefallen, weil die Grundwasserstände unterhalb des Flusses gefallen sind.
Moderator: Mich interessiert an dieser Stelle mal mit so Katastrophenszenarien, wie wir sie mit Hochwasser durchlebt haben. Wie wurde denn dann wieder das sichergestellt, dass Trinkwasser wieder Trinkwasser ist, oder?
Prof. Hartmann: Also Dresden ist mit dem Trinkwasser durchgekommen ganz gut, weil wir halt das Wasserwerk in Coschütz hatten, das das Wasser aus dem Erzgebirge bekommt. Also strategisch war das. Ich war leider damals bei der Planung nicht dabei. Das gibt es ja schon länger. Aber es war strategisch sehr gut, Wasser aus zwei verschiedenen Quellen zu haben. Weil die das Uferfiltrat und die künstliche Anreicherung von Grundwasser durch Elbwasser natürlich am stärksten gefährdet ist durch Hochwasser durch die Elbe. Und die, die Staudämme im Erzgebirge und Trinkwasserversorgung war vollkommen unabhängig dadurch. Und die Wasserversorgung der Stadt Dresden will das jetzt auch weiter ausbauen. Also einerseits wollen sie die Flusswasserwerke leistungsfähiger machen, aber auch mehr Wasser aus dem Erzgebirge holen. Wo man natürlich auch ein bisschen so im Hinterkopf behalten muss: Wie viel Wasser ist insgesamt eigentlich da, gerade mit dem Elbwasser? Die Elbe wird tendenziell wahrscheinlich doch ein bisschen weniger Wasser haben in der Zukunft, weil nämlich die Verdunstung zunehmen wird und die Pflanzen sich einfach in größeren Faktor des Niederschlags nehmen werden. Und dadurch können wir wahrscheinlich außerhalb dieser Hochwässer, die auch häufiger werden werden, mit geringerem Niedrigwasser, also mit sinkendem Abfluss in der Elbe rechnen. Also nicht trockenfallen, also ich möchte keine Panik verbreiten, uns wird niemals das Trinkwasser ausgehen. Aber es wird halt. Man muss sich umstellen, weil natürlich man von einer gewissen Wasserverfügbarkeit ausgegangen ist in der Vergangenheit und die Wasserversorgung darauf ausgelegt worden sind. Und das muss alles ein bisschen neu berechnet werden. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen kosten, weil man mit der Wasserversorgung mehr in die Breite gehen müssen, halt räumlich gesehen, weil man halt mit den Wasserquellen, die wir jetzt haben, wahrscheinlich nicht mehr zurande kommen werden.
Moderator: Eine kurze Nachfrage dazu, ich habe neulich mal in einer Diskussionsrunde gehört, auch genau dieser Vorschlag, dass man mehr Talsperren oder Trinkwasserreservoirs einfach bilden sollte in ganz Deutschland. Ist das überall ohne Probleme möglich? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt so etwas bauen können?
Prof. Hartmann: Also es gibt schon einen Grund, warum eigentlich so die Tendenz bisschen von den Großstaudämmen auf jeden Fall weggegangen ist, also so was wie den Hoover Dam oder diesen Iquazu Staudamm wird man heutzutage nicht mehr bauen. Weil da sehr viel, also da wird enorm eingegriffen in die Natur und in die Gesellschaften, da werden Ortschaften überflutet und da wird Wasser zurückgehalten. Es entstehen große Wasserkörper, die sehr viel verdunsten. Das habe ich jetzt auch erst seit zwei Jahren, also seit meinem 2-jährigen Wechsel nach Dresden gelernt, dass halt auch die Verdunstung bei den Restwasserseen des Tagebaus ein riesen Faktor ist. Und man muss die ja dann auch immer konstant mit Wasser füllen. Die sind nicht einfach voll, aber man muss da recht viel Wasser immer rein füllen, damit die halt nicht leer verdunsten. Und deswegen muss man bei Staudämmen auch sagen, die sind im Grunde nur die zweite Wahl im Vergleich zum Grundwasser, weil das Wasser ist eben exponiert gegenüber Verschmutzungen, es verdunstet, es geht Wasser verloren in der Atmosphäre, die man sonst übrig hätten. Und ein Staudamm anzulegen geht meist damit einher, dass man größere Flächen überfluten muss, die sonst andersweitig genutzt werden könnten. Und genau. Und dann natürlich auch noch die Katastrophengefahr, dass so ein Staudamm bricht. Aber das ist jetzt mal so nebensächlich.
Gast: Bitte. Mich würde mal interessieren, wie Sie einschätzen die Situation hier für unsere Region bei dieser zukünftig immer stärker werdenden Entwaldung durch irgendwelche, also viele Momente, die da dran schuld sind. Wie sie darauf reagieren können mit dem Handwerkszeug, was ihnen bleibt? Vor allem wissen, dass das Trinkwasser trinkbar bleibt und dass auch wenn die Bäume dann nicht mehr da sind und also nichts brauchen zum Zurückhalten. Müsste ja eigentlich besser werden, ist aber nicht der Fall. Dass Sie das mal vielleicht erklären?
Prof. Hartmann: Ja, also das Thema Wasser und Wald ist ein sehr interessantes Thema, weil der Wald ist eigentlich immer so als Garant für sauberes Trinkwasser gesehen. Und in Deutschland sind auch ein Großteil aller Wasserschutzgebiete, die ja zur Trinkwasserversorgung benutzt werden, bewaldet und deshalb genau aus dem Grund, weil der Wald halt das Wasser sauber hält. Der Wald ist aber auch ein, durstig, sagen wir mal so. Und halt grad Koniferen, die die ziehen Wasser das ganze Jahr und wenn sie das nicht bekommen, dann kriegen sie irgendwann, also dann geht es ihnen schlecht und sie kriegen Probleme mit dem Borkenkäfer. Und deswegen haben wir das große Waldsterben jetzt auch gesehen. Nach den Trockenheiten, also die Bäume sterben nicht wegen der Trockenheit, die Bäume sterben, weil sie geschwächt sind und dann kann der Borkenkäfer meistens die dann dahinraffen. Und die, die Waldwirtschaft, die ist da eigentlich. Also die deutsche Waldwirtschaft ist da eigentlich ziemlich gut, also der Begriff Nachhaltigkeit, der wurde erfunden oder geprägt durch die Waldwirtschaft, die hier in Tharandt schon zu königlichen Zeiten gepflegt worden ist. Und Freiburg, die Forstwirtschaft, die hat auch sehr, sehr lange Geschichte und die haben jetzt schon umgeplant. Die wollen jetzt Baumarten pflanzen, die resilienter gegen Trockenheit sind und eben dann halt auch in Zukunft wachsen können und nicht Probleme bekommen. Was aber da noch nicht so bedacht worden ist und deswegen ist da Forschungsbedarf. Ähm. Ein trockenheitsresistenter Baum hat meistens tiefreichende Wurzeln und so kann er halt die Trockenheit überstehen, weil er dann auch näher ans Grundwasser rankommt. Bedeutet aber dann auch, dass weniger übrig bleibt um das Grundwasser zu erneuern. Das heißt, der Wald bleibt zwar ein Garant für sauberes Trinkwasser, aber er wird weniger sauberes Trinkwasser übrig lassen, nachdem das Wasser durch gereist ist. Und da, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass man sich neu ausm-, dass man das neu berechnen muss. Wie viel können wir in Zukunft von unseren Trinkwassergebieten, die wir gerade nutzen, erwarten? Und wahrscheinlich, wenn man sich das genau betrachten wird, wird es bedeuten, dass wir mehr Trinkwasserschutzgebiete brauchen, also mehr in die Breite gehen müssen, um die selbe Menge an Wasser zu bekommen, die wir in der Vergangenheit bekommen haben. Weil also es darf nicht fehlinterpretiert werden. Ich bin jetzt nicht gegen Wald, ich bin für Wald, weil der Wald hat nämlich so viele positive Effekte. Zum Beispiel sorgt er ja auch dafür, dass Kohlendioxid aus der Atmosphäre genommen wird, wenn neuer Wald angepflanzt wird. Und wenn der Wald verbrennt, dann haben wir teilweise in Australien, wie diese Waldbrände waren. Da wurde ja Kohlendioxid in die Atmosphäre gegeben. Da war die, die die Bergbauindustrie in Australien also die waren fast gleichauf. Das heißt, wir wollen, wir wollen, dass der Wald da bleibt, erhalten bleibt und sich weiter ausbreitet. Aber wir müssen darauf achten, dass dadurch sich auch die Trinkwasserverfügbarkeit verändern wird. Es ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Landnutzungsänderung, die damit einhergeht. Und deswegen müssen wir da unsere Wasserversorgungen darauf vorbereiten. Ja, ja.
Gast: Sie haben uns jetzt erklärt: Holz oder Hölzer und Wasser. Mich interessiert jetzt das Wasser, was in den Flüssen fließt und was verseucht ist. Ich denke an die Oder, die Katastrophe, die jetzt das zweite Mal wohl anläuft. Ja, und das ist nicht ein Einzelfall in Deutschland oder in Europa, sondern weltweit. Mich würde einfach mal interessieren, wie kann man dem entgegen gehen mit dem Wissen, was sie haben?
Prof. Hartmann: Ja, ja. Also ich glaube es ist noch nicht ganz geklärt, warum ähm in der Oder da dieses Fischsterben passiert ist. Und ich wusste jetzt nicht, dass es sich wieder anbahnt. Aber das ist ja eine Verschmutzung, die die, die, die scheinbar aus dem Nichts kam, die aber natürlich da war. Eine Theorie ist, dass da Grundwasser, das relativ immobil war, also nicht sich nicht bewegt hat, dann doch seinen Weg in den Fluss gefunden hat. Also Verschmutztes, eine Altlast sozusagen. Und jetzt mit dem Wissen, das wir haben, wär erst mal: Man kann etwas gegen Altlasten tun und man kann auch erreichen, dass die herausgenommen werden oder wenigstens nicht wohin fließen, wo sie in die Flüsse kommen oder in die Brunnen. Das ist jetzt auch bei dem Tagebaurückbau eine ganz wichtige Sache, weil da sehr viel Eisen freigesetzt worden ist und das kann zur Versauerung des Grundwassers und der Flusswässer führen. Da gibt es Strategien dazu, da kann man, da kann man Brunnen bauen, die das Wasser herausnehmen und dafür sorgen, dass es nicht in den Fluss fließt. Man kann sogar unterirdische Mauern bauen. Es ist alles sehr teuer, aber das wird gemacht, weil man halt das dringend vermeiden will. Aber um solche Katastrophen wie zum Beispiel in der Oder zu verhindern, müsste man vor allem sehr viele Messdaten sammeln, um diese Altlasten zu kartieren. Weil die meisten weiß man gar nicht, wo die sind. Und dann hoppala, hat man auf einmal ein Fischsterben und dann kommt man drauf: Ah, das muss vielleicht, da muss eine Altlast irgendwo im Grundwasser gewesen sein. Und die hat dann ihren Weg zur Elbe gefunden. Wahrscheinlich würden wir den Verursacher dieser Altlast niemals mehr finden. Aber ich denke, man kann wissenschaftlich und mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, vor allem erst mal nach diesen Altlasten suchen und uns überlegen, wenn sich jetzt die Grundwasserströmungsverhältnisse ändern, dass halt zum Beispiel mehr Grundwasser dem Fluss zufließen kann, was früher nicht seinen Weg zum Fluss gefunden hat. Gibt es die Möglichkeit, dass in diesem Bereich Altlasten und Schadstoffe sind, die wir bis jetzt einfach noch nicht erlebt haben, weil sie den Weg nicht gefunden haben? Also besseres Monitoring und Kartierung dieser Schadstoffe. Das ist das, was wir tun können. Wenn wir sie gefunden haben, kann man was dagegen machen. Wenn wir sie nicht finden, dann können wir das hier Überraschungen wie in der Oder, das kann sich das wieder wiederholen. Ja.
Gast: Das war eigentlich noch mit dazugehörig, sehe ich so, die Bedingungen. Unabhängig jetzt mal von einem verschmutzten Wasser, dass überhaupt zu wenig Wasser ankommt auf unserer Ebene, wo das also aufgenommen werden kann als Trinkwasser. Wie man dem Herr wird, das ist sicher ein weltweites Problem. Aber ich denke ja, wenn wir hier sprechen könnte das auch mal mit angesprochen werden.
Prof. Hartmann: Ja, ja. Also die gute Nachricht ist, das Wasser kann den Planeten nicht verlassen. Also das totale Wasser der Erde wird wird schon irgendwie da sein, aber es wird halt sich anders verteilen. Und das ist einfach, es ist einfach mehr Energie in der Atmosphäre. Es ist einfach die Temperatur sorgt für mehr Energie, das Wasser zirkuliert mehr und es wird die globalen-. Ja, das ist ein bischen ausser meinem Spezialgebiet. Also die globale Meteorologie wird verändert. Und was die Klimamodelle sagen, da kann ich schon wieder bischen, da kenne ich mich besser aus. Es ist so ein bisschen so: The rich get richer and the poor get poorer. Es heißt, die, die, die schon jetzt relativ viel Wasser haben, jetzt in Europa die Länder mehr im Norden, werden wahrscheinlich mehr Wasser erhalten. Weil einfach die die Meteorologen, also die die Klimazirkulation, dieses verdunstete Wasser, das zum Beispiel aus dem mediterranen Raum, der weniger Wasser haben wird, in der Zukunft, in die nördlichen Bereiche gebracht wird. Und halt das Wasser wieder zurückzuverteilen als technische Lösung, das ist wahrscheinlich in der Größenordnung nicht möglich. Es wurde schon oft diskutiert, so große Großprojekte in Spanien zum Beispiel zu machen um Wasser von Nordspanien nach Südspanien zu bringen und es würde immer wieder auf Kosten, aufgrund des Risikos und aufgrund der Kosten immer wieder ad acta gelegt. Was wir machen können technisch ist mit weniger Wasser zu leben, ähm mit Meerwasser. Oder Zustände zu erzeugen, die wir jetzt vor, vor dem merkbarem Klimawandel hatten. Das würde ich fast behaupten. Das kriegen wir nur hin, wenn wir den Klimawandel in Griff bekommen. Und das ist also, das sieht nicht so gut aus. Ja, das heißt, wir werden damit leben müssen, dass weniger Wasser zur Verfügung ist. In unserem Bereich, hier in Deutschland, ist so ein bisschen so gemischtes Muster. Also wir werden, bei uns wird der Niederschlag nicht flächenhaft weniger werden. Das ist mal ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr dort. Die Klimamodelle sind unsicher, aber die Verdunstung wird zunehmen und wir werden halt mehr diese Trockenphase haben und mehr diese Hochwässer oder oder Extremereignisse. Und darauf müssen wir uns halt einstellen und da gibt es technische Möglichkeiten dazu, das zu tun. Und ja genau. Ja, ja.
Moderator: Gut, wie wollen wir starten? Der Reihe nach.
Prof. Hartmann: Genau. Ich habe gesehen, die. Sie melden sich schon ganz lange.
Moderator: Bitte schön. Schön zum Mund führen.
Gast: Und zwar wollte ich was sagen, wegen dem Hochwasser. Ich bin aus Meißen. Unsere Stadt ist auch sehr von Hochwasser geplagt. Und es ist ja auch, wenn man in Pillnitz ist, zum Beispiel, dann sieht man, dass dort schon immer Hochwasser war. Und das ist ja jetzt nichts Neues. Und wenn man am Fluss ist, dann muss man mit dem Fluss leben. Das ist einfach so, weil Sie jetzt noch was sagen zu Spanien, da habe ich zum Beispiel eine Frage. In Spanien werden ja ganz viele Avocados angebaut und Avocados brauchen ganz viel Wasser. Eigentlich geht das dann den Menschen verloren. Es wäre besser, wenn das den Menschen zugeführt würde. Aber es geht um wirtschaftliche Sachen, die leben davon und man muss alles im Zusammenhang sehen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, alles im Zusammenhang zu sehen. Und auch in Meißen, damals bei uns, beim Hochwasser hat ja die Triebisch, hat auch sehr viel, die haben mit Staustufen angelegt aber es ist, gefeit sind wir trotzdem nicht vor Hochwasser. Das ist kann, das ist nichts Absolutes, es ist, das sind Mauern die können hochgezogen werden aber Wasser hat enorm viel Kraft. Und wenn das einmal losgeht, da geht es ab, da geht es ab.
Prof. Hartmann: Ja, ich habe zwei, zwei Themenbereiche, also einerseits Spanien, andererseits das Hochwasser. Also statistisch gesehen scheint wohl die Häufigkeit von solchen Hochwässern in der Zukunft zuzunehmen. Das heißt, das wird nichts sein, was man nicht schon mal erlebt hat. Aber man wird es halt wahrscheinlich ein bisschen öfter erleben. Man kann sich dann darauf einstellen. Das Beste ist wahrscheinlich dann doch, dem Fluss ein bisschen mehr Raum zu geben. Gerade im Ahrtal war ja der der Bebauungsgrad auch ein Riesenproblem warum es da so, so so viel Schaden gab und auch Menschen ums Leben gekommen sind. Weil da einfach Bereiche bebaut worden sind, die hätte man dem Fluss lassen sollen. Mit Spanien bin ich genau auf ihrer Seite. Wenn man zu wenig Wasser hat, dann sollte man versuchen, die wasserintensiven Bereiche einzusparen. Und gerade weil Spanien halt sehr stark auch exportiert mit Früchten, wäre das bestimmt eine Möglichkeit das zu tun. Aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie hier. Wenn dann ein Arbeitgeber dran ist, der halt irgendwie die halbe Region beschäftigt, hat der einen gewissen politischen Einfluss und äh, aber man wird nicht drum herumkommen, mit dem, diese Nutzungskonflikte, die dann stärker werden um das Wasser, irgendwie lösen zu müssen. Und das werden wir hier auch im gewissen Grad, hoffentlich nicht so stark wie in Spanien, auch erleben. Weil wir einfach uns darauf einstellen müssen, dass die verfügbare Wassermenge, die wir von früher kennen, nicht mehr so da sein wird. Und wir entweder dann halt in Deutschland die Möglichkeit haben, halt Wasser aus einem größeren Einzugsbereich uns zu holen oder halt lernen, besser mit dem verfügbaren Wasser umzugehen. Und da ist ein Riesenkasten an Werkzeugen steht zur Verfügung, die wir dann halt klug nutzen müssten. Ja genau.
Gast: Danke. Ich möchte zurückkommen zum Grundwasser in Dresden und seit 2018, also seit den vermehrt trockenen Sommern, ist der Grundwasserspiegel hier in Dresden um circa 1 Meter gefallen. Im Bereich des Elbfluters im Elbtal. Haben Sie Prognosen, wie sich das weiter entwickeln wird über die nächsten zehn, zwanzig Jahre?
Prof. Hartmann: Also es gibt die, ich habe die nicht gemacht, die gibt es von Kollegen schon und die haben. Also es gibt verschiedene Vorhersagemodelle, die mit verschiedenen Arten von Klimaszenarien gekoppelt worden sind und die gehen auch sehr weit auseinander. Sie kennen mit diesen Klimaszenarien, da gibt es dann verschiedene Annahmen, wie sich der CO2-Ausstoß verändern wird und wie sich die Gesellschaft darauf anpassen wird. Ich war als Student mal beim Deutschen Wetterdienst und die haben mir mal gesagt, die beste Vorhersage ist oder mit 70%iger Richtigkeit kann man sagen, das Wetter von morgen wird wie das Wetter von heute sein. Wenn man mit der Ansatz mal rangeht und sich anschaut, wie die Grundwasserstände sich in den letzten Jahren verhalten haben und einfach mal sagt: Ich habe, ich nehme einfach mal an, dass es so weitergeht. Dann müsste man recht schnell schon wasserwirtschaftliche Maßnahmen ergreifen, dass es halt nicht so problematisch wird. Also ich würde von dem, was ich an Klimaszenarien gesehen habe, mal eher pessimistisch rangehen, weil weil man da einfach auf der sicheren Seite ist. Weil stellen Sie sich vor, wir nehmen uns jetzt, wir nehmen Klimamodelle. Und, und das zeigt uns an ja, in fünf Jahren wird es wieder besser. Diese Modelle kann man nicht evaluieren. Ich weiß nicht, ob das Modell richtig ist oder nicht, ich werde es in fünf Jahren rausfinden. Aber bis dahin haben wir dann schon wasserwirtschaftliche Entscheidungen getroffen, für die wir die Verantwortung übernehmen müssen. Deswegen ist das was, wenn ich jetzt, diese Frage bekomme ich öfter gefragt. Gehen wir doch einfach davon aus, dass es erst einmal sich so weiter entwickelt wie in den letzten fünf Jahren. Und wenn wir uns verschätzt haben, dann sind wir auf der sicheren Seite und eben nicht auf einer Seite. Also die sichere Seite heißt: Im schlimmsten Fall haben wir ein bisschen zu viel investiert. Wenn wir uns aber verschätzen und zu optimistisch sind, dann wird es deutlich teurer, als wenn wir jetzt ein bisschen zu viel investieren in eine resiliente Wasserinfrastruktur, die wir sowieso brauchen. Es geht nur darum, die Zeitskala, also die nationale Wasserstrategie, die beschlossen worden ist, die ich sehr vernünftig finde, die hat einen Zeitrahmen bis 2030 uns geliefert. Und jetzt mit den fallenden Grundwasserständen, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren beobachten, würde ich sagen, 2030 ist vielleicht. Kann sein, dass das ein bisschen zu. Dass wir ein bisschen schneller reagieren müssen. Wenn man einfach extrapoliert, was man jetzt schon gesehen hat.
Moderator: Ich glaube, die Dame im Hintergrund war eher. Okay, dann.
Gast: Ja. Sie hatten ja vorns gesagt, dass die Speicherung von Wasser in Oberflächenreservoirs wie Stauseen und so. Das ist jetzt nicht mehr Wahl der Technik ist, zumindest nicht in großen Maßstäben. Klingt als, ja waren vernünftige Gründe wegen Verdunstung und Verschmutzung und so. Gibt es denn aber dann konträr dazu irgendwelche technischen Möglichkeiten so Grundwassergebiete, die wo den sinkenden Spiegel haben, mit einer technischen oder landschaftsgestalterischen Möglichkeit wieder mehr Wasser zuzuführen, dass die dann sozusagen als wieder aufgefüllt werden oder als Speicher genutzt werden? Oder ist man dann dort komplett hilflos?
Prof. Hartmann: Also erst mal Staudämme haben schon noch ihren Zweck. Also gerade wo die Untergrundspeicherung nicht so gut möglich ist wie im Erzgebirge, da ist einfach der Untergrund nicht so gut geeignet für die Grundwasserspeicherung. Das andere, was Sie angesprochen haben, dass man künstlich Grundwasser erneuert. Das ist das, was jetzt zum Teil schon hier in Dresden gemacht wird, also dass Uferfiltrat benutzt wird und künstlich Grundwasser eingegeben wird durch Versickerungsteiche. Ich komme ja aus Franken, Sie auch. Und da gibt es ja auch diesen Rhein-Main-Donau-Kanal. Der hat primär den Nutzen, dass die, dass die Binnenschifffahrt da rumfahren kann, aber der hat auch einen sekundären Vorteil, weil nämlich diese Region um Nürnberg, Fürth und Erlangen auch relativ trocken ist. Und dieser Kanal bringt Flusswasser in diese Region rein und das versickert wie das Flusswasser von der Elbe und reichert das Grundwasser an. Und hat dazu geführt, dass dort die Grundwasserstände stabil höher sind, als sie natürlich eigentlich wären. Anderes Beispiel ist der Spreewald. Der Spreewald war eigentlich relativ trocken, bevor der Tagebau losging und durch die Tagebaugrundwasserentnahmen wurde die Spree, ich glaube, die Zahl die ich im Kopf habe, ungefähr doppelt oder sogar mehr als doppelt so viel mit Wasser befüllt. Und dadurch hat sich der Spreewald so gebildet und hat dadurch dazu geführt, dass dort der Grundwasserstand gestiegen ist und dass sich dieses schöne, eigentlich künstliche Ökosystem gebildet hat. Das heißt, es gibt diese Möglichkeiten, ähm, es wird auch in verschiedenen Szenarien erwägt, um das halt auch in der, in der Lausitz zu betreiben oder im mitteldeutschen Revier. Aber halt dadurch, dass wir dort diese vielen, diese Gruppen haben, die halt eben, da fehlt halt Material, weil sie die Kohle rausgenommen haben. Und die werden sich, es werden Oberflächengewässer werden. Das heißt, wenn wir die Grundwasserspiegel so weit anheben, das sie halt auf dem Zustand werden,wie wir sie ja vor dem Tagebau hätten, sind halt, da fluten wir die Seen und das soll ja auch gemacht werden. Aber die haben da eine enorm starke Verdunstung und es wird sehr viel Wasser gebraucht. Also ich habe vorhin schon von Prognosen gehört, dass wir in den nächsten 100 Jahren es nicht schaffen, diese Restseen aufzufüllen, das ist so ein Worst Case Szenario. Weil wir einfach so viel Wasser brauchen, auch um unsere Trinkwasserversorgung zu zu sichern und weil halt dieser Verdunstungsfaktor auch eine wichtige Rolle spielt. Ja.
Moderator: Ich reiche das Mikrofon weiter.
Gast: Ja jetzt haben sie vor allem über die Menge oder des Wassers gesprochen. Ich würde gerne noch vielleicht Sie fragen nach der Qualität. Sie haben eingangs gesagt: Trinken sie alle Wasser vom Grundwasser. Sie brauchen keine Flaschen kaufen. Das ist gut, das ist gesund. Aber es gibt ja auch Anderes. Es gibt verschmutztes Wasser, und ein großer Verschmutzer ist die Landwirtschaft. Und das ist auch ein großes Politikum. Ja, in ganz Europa denke ich unterschiedlich regional und ist ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht gerade in Holland ist es eine riesen, riesen Sache oder. Da geht es, da geht es natürlich um erhebliche ökonomische, politische Interessen. Das also die Qualität des Grundwassers. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen? Also in welche Richtung sollte das aus Ihrer Sicht denn gehen, damit das Grundwasser nicht nur in genügender Quantität, sondern eben auch Qualität vorhanden ist?
Prof. Hartmann : Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Und ich habe jetzt schon hoffentlich ein bisschen klarmachen können, dass uns wird das Wasser nicht ausgehen. Wir werden nur größere Flächen in unsere Wasserversorgung involvieren müssen. Also die Wasserschutzgebiete müssen größer werden, weil wir einfach aus jedem Gebiet ein bisschen weniger bekommen. Das heißt, wir müssen die Gebiete vergrößern. Das ist erst mal kein Problem, weil wir halt genug Wasser haben. Es könnte aber trotzdem zum Problem werden, weil jetzt gerade viele Gebiete, die nicht als Trinkwasserschutzgebiet gelten, zum Beispiel landwirtschaftlich benutzt werden und da teilweise echt sehr viel Nitrat ins Grundwasser kommt und halt die Grenzwerte, der EU-Grenzwert ist gerade 50 Milligramm pro Liter, überschritten wird. Dazu vielleicht noch eine kleine Geschichte, der Grenzwert in Deutschland, müssen Sie mal recherchieren, der war früher niedriger. Soweit ich mich erinnere bei 20 oder 25 Milligramm pro Liter. Also wurde er schon erhöht, um da ein bisschen mehr Spielraum für die Landwirtschaft zu geben. Und das haben wir auch, ja, da schweife ich jetzt ab. Jedenfalls ist es so, dass das wenn wir jetzt in die Breite gehen müssten mit der Wasserförderung, also größere Flächen in die Trinkwasserversorgung integrieren müssten. Dann haben wir natürlich das Problem, dass wenn diese Flächen, die wir da involvieren wollen, eine Wasserqualität haben, die nicht mehr ausreicht, dass wir dann eventuell trotz Wasserreichtums in Deutschland eine Wasserproblematik bekommen und dann halt Wasser aus Regionen her schaffen müssen, die viel weiter weg sind. Und dadurch wird das Wasser teurer. Ein anderer Problemfall bei dem, bei dem Stickstoff ist, dass der flächenhaft eingetragen wird und dann auch sehr lange im Grundwasser verweilt. Das heißt, wenn wir jetzt sofort aufhören würden Stickstoff zum Düngen zu benutzen, dann würden wir trotzdem noch sehr lange warten müssen, bis die Stickstoffkonzentrationen sich wieder ändern würden. Also es kommt ein bisschen drauf an, welchen Grundwasserleiter man betrachtet. Aber halt die tiefgründigen Grundwasserleiter, die sehr hohes Speichervermögen haben, die werden, da spricht man über Jahrzehnte teilweise, dass das dann wieder sich erholen wird. Und das ist natürlich dem Landwirt sehr schwer beizubringen, dass er jetzt nicht mehr düngen darf und dann erst mal gar kein Effekt da ist in den nächsten Jahren. Aber das ist was, was notwendig sein wird. Und ich denke, da werden wir auch strenger sein müssen, gerade in Deutschland. Also ich habe gelesen von Güllezügen aus Holland nach Deutschland, weil es in Deutschland einfacher ist oder weniger stark reguliert wird, halt mit Gülle zu düngen. Und das ist natürlich was, was wir überhaupt nicht haben wollen.
Moderator: Bitte.
Gast: Ich glaube das geht so-
Prof. Hartmann: Ja, ich würde sagen ja, die die hinteren Reihen, ich verstehe sie, aber genau dahinten ist es auch noch ein -
Gast: Ja also angenommen, wir müssten auf das Meerwasser zurückgreifen. Es könnte ja sein. Es wird ja öfter behauptet. Was, was genau geschieht da chemisch? Was müsste da gemacht werden, damit es trinkbar wird? Und wie teuer wird uns das werden?
Prof. Hartmann: Also ich glaube, es muss schon sehr viel passieren, dass wir auf Meerwasser in Deutschland zugreifen müssen. Weil es halt immer noch billiger ist, das Wasser aus dem Gebiet zu holen, wo wo halt noch nicht die Qualitätsproblematik. Oder also das, was jetzt gerade schon gemacht wird, geplant wird auch von von SachsenEnergie ist halt, dass großflächige Wasserleitungsnetzwerke gebaut werden, dass man von einer Region das Wasser relativ einfach in die andere schaffen wird. Und das wird natürlich sich auf den Wasserpreis auswirken. Aber jetzt trotzdem mal hypothetisch in die Frage mit den Entsalzungsanlagen, weil zum Beispiel der Fall Spanien, da wird es schon eingesetzt, also das ist möglich. Ich weiß jetzt die Technik dahinter nicht, ich weiß nur, dass da halt sehr viel Filter, also so mikroporige Filter benutzt werden. Also es ist teuer, es ist energieaufwändig, das wird auch den Wasserpreis nach oben treiben, aber es wird in trockenen Regionen schon eingesetzt und diese Technologie wird wahrscheinlich noch besser und billiger werden, je mehr das eingesetzt wird. Das heißt, theoretisch können wir damit unsere Wasserversorgung sichern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in Deutschland dazu kommen wird, aber gerade im mediterranen Raum wird es sich immer mehr ausbreiten. Aber es wird halt nicht dazu führen, das unsere Ökosysteme am Leben gehalten werden. Wir schaffen es dann unsere Trinkwasserversorgung zu sichern, vielleicht auch unseren Industriebedarf ein bisschen. Keiner wird es für die Bewässerung in der Landwirtschaft benutzen, weil da ist das Wasser viel zu teuer dafür. Da würde man andere Wasserquellen dafür benutzen. Aber wir werden trotzdem die ganzen indirekten Nachteile erfahren, die halt vom Wassermangel in der Natur kommen. Stellen Sie sich vor, wenn alle Bäume im Großen Garten weg wären. Und in Spanien gibt es noch sehr viele Parks, wo die Vegetation durch den Niederschlag aus der Natur funktioniert. Und das werden die dann, die werden das Wasser nicht benutzen, um ihre Parks zu zu bewässern. Die werden dafür sorgen, dass die Menschen nicht verdursten und dass die wichtigste Industrie weiter funktioniert. Also es ist eine Lösung, um unser Überleben zu sichern. Aber die, unser Überleben hängt halt auch an der Natur direkt dran. Und wenn die Natur quasi sehr stark Schaden nimmt, dann wird uns das früher oder später auch erwischen. - Ja. Ganz hinten kommt er. Ja.
Moderator: Ich hatte noch einen. Nein, Ich bringe Ihnen das Mikrophon hinter. Die Zeit haben wir. Bitte schön.
Gast: Ich habe gleich drei oder vier Eckpunkte, die ich anbringen möchte. Ganz kurz bloß, Sie haben vorhin von Natronlauge geredet für die Geräte, die man damit entkalkt. Haben Sie damit Natron gemeint?
Prof. Hartmann: Gebe ich direkt an meine Frau weiter. Sina was benutzen wir, um unser Waschbecken sauber zu machen? Sie sitzt da- Habe ich verwechselt.
Gast: Ich, ich weiß, dass man mit Natron viel machen kann, lebensmittelmäßig und reinigungsmäßig mit diesem Pulver. Und ich weiß auch früher haben wir immer mal Essig genutzt zum Saubermachen, aber das greift ja Gummi an und in Armaturen und auch in Geräten, was sehr gut geht, ohne dass es angreift, ist Zitrone. Da müsste man bloß das Richtige, die richtige Dosis finden. Ja gut, die reine Zitrone oder Zitronensäure, die ist ja hier so als Pulver auch gibt. Ja, und das ist immer noch billiger wie die ganzen Reinigungsmittel, die uns die Industrie anbietet.
Prof. Hartmann: Essig haben wir probiert ging nicht aber Zitrone, Sina schreib mit. Ja, ja.
Gast: Ja, das weiß ich. Das ist nicht so aggressiv. Der zweite Punkt ist Sie haben gesagt, dass es Bäume gibt, die mehr Wasser wegnehmen. Aber es ist ja immer noch besser, wenn Bäume stehen und keine Brachflächen sind, die viel schlimmer sind für die Natur insgesamt. Und wenn man mal rechnet vor den Jahrtausenden, wo sehr viel Wald gewesen ist, ist die Natur ja gut damit klar gekommen. Auch mit der, auch wenn wir diese, als Menschen diese Auswirkungen dann nicht gekannt haben, ist ja Baum immer noch besser. Und Bäume werden ja auch genutzt in der Industrie und überall. Die wachsen ja zum Glück immer wieder nach. Das ist ja das Gute, wird ja teilweise zu wenig genutzt.
Prof. Hartmann: Ja.
Gast: Und wird wahrscheinlich der Natur wesentlich besser gut tun, auch wenn die Bäume dann zum Glück nicht so schnell umfallen usw. und so fort. Die ganzen Aspekte, die, dass die Natur mehr davon profitiert. Die, der dritte Punkt: Sie haben die Oder genannt. Ich glaube, die Informationen, die ich bekommen habe. Die Industrie hat dort irgendwie durch Salzeinbringung, irgendwie Verunreinigung, was dort noch für Verunreinigung in die Oder gekommen sind, weiß ich nicht. Ja, dass deswegen dort die Oder mit den Fischsterben und so Probleme hat, dass es doch nicht Altlasten sind. Wie die mitspielen weiß ich nicht, aber größtenteils die jetzt eingebrachte eingebrachte zu hohe Salzkonzentration, mit der die Flussnatur nicht klarkommt, die sich erst im Meer wieder verdünnt oder dort ist es dann egal mit dem Salz. Ja, der vierte Aspekt: Wenn wir viel mehr, müssten wir natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Nicht diese, die die Talsperren, die ja auch begrenzt nutzbar sind, wo man das Wasser auch wieder ablassen muss, wenn zu viel drin ist, wenn wieder neues Wasser nachkommt durch Starkwasserereignisse. Dort habe ich einen Beitrag mal gesehen und glaube ich ein zweites Mal auch schon gehört, dass man in den Städten viel mehr Speicherplätze unterirdisch anlegen müsste, wo man Geld in die Hand nehmen muss. Wo das Wasser dann langsam versickert und nicht schnell in den Fluss oder was abgeleitet wird, wo wir nichts oder die Natur nicht so viel davon hat. Dass es dort gespeichert wird und das was nicht versickert, dann vielleicht für Park oder für irgendeine Bewässerung noch genommen werden kann, muss natürlich gebaut werden. Aber dann ist es für die Natur insgesamt, wenn es auch nicht als Trinkwasser genutzt werden kann, wesentlich besser. Vielen Dank.
Prof. Hartmann: Gut, ich habe, also ich habe ich. Ich antworte mal auf die letzten drei Punkte. Ich glaube das mit der, mit dem Kalk haben wir geklärt. Genau. Also erstmal mit dem Wald stimme ich vollkommen zu. Ich würde immer Trinkwasser nehmen, das in einem Wald neu gebildet worden ist, weil der Wald halt für die Qualität, die gute Qualität des Trinkwassers sorgt. Und der Wald hat auch den Riesenvorteil, dass der Wald größtenteils, nicht immer. Also beim Elbhochwasser gab es trotzdem Oberflächenabfluss im Wald, aber normalerweise hält der Wald eben auch Hochwasser zurück. Also deswegen: Wir wollen Wald und Wald ist halt auch, hat viel mehr gute Eigenschaften, die über die Wasserversorgung hinausgehen. Zum Beispiel, dass er halt Kohlendioxid auch bindet. Deswegen ist eine Aufforstung in den meisten Fällen eine sehr gute Idee. Deswegen ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich, dass ich gegen Wald bin. Ich bin für Wald. Zweiter Punkt war das mit der Oder, also ich ich, mein Stand des Wissens, aber ich habe jetzt nicht immer verfolgt, war halt das jetzt nicht ganz klar war von was es kommt. Aber was was auch mit dem Salz zustimmen würde, ist dass die Verdünnungen des Salzes besser gewesen wäre, wenn der Flussabfluss, der Durchfluss im Fluss höher gewesen wäre. Dann hätte man einen stärkeren Verdünnungsseffekt gehabt. Und wenn es jetzt halt Basisabfluss war, dann war halt auch der Grundwasserabfluss, der den Fluss zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Salz ins Wasser kam, der hätte höher sein müssen. Das heißt, wenn die Grundwasserstände höher gewesen wären, hätte der Fluss einen höheren Basisabfluss gehabt und dadurch wäre der Verdünnungsseffekt größer gewesen. Das heißt, es könnte indirekt doch was mit dem Grundwasser zu tun haben, auch wenn es vielleicht jetzt keine Altlast war. Genau das heißt, dieser Verdünnungsseffekt, den wir auch haben, zum Beispiel für Kläranlagenwasser. Den können wir in der Zukunft wahrscheinlich, müssen wir schon ein bisschen aufpassen, weil halt diese Verdünnungen weniger werden wird, weil wir weniger Wasser haben. Und der dritte Punkt war jetzt die Schwammstadt, haben Sie gesagt. Genau, die Schwammstadt ist ein sehr gutes Prinzip zur Hochwasserrückhaltung auch zum Beispiel. Also im Ahrtal, wenn das eine Schwammstadt gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden gehabt. Es wird dazu zum Kühlungseffekt führen, wenn man das Wasser zurückhält in der Stadt, wegen der Verdunstungsseffekte. Es wird zu einem Begrünungseffekt führen, weil natürlich dann auch die Vegetation in der Stadt dann davon mehr hat. Ich denke, der allein aufgrund der Fläche von Städten im Vergleich zu Flächen der Wälder, die unsere Wasserschutzgebiete sind, glaube ich für die Grundwasserversorgung wird der Effekt jetzt nicht besonders groß sein. Er wird den Effekt haben, es wird einen Effekt haben, es wird Wasser versickern in der Stadt. Aber halt, in der Stadt haben wir auch Reifenabrieb, wir haben Verschmutzungsquellen in der Stadt, die halt auch dafür sorgen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem Grundwasser, das in der Stadt neu gebildet wird. Und wo es wahrscheinlich klüger wäre, das Wasser sich erst mal ein bisschen verdünnen zu lassen mit Wasser, das außerhalb der Stadt neu gebildet worden ist. Und deswegen würde ich sagen, für die, für die Trinkwasserversorgung von Städten wäre dieses Prinzip der Schwammstadt, was aus vielen Faktoren sehr vernünftig ist, vielleicht eher so ein kleiner positiver Effekt. Aber der wichtigste Effekt wäre Stadtklima, wird in Zukunft viel wichtiger werden und Hochwasserschutz. Und deswegen ist es eine gute Sache und eins von vielen sehr wichtigen Werkzeugen, um uns zukunftssicher zu machen. Ja.
Gast: Eine Frage noch zu der Situation: Wenn wir doch in einer, oder auf einer Erde wohnen, wo der Wasserstand des Meeres allmählich sich erhöht, was einige oder Wissenschaftler sagen und die anderen sagen, dass das nicht der Fall ist? Wie weit kann man denn das, aber diese Probleme, die wir jetzt besprochen haben, könnte man denn erweitern und mal sagen das Feld endet nicht an der Küste, sondern wir müssen überlegen, ob mit Entsalzungsanlagen in einer anderen Weise oder in irgendeiner anderen Weise ein Ausgleich über das, was jetzt an Gletscherwasser in die Meere fließt, müsste doch etwas wieder zurückgewonnen werden können?
Prof. Hartmann: Ja, also kann ich, kann ich, kann ich sehr, sehr schnell beantworten. Also erstens also der Meeresspiegel steigt schon, das ist gemessen, also das und das wird immer stärker und schneller, der Anstieg. Das heißt, das werden wir haben und gerade flache Regionen, Stichwort Bangladesch zum Beispiel, die werden weg sein. Es gibt jetzt schon Inselstaaten im Pazifik, die die Industrienationen verklagen wollen, weil es klar ist, die werden ihre, ihre Insel wird weg sein bald. Die werden ihr Land verlieren. Stellen Sie sich vor, Deutschland würde verschwinden, würde komplett überflutet werden. Das ist Realität schon, das wird stattfinden, das ist nicht mehr aufhaltbar. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist wir als Menschheit haben nicht die Mittel, da signifikant was dran zu ändern über Wasserentnahmen. Alle Entsalzungsanlagen der Welt, werden, haben einen nicht messbaren Einfluss auf den Wasserstand der Meere. Und vor allem man nimmt ja das Wasser und es fließt ja gleich wieder rein. Was wir schaffen müssen ist, dass großflächig wieder Eis sich bildet an den Polkappen und an den Gletschern. Und das geht nur, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Und da hätten wir schon viel früher aktiv werden müssen. Es ist noch machbar, aber es es wird eine harte Zeit kommen, bis wir das hinkriegen. Ja.
Gast: Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Pole gehören ja auch dazu, die abschmelzen, die wir haben. Genau zu den Wälder, wollte ich mal fragen. Wald ist ja nicht gleich Wald und das Landwirtschaftsministerium ist wohl gerade dabei, wie ich das verstanden habe, die Nadelbäume verschwinden zu lassen auf deutschen Böden. Das heißt ja, Laubbäume mit der längeren Wurzel halt wären dann, da wäre der Wettbewerb wird dann größer. Eben auch was Sie vorhin schon mal gesagt haben. Ja, ist es denn trotzdem? Ist es nicht kontraproduktiv? Oder würde man sagen, das ist halt notwendig?
Prof. Hartmann: Da kommt jetzt die Wissenschaftsantwort: Es kommt drauf an. Laubbäume haben, also ich, es kommt ein bisschen auf die Art drauf an, aber tendenziell haben Laubbäume tieferes Wurzelwerk, das heißt, sie kommen besser ans Wasser ran und sind deswegen trockenheitsresilienter. Laubbäume haben aber auch die Eigenschaft, dass sie die Blätter lassen im Winter und deswegen im Winter weniger Evaporation erzeugen. Das heißt, es kommt ein bisschen auf die Art, der Pflanzenart drauf an und wie stark die, diese diese Vegetationsphasen ausgebildet sind. Es kommt auch darauf an, in welcher Wachstumsphase der Wald sich befindet. Ein wachsender Wald braucht mehr Kohlendioxid als ein ausgewachsener Wald. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass ein ausgewachsener Wald auch gar nicht mehr so, also gar nicht mehr so viel Kohlendioxid zusätzlich bindet. Klar, er wächst halt nicht mehr so stark wie der, der wachsende Wald. Es kommt auf die Wachstumsphase drauf an, es kommt auf die Bepflanzungsdichte drauf an. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch eine Baumart braucht mehr Wasser, könnte man als Waldwirtschaftler sagen: Gut, dann pflanze ich halt nur noch jedes zweite, an jedem zweiten Platz einen Baum und lass dem Baum ein bisschen mehr Platz. Also es kommt wirklich darauf an, wie die Waldwirtschaft betrieben wird. Ähm, als Grundwasserforscher habe ich nur den Eindruck, dass gerade die waldwirtschaftlichen Entscheidungen nicht diesen Effekt Grundwassererneuerungsraten stark genug mit einbeziehen. Und wir forschen gerade daran und wir versuchen da auch jetzt gerade mit der Forstfakultät gemeinschaftlich Forschungsprojekte zu starten, um genau diesen Faktor ein bisschen besser unter die Lupe zu nehmen. So was sind die positiven Eigenschaften, positiven Eigenschaften des Waldes für die Wasserversorgung und die anderen Faktoren. Resilienter Wald und Artenänderung und Waldwirtschaft. Und das muss erkundet werden. Und es gibt sicherlich eine Lösung, damit umzugehen, weil die Waldwirtschaft hat da einen großen Spielraum. Sie muss halt nur alle Faktoren mit einrechnen und das macht sie dann auch nicht ganz.
Gast: Sie haben mir da scheinbar auch ein bisschen mit der Politik zu kämpfen in Ihrem Job. Wie gut fühlen Sie sich denn von der Politik wahrgenommen? Auf einer Skala von eins: ganz schlecht bis zehn: super. Wenn Sie solche Probleme diskutieren wie jetzt zum Beispiel Entsiegelungen von Oberflächen in Städten oder so?
Prof. Hartmann: Ja, ja also es gibt, es gibt verschiedene Arten der der Interaktion zwischen Politik und und Wissenschaft. Und zum Beispiel bei der nationalen Wasserstrategie glaube ich, dass da schon die Wissenschaft, also mit beteiligt wurde, weil was da drin steht, ist relativ vernünftig. Ich glaube, das hätten Politiker allein nicht so hinbekommen. Da haben sie sicherlich gute Berater gehabt und die kamen sicherlich aus der Wissenschaft. Was jetzt das Land Sachsen angeht und und und speziell meine Rolle an der TU Dresden, ist vielleicht auch ich bin erst seit zwei Jahren da. Ich würde mir wünschen da wären mehr Interaktion da. Gerade wenn es darum geht, diese großräumigen Interaktionen zwischen zum Beispiel Flusswasserentnahme und Grundwassernutzung im mitteldeutschen Revier und in der Lausitz betrifft, weil da ist, da wird es knapp werden und alles, was man flussaufwärts macht, hat Einfluss auf die flussabwärts Wassernutzer. Und ich, ich höre von sehr vielen Lösungen die mit, die, die dafür auch darauf ausgerichtet sind die Wassermangelsituation einzuschränken. Aber es sind immer so Insellösungen und ich höre sehr oft, wenn wir nutzen jetzt gerne mal Elbwasser, aber es wird nicht mit einbezogen, dass vielleicht die anderen drei Städte flussaufwärts auch Elbwasser benutzen wollen. Und und es wird Wasser von der einen Region in die anderen übertragen. Das kann man machen, aber man muss halt dann auch mit einbeziehen, was das dann für die Leute hat, für eine Auswirkung hat, die dann das Wasser weniger haben und und dazu fehlen bis jetzt noch die Werkzeuge. Es gibt großräumige Grundwassermodelle, die haben aber die Flüsse nicht mit drin. Es gibt großräumige Flussmodelle, die haben aber ein Problem mit dem Grundwasser. Und eigentlich bräuchte man großräumige Modelle, die beides können und und das existiert hier noch nicht. Dieses dieser Vergleich, was ist der größte Wasserspeicher der Welt ist, das habe ich geklaut vom Grundwasserprofessor von der Universität Princeton in den USA. Den habe ich vor zwei, zwei Wochen getroffen bei einer Konferenz und der ist einer, der hat jetzt für die ganzen USA ein Grundwassermodell entwickelt, das Oberflächengewässer und Flüsse und Dämme alles mit einbeziehen kann. Das konnte nur ein Wissenschaftler machen. Es konnte nur ein Wissenschaftler machen mit einer sehr gut ausgestatteten Forschungsgruppe, die er in Princeton hatte. Und ich bin der Meinung, dass diese Aufgabe, diese enorme Aufgabe, ein Werkzeug zu entwickeln, das auch diese selben Möglichkeiten hat, für unsere Region auch ein viel stärkeren wissenschaftlichen Beitrag braucht, als es jetzt gibt. Bis jetzt wird es sehr stark ausgelagert an Ingenieursbüros, die Methoden anwenden, die schon sehr lange existieren, das machen die par excellence. Aber die Methoden, die wir jetzt brauchen, gehen darüber hinaus. Und diesen Methodenschatz, den gibt es dort nicht. Und in den Behörden bin ich mir, habe ich nicht so einen großen Überblick. Ich weiß, dass die Behörden sehr gute Arbeit machen. Aber ich glaube, gerade diese, diese neuartigen Entwicklungen, die man braucht jetzt gerade, um diese Werkzeuge zu entwickeln, da ist ein stärkerer wissenschaftlicher Beitrag vonnöten. Ja.
Moderator: Ja, noch eine Publikumsfrage.
Gast: Um diese, diesen Wasserverbrauch zu reduzieren, ist wieder der ganz einfache Gedanke: Warum fragt man nicht die Industrie, die diese Wasser, die diese Wasser entnehmen? Und wenn wir da denken, ein Großunternehmen, die vielleicht jetzt gerade im Spreeraum Wasser brauchen. Die wissen doch genau, welche Schadstoffe in das Wasser kommen. Die könnten also auch die diese bekannten Schadstoffe wieder entnehmen und das Wasser dann fünfmal, zehnmal, xmal nutzen. Warum geht man, nach meiner Kenntnis, den Weg nicht da was festzulegen?
Prof. Hartmann: Ja, da bin ich ganz auf Ihrer Linie. Wenn wir jetzt an größere Betriebe denken, Mikrochip oder eAutos, da werden sehr große Wassermengen benutzt und es gibt ähnliche Fabriken in ganz anderen Regionen in der Welt, die zehnmal trockener sind als hier. Und die funktionieren, weil die nämlich eine sehr elaborierte Brauchwassernutzung haben. Das heißt, die haben fast geschlossene Wasserkreisläufe, die nehmen einmal das Wasservolumen, das sie brauchen, und recyceln das immer wieder durch interne Klärprozesse, Aufbereitungsprozesse. Und nicht jeder Prozess in der Industrie braucht Reinstwasser wie die Microchip-Industrie. Da gibt es viele andere Prozesse wo man Wasser braucht von Ok-Wasserqualität. Die Technologie ist da, es ist nur der Faktor Pinke, Pinke. Und und da denke ich, könnte eventuell die Politik ein bisschen mehr Anreize schaffen und natürlich auch ein bisschen regeln. Also so ein bisschen es schwieriger machen, einfach wasserverschwenderisch zu sein und es einfacher machen, geschlossene Wasserkreisläufe einzusetzen. Das ist das eine Mittel, das ich sehe. Und das andere Mittel: Wenn ich jetzt an eine große Fabrik denke, wie zum Beispiel jetzt die Microchip-Industrie, die jetzt ja hier wieder stark ausgebaut wird, wäre es doch auch in meinem Interesse, dass ich eine dauerhafte Produktion sicherstellen kann. Und dieses Modell der Flusswassernutzung hängt halt dann auch wieder an dem sehr fluktuierenden Charakter der Elbe. Und wenn die Elbe jetzt mal entscheidet ich ich bin mal sehr trocken und dann bin ich mal wieder ein Hochwasser. Dann dann ist es ein Risiko für die Produktionssicherheit dieser Firma. Das heißt, es hat eigentlich auch einen starken Sinn für eine für einen großen Betrieb, der viel Wasser benutzt, diese Wasserbenutzung sicherzustellen und die möglichst in eigenen Händen zu haben. Und ähm, ich habe ehemalige Studierende hier von, von der TU Dresden, die auch in Firmen arbeiten, die solche Wasser-, geschlossenen Wasserkreissysteme entwickeln und die Nachfrage steigt. Und die sagen auch die Firmen sehen auch den Vorteil, wenn sie ein bisschen Eigenmittel reinstecken und nicht nur alles vom Staat subventioniert bekommen, dass sie dadurch halt sicherer produzieren können, weil halt die Wassersicherheit in der Zukunft stark davon abhängt, wie klug und voraussehend die Entscheidungen der Politiker sind, die das am Ende bestimmen. Und es kann klappen, es kann in die Hose gehen, je nachdem.
Moderator: Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde geredet miteinander. Ich höre verschiedene Nuancen raus, also von Besorgnis zu ein bisschen Argwohn gegenüber größeren Playern. Und immer wieder dieses, diese Ungewissheit, in die wir hineingeraten oder der wir entgegengehen durch Klimaveränderung. Was können wir denn vielleicht tun? Ich für mich zu Hause? Oder was können Sie, Herr Professor Hartmann, aus der Forschung noch? Vielleicht haben Sie noch einen kleinen Balsam, um die Besorgnis wieder ein bisschen abzudecken?
Prof. Hartmann: Also es ist, uns wird das Trinkwasser nicht ausgehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Also allein an Volumen an Wasser, das wir hier in Deutschland zur Verfügung haben, trotz Verschmutzung. Uns wird das Trinkwasser nicht ausgehen. Was passieren wird, ist, dass wir uns mehr Gedanken machen müssen: Wie verteilen wir das Wasser? Wie können wir dafür sorgen, dass die notwendigen Wassermengen zur Verfügung gestellt werden für Landwirtschaft und Industrie? Wie können die effizienter werden? Landwirtschaft haben jetzt nicht angetroffen, angesprochen, aber man kann Tröpfchenbewässerung usw. Also es gibt sehr tolle Technologien, die wir aus anderen Ländern importieren können, die in trockenen Regionen sind und erfolgreich Landwirtschaft und Mikrochip-Industrie betreiben. Das ist möglich. Das heißt, die Technologie ist da. Das Schlimmste, was uns passieren kann, dass es ein bisschen teurer wird und hoffentlich nur zeitweise teurer. Das heißt also keine Sorge, uns wird das Trinkwasser nicht ausgehen. Wir würden vielleicht unseren Pool im Garten nicht befüllen müssen. Aber ich habe keinen Pool im Garten, die meisten von ihnen, weiß ich nicht genau. Aber, aber ja und ja. Also ich bin ja selber ein Optimist, deswegen. Also ich, ich würde eher sagen, es wird Umstellungen geben. Es wird Umstellungen in Richtung nachhaltigere Wassernutzung geben. Die wird mehr oder weniger schmerzhaft werden, aber nicht bedrohlich. Ist das optimistisch genug?
Moderator: Ja doch, das tat schon gut.
Prof. Hartmann: Gut. Ja.
Moderator: Okay.
Gast: Im Moment, ja wir sind ja keine Insel oder nicht?
Prof. Hartmann: Also, wenn ich. Ja, ja also mein Optimismus ist ganz schnell weg, wenn man an den nordafrikanischen Raum denken, selbst an den mediterranen Raum. Die werden Probleme haben, die, ich weiß nicht ob die lösbar sind. Ich habe Kollegen in Montpellier in Frankreich. Die haben gesagt, in 50 Jahren ist das eine Wüste. Und dann schauen sie, wie die Menschen in der Wüste leben. Das geht auch, aber das ist nicht so wie jetzt. Also man muss, wenn man global denkt, wird das, sinkt der Optimismus. Und auch an die Menschen, die jetzt in Bereichen leben, die bald unter dem Meeresspiegel sein werden. Also wir werden also, wenn man das global betrachtet, würde man, müsste man darauf schließen, dass dann, dass es enorme Bevölkerungswanderungseffekte geben wird, die dann natürlich auch politisch Einfluss auf uns haben werden. Wir haben das ja jetzt schon ein paarmal erlebt und da ist natürlich auch sehr viel Bedachtheit der Politik und der Bevölkerung wichtig. Und ich weiß, es gibt Tendenzen, so einen globalen Katastrophenfond einzurichten, der bis jetzt halt nur minimal, also der, damit kann man keine Katastrophe bezahlen. Aber da muss viel mehr gemacht werden, um den Menschen in den Regionen, die aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht fähig sind, mit den, mit den Konsequenzen des Klimawandels umzugehen, um denen zu helfen. Weil je mehr wir das hinkriegen, desto geringer werden die Wanderungs- oder Abwanderungseffekte, die halt zu sehr viel Problemen dann anderswo halt führen können, wo das halt dann hinströmt. Und das werden wir erleben und unsere Kinder werden es sicherlich erleben, ja.
Moderator: Herr Professor Hartmann, ich danke Ihnen sehr viel also herzlich für das Gespräch, auch für die vielen regen Antworten aus dem Publikum. Und in diesem Sinne möchte ich dann hiermit die Veranstaltung ausleiten, noch hinweisen auf unsere nächste Veranstaltung am 3.09. zum Thema "Der Duft des Textes: Gerüche in der antiken Literatur". Aber für heute erst einmal an Sie noch mal einen Applaus. Vielen Dank!
Prof. Hartmann: Ja, vielen, vielen Dank für die hervorragenden Fragen! Es war eine super Diskussion! Danke für die Moderation!
Moderator: Ich danke auch!
CampusAcker: Bildung für Nachhaltige Entwicklung - Prof. Dr. Jana Markert und Dr. Simone Reutemann
Seit 2022 gibt es im Botanischen Garten der TU Dresden in Kooperation mit Acker e.V. einen Gemüseacker für angehende Pädagogen und Pädagoginnen. Wie auf diesem "CampusAcker" beim Gemüse säen und ernten „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ erfahrbar wird und was das für die Schule von morgen bedeutet, davon berichten die Juniorprofessorin Dr. Jana Markert und Dr. Simone Reutemann, Professur für Geographische Bildung.
Intro: Hallo und Herzlich Willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere"! Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator Tobias Dombrowski: Auch meinerseits Herzlich Willkommen zu "Triff die Koryphäe unter der Konifere". Guten Tag, Frau Professorin Jana Markert und Frau Dr. Doktorin Simone Reutemann. Ich möchte auch meinerseits noch mal das Publikum hier auch ermuntern, die Fragen zu stellen. Seien Sie mutig und wenn es ein bisschen dauert. Im Nachgang haben wir noch mal eine Fragerunde, auch zum Ende hin, da werde ich noch mal explizit auf euch eingehen und noch ein paar Fragen rauskitzeln. Ansonsten seid einfach ganz offen und stellt sie gerne mit einer Wortmeldung. Wir geben das Mikrofon dann an euch weiter. Wir sprechen heute über Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE in der Lehramtsausbildung an der TU Dresden. Hier gibt es einen Bildungsacker im Botanischen Garten. Was das genau ist, erfahren wir jetzt. Ich möchte gleich einmal starten mit der Vorstellung unserer Gäste. Frau Dr. Simone Reutemann, Sie haben Ihr Studium von 83 bis 88 absolviert, und zwar war das ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Dresden. Sind dann 1988 bis 2011 an der, an verschiedenen Oberschulen gewesen, in Leipzig als Diplomlehrerin für Geografie, Russisch und Wirtschaft. Seit 2000 sind Sie Mitautorin in dem Schulbuchverlag Westermann und von 2011 bis 2018 Lehrerin hier im Hochschuldienst an der TU Dresden. Jetzt ist es so weit. Seit 2018 arbeiten Sie in Ihrem jetzigen Amt dem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur der Humangeografie. Sie kommen aus der Ecke der Pädagogik. Kann man das so sagen ja?
Frau Dr. Simone Reutemann: Ja, wenn man es sogar eher aus der Ecke der Praxis, wenn man das so möchte, weil das Studium doch schon ein Weilchen zurückliegt und ich viele Jahre in der Schule gearbeitet habe, fast 25 Jahre und dann noch mal den Weg an die Universität gefunden habe. Ja.
Moderator: Frau Juniorprofessorin Dr. Jana Markert. Bevor ich Sie einleite: Was ist denn das mit der Juniorproffesur? Können Sie das kurz mal erklären? Für uns, die wir das nicht kennen?
Frau JProf. Dr. Jana Markert: Äh, ja, das kann ich kurz erklären. Eine Juniorprofessur ist eine besondere Art einer Stelle im wissenschaftlichen Hochschulwesen sozusagen. Man beginnt eine Professur und diese wird noch mal bewertet. Zwischendurch gibt es zwei verschiedene Evaluationszeitpunkte und dann wird, hat man bestimmte Kriterien zu erfüllen und dann wird festgemacht, ob man die Professur weiter behält oder ob man eben, vielleicht doch nicht so gut für die Wissenschaft geeignet ist. Also eine Art von Nachwuchsstelle sozusagen im, in der wissenschaftlichen Laufbahn auch relativ neu. Die wurde, glaube ich, geschaffen, um auch Frauen ganz besonders noch mal so die Möglichkeit zu geben einzusteigen, glaube ich. So mit Kinderphase. Herr Neinhuis schüttelt den Kopf. Okay, also meine Erfahrung ist einfach, dass auch viele Frauen drauf sind auf Juniorprofessorenstellen. Ja, weil sie vielleicht nicht aufgrund von falls eine Familienphase dazwischen war, wie es auch bei mir der Fall war. Dass dann eben einfach diese klassische Laufbahn vielleicht nicht ganz so funktionierte. Vielleicht aber auch eine persönliche Interpretation jetzt von mir. Herr Neinhuis hat den Kopf geschüttelt, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, das wär jetzt vielleicht zu viel am Thema vorbei. Genau.
Dr. Reutemann: Aber vielleicht müsste man noch dazusagen, dass Frau Markert keine Juniorprofessorin mehr ist, sondern sie ist jetzt ordentliche Professorin, also nicht ordentliche, außerplanmäßige Professorin.
Moderator: Okay, starten wir mal von Beginn an. Frau Markert, Sie haben ein Studium absolviert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mit einem Austauschjahr in Frankreich an der Universite de Montpellier und haben Ernährungswissenschaften studiert. Ihre Diplomarbeit haben Sie am Max-Planck Institut für Chemische Ökologie abgelegt. 2010 bis 2015 am IFB gearbeitet. Und zwar ist das das integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum an der Uni Leipzig zu Adipositaserkrankungen. 2014 haben sie dann mit einer Promotion abgeschlossen an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Das Thema ist Prävention der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Anschließend waren sie in der Lehrerbildung tätig und von 2018 bis 2020 haben Sie noch mal eine Forschung angehangen zu Fachdidaktik innerhalb beruflicher Bildung und Inklusion. Das haben Sie gemacht an der Universität Leipzig. Und jetzt seit 2020 Junior- oder außerordentliche Professorin? Ok für Ernährungs und Haushaltswissenschaften und sowie auch für Didaktik eben desselben Berufsfeldes. Ja, Frau Reutemann. Aus der Praxis kommend und aus der Pädagogik. Was hat Ihnen denn gefallen, damals, als Sie jung waren an Ihren Lehrkräften?
Dr. Reutemann: Als ich noch selber in die Schule gegangen bin? Oh, das kam immer sehr auf die Persönlichkeit drauf an, die vor einem gestanden hat, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich auch das die Dinge, die einen selber interessiert haben in der Schule. Also da hat man schon sehr lehrerabhängig auch gelernt. Es geht bestimmt auch heute noch vielen so, aber auch interessenmäßig. Ja, also. Geografie zählte damals übrigens nicht zu meinen Lieblingsfächern, muss ich noch dazu sagen.
Moderator: Frau Markert, was waren Sie denn früher, wenn Sie zurückdenken für einen Lerntyp?
JProf. Markert: Hmmm vom Lerntyp her. Also ich fand es gut viele Dinge zu erfahren. Und ich fand es auch immer schön, wenn Dinge wirklich haptisch mit uns durchgespielt wurden und wenn wir Dinge ausprobieren konnten in der Schule. Also es gab viele Fächer, die auch wie Werken, Sachunterricht oder so. Am Gymnasium war das dann weniger natürlich, dass man wirklich Dinge auch durchprobieren konnte. Aber wenn man Dinge ausprobiert hat, sind sie natürlich eher im Gedächtnis geblieben, als wenn dieses Auswendiglernen für einen bestimmten Abschnitt, Test oder so. Und dann war es wieder weg. Das ist ja auch so das Konzept, was wir hier auf dem Bildungsacker mit verfolgen. Genau.
Moderator: Jetzt ist das Stichwort schon mal gefallen. Sie beide kommen ja von verschiedenen Fakultäten. Aber teilen Sie jetzt die Schnittmenge der Bildungsacker? Wie ist es denn losgegangen?
JProf. Markert: Also tatsächlich gab es eine Art Aufruf des Acker e.V.. Das ist ein Verein in Berlin, die sich seit Jahren für Bildung, für eine nachhaltige Entwicklung engagieren, vor allem in Kindergärten oder auch Grundschulen. Und dort mit den Kindern viel an einer Ackerfläche arbeiten. Und die hatten die Idee, das auch in die Lehrer:innen Bildung an die Hochschulen zu tragen und haben tatsächlich uns angeschrieben. Und Frau Professorin Raschke und ich haben uns zeitgleich einfach darauf gemeldet und so sind wir dann durch diesen Aufruf da zusammengekommen. Am Beginn des Sommersemesters '22 war das, vielleicht im Januar der Aufruf oder so. Das Sommersemester begann im April und da sind wir dann tatsächlich auch gestartet. Oder der Aufruf war vielleicht auch ein bisschen früher, wir mussten da ein bisschen was vorbereiten. Aber dann vor dem letzten Sommersemester kam der Aufruf, wir haben uns beide dafür interessiert. Und hatten dann das hier ausprobiert am Botanischen Garten und glücklicherweise auch die Möglichkeit gehabt, hier eben dann diese Fläche mitzunutzen.
Dr. Reutemann: Also an der Professur für Geographische Bildung haben wir bereits vor Corona auch mit einer Schule in Leipzig zusammengearbeitet von diesem Verein Acker und haben dort auch schon versucht, mit Schülerinnen und Schülern dort den Schulgarten wieder zu beleben. Und die Schülerinnen und Schüler auch zu motivieren, dass sie dann jede Woche in den Schulgarten kommen, um dann ihre Pflanzen wachsen und gedeihen zu sehen, zu pflegen. Und das war sehr interessant, mit den Schülerinnen und Schülern dort zu arbeiten. Das war so die Motivation dann, warum Frau Raschke mit Frau Markert dann den Weg gemeinsam gegangen ist von unserer Seite.
Moderator: Okay, danke für diese Information. Jetzt ist es ja so, dass der CampusAcker, ähm. Etwas anderes ist, von einem Verein kommt und euch inspiriert hat bzw. ihr dann noch mal eine Eigenleistung mit hinzugibt. Ja?
JProf. Markert: Also wie Frau Reutmann gerade schon gesagt hat, sind also der CampusAcker ist die Programmlinie, die sich der Acker e.V. überlegt hat für die Hochschulen. Und was tatsächlich vom Acker e.V. kommt, ist, die haben ausgebildete sogenannte Ackercoaches. Das sind Männer und Frauen mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund, die eben an diesen Kindergärten und Grundschulen schon unterwegs sind. Und die Idee war eben diese Person jetzt auch in die Lehrerbildung ein bisschen mitzuintegrieren, um das gleich an die Lehrkräfte in der Ausbildung schon heranzutragen. Wenn die dann eben in der Berufspraxis sind, dann vielleicht auch besser da andocken können und das eher schon mal kennen. Und die Leistung, die jetzt der Acker e.V. praktisch bringt, ist eben die Vermittlung dieser Honorarkraft und Pflanzen, also das ganze Know-how, dieses landwirtschaftliche Know-how, die Pflanzenlieferung. Und natürlich sind die auch in der Lage, den Studierenden dann bestimmte Dinge über ökologisches Gleichgewicht und so mitzuvermitteln durchs Tun und auch durchs Erklären. Und das Seminar an sich ist aber ein Seminarkonzept, was auf eine BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, abzielt. Ein wichtiges Konzept, was man Lehrkräften heutzutage unbedingt mitgeben sollte, Lehrkräften sämtlicher Schularten. Und das ist so unser Hauptfokus, warum wir dieses Seminar in die Lehrerbildung gerne integrieren wollen. Und das kristallisiert sich eben an dieser Ackerfläche. Und für diese Ackerfläche benötigen wir eben die Unterstützung des Acker e.V., weil wir selber diese landwirtschaftlichen Tätigkeiten gar nicht gewährleisten können. Und wir haben das große Glück, hier im Botanischen Garten eben auch diese Fläche nutzen zu können. Wird eine andere Fläche bald werden. Aber das diese Fläche zu nutzen. Und natürlich sind hier auch Kräfte, die das landwirtschaftliche Know-how haben. Aber die haben ja ihre festen Aufgaben im Botanischen Garten und sind jetzt nicht so in die Lehrer:innenbildung involviert oder können das nicht einfach nebenbei noch mit leisten. Das ist nicht nicht möglich und darum ist es gut, an der Stelle auf den Acker e.V. zurückgreifen zu können und diese Honorarkräfte dann mit nutzen zu können. Das ist auch eine Leistung, die wir dem Acker e.V. dann natürlich vergüten. Die können das ja auch nicht einfach so machen. Die müssen ihre Honorarkräfte natürlich auch ordentlich bezahlen und da machen die einzelne Einheiten auf dem Acker, gestalten die bzw. machen die landwirtschaftliche Tätigkeit und danach machen wir noch einen theoretischen Input. So eine typische Ackerstunde an der Hochschule sieht eben so aus, dass wir erst einen theoretischen Input, eine 3/4 Stunde ungefähr bringen und dann geht der Ackercoach, die Ackercoachin mit den Studierenden auf die Fläche und dann sind dort die Arbeiten zu tun, die zu tun gerade sind. Ja.
Moderator: Haben wir hier im Publikum auch Studierende hier von der TU Dresden? Ja, da melden sich ein paar. Wenn diese jetzt kommen möchten und möchten mitwirken. Wie sieht denn das aus, der Prozess dort?
Dr. Reutemann: Momentan ist es so, dass das begrenzt ist für die Studierenden der Professur für Geographische Bildung und für das Berufsfeld der Ernährung. Es ist aber so auch so eine Vision, wenn man da hingehen kann, dass man das auch für Studierende mit allgemeinem Interesse für den Bildungsacker öffnen möchte. Aber dazu, denken wir, ist es noch ein Stückchen Weg, weil wir auch noch in so einer großen Phase des Erprobens sind. Wir haben ja, die Studierenden sind sowohl im Sommer bei uns, wo es viel zu tun gibt, auf dem Acker, aber auch eben im Winterbereich haben wir letztes Jahr eben sehr, sehr viel noch dazugelernt. Und das wäre so eine Vision. Dass man das für Studierende der TU insgesamt öffnet. Aber die Plätze da sind aber sehr gut nachgefragt in beiden Richtungen. Wir haben das jetzt so geteilt. Es sind 20 Studierende dabei und zehn kommen von der beruflichen Bildung und zehn von der Geographischen. Und wenn das in Opal ausgeschrieben wird, sind die Plätze zu unserer Freude auch immer sehr schnell vergeben.
Moderator: Okay, liegt es daran, dass an der Universität sehr viel Theorie gelehrt wird und die Praxis dann einfach ein bisschen fehlt? Oder würden Sie das so gar nicht sagen wollen?
JProf. Markert: Was liegt daran, dass die das fehlt? Ja, aber was liegt daran, dass das große Interesse an diesem vielleicht. Ja, ja, genau. Das große Interesse. Also. Das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen wollen, weil man das auch, Lehramtsstudium ist sehr divers. Es gibt ja sehr viele verschiedene Schularten, für die an der TU Dresden ausgebildet wird. Sie haben Grundschullehramt, Lehramt an Oberschulen, am Gymnasium und dann das berufliche Lehramt auch noch mal mit sehr vielen verschiedenen beruflichen Fachrichtungen. Und ich denke, was die Studierenden hier aber so sehr reizt, ist vielleicht auch wirklich dieser außeruniversitäre Lernort, also dieses Draußensein. Wir sind im Sommersemester auch wirklich jede Woche hier draußen, entweder am Acker selber oder dann direkt in der Nähe vom Acker ist noch so ein Pavillon, da haben wir auch Tische und Stühle, die wir nutzen können, die man einklappen kann. Wir sind wirklich draußen mit denen und das reizt die auch ganz sehr. Also da haben die wirklich Lust drauf, da kriegt man andere Eindrücke noch. Und viele von denen gehen ja oder machen alle ihr Studium, um ins Lehramt zu gehen. Ob sie das alle tatsächlich tun werden, wissen wir nicht. Aber die wollen sich ja auch Ideen dann abholen, wie sie selber mit ihren Schüler:innen und Lernenden dann später auch andere Orte außer des typischen Klassenzimmer dann nutzen können für Unterricht und das auszugestalten. Und da holen sie sich dann auch ein paar Ideen mit ab. Aber das ist wirklich, auch für uns Dozentinnen ist das sehr schön, draußen zu sein mit denen und nicht im typischen Seminarraum. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema einer BNE, also die Bildung für nachhaltige Entwicklung, wirklich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen interessiert und dass sie dann nach den Angeboten suchen und dass sie auch deswegen kommen, um da konkretere Ideen für zu erhalten. Ja.
Dr. Reutemann: Ja vielleicht, um das noch zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, dass es auch darum geht, dass man das, was man schon gelernt hat über diese Bildung für nachhaltige Entwicklung innerhalb des Studiums, dass man da auch jetzt mal praktische Anwendung findet. Welche Ideen andere haben, etwas umzusetzen. Wir haben da auch verschiedene Prüfungsformate oder Prüfungsleistungsformate. Sie müssen einen Elevator Pitch gestalten, in dem Sie Ihr Konzept, was Sie für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Schülerinnen und Schülern hier entwickelt haben. Dann müssen Sie das kurz und knackig vorstellen und dann entsprechend an Ihrem Konzept arbeiten, sodass Sie also selber auch Ideen bekommen, was man dann in der späteren Tätigkeit als Lehrer oder Lehrerin mit Schülerinnen und Schülern auch umsetzen kann.
JProf. Markert: Und weil du es auch gerade gesagt hast mit dem Prüfungsleistung. Also wir haben aktuell nur Studierende aus diesen beiden Verschiedenen, also Geografie und berufliches Lehramt Ernährung und Hauswirtschaft drin. Und dennoch ist das, glaube ich, schon sehr bereichernd, auch für die Studierenden, denn die kommen miteinander in Kontakt, die entwerfen diese Prüfungsleistungen auch in Kleingruppen. Auch da finden sich dann manchmal gemischte Gruppen, auch wenn es das Fach Geografie an beruflichen Schulen für Ernährung und Hauswirtschaft nicht so gibt, in der Form. Aber die lernen einfach mal über das eigene Fach, über die eigene Fachrichtung hinaus zu denken. Wie kann man jetzt Inhalte miteinander verknüpfen? Das ist ja auch genau das, was wir eigentlich wollen von angehenden Lehrer:innen, dass die dann über ihr eigenes Fach hinaus ein bisschen schauen, wo gibt es andere Inhalte, wo sind ähnliche Inhalte, wo kann ich hier Verbindungen ziehen, wie kann ich mit Kolleginnen später dann eventuell zusammen Unterricht, Unterrichtssequenzen gestalten?
Dr. Reutemann: Weil du jetzt gerade sagtest, wir halten uns wirklich als Lehrkräfte ganz stark zurück, um auch die sozusagen die Kommunikationsprozesse der Schülerinnen und Schüler, quatsch, der Studierenden nicht zu stören. Sie müssen sich selber organisieren die Ackerfläche zu bewässern. Das muss also auch nicht nur immer donnerstags, dass man da ist, sondern das muss die ganze Woche über passieren. Und da haben sie auch die verschiedensten Varianten eben schon entwickelt diesbezüglich, von WhatsApp Gruppen und in den Dokumenten eintragen. Aber das wirklich immer es gesichert ist, dass der Acker immer gepflegt wird über das ganze Semester.
Moderator: Es gibt eine Wortmeldung, ja.
Gast: Ich habe zwei ganz praktische Fragen. Die eine Frage ist: Sie hatten gerade gesagt, dass Sie vorrangig im Winter, äh vorrangig im Sommer natürlich auf den Acker gehen. Und ich habe aber auch gehört, dass Sie im Winter zum Teil, was ich persönlich total wichtig finde, das mit einzubeziehen, weil die Natur macht ja keine Pause. Das würde mich interessieren. Und die zweite Frage, die fällt mir dann glaube ich wieder ein, wenn Sie geantwortet haben, kann ich auch am Ende stellen. Genau, Aber das würde mich erst mal interessieren. Ich gebe sie mir so quer durch, dann müssen Sie nicht. Danke.
Dr. Reutemann: Ja, machen wir gemeinsam. Das Wintersemester ist noch auch für uns eine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und wir gehen da auch am Anfang vor allen Dingen mit raus. Und wir wissen auch schon, wie das Wintersemester dieses Jahr ablaufen soll, dass eben hier auch noch mal eine Aussaat passieren soll, dass man dann während des Winters auch noch was ernten kann.
JProf. Markert: Genau. Also vielen Dank für die Frage. Uns war das auch sehr wichtig, das ganze Ackerjahr sozusagen abzubilden dann. Und deswegen haben wir die Lehrveranstaltung, bieten wir die auch eben über zwei Semester an. Die Studierenden können sich entscheiden, ein Semester teilzunehmen, entweder im Winter oder im Sommer. Wenn sie ein Semester teilnehmen, entscheiden sie sich eher fürs Sommersemester. Sie können aber auch beide Semester absolvieren. Und vom Acker e.V. gibt es das Angebot tatsächlich auch nur fürs Sommersemester. Das ist irgendwie an den Schulen wahrscheinlich auch leichter zu realisieren, sodass es für uns eine besondere Challenge war, dann das Wintersemester zu gestalten. Und wir haben das im letzten Wintersemester auch zum ersten Mal ausprobiert. Da lag die Fläche mehr oder weniger ein bisschen brach. Also wir haben uns noch drum gekümmert und die sah nicht ganz schlimm aus und die haben die winterfest gemacht und so, aber sonst passierte wenig auf dem Acker. Und dieses Mal wollen wir aber gern dann im Wintersemester auch noch eine Winteraussaat machen, dass wir den Acker noch ein bisschen besser nutzen können, dann im Winter. Und da geht es dann vor allem darum, dass wir auch Exkursionen machen. Zum Beispiel haben wir die Verbrauchergemeinschaft hier in Dresden besucht oder wir haben die eine solidarische Landwirtschaft besucht bei Radebeul. Also es geht uns auch darum, so andere Konzepte des Wirtschaftens noch mal mit zu thematisieren für die Studierenden. Und da bietet sich so eine SoLawi sehr, sehr gut an, einfach. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Wir laden auch Gastdozent:innen ein, dass sowohl im Sommer als auch im Winter. Es passiert dann im Winter ein bisschen häufiger. Jetzt in der vorletzten Woche hatten wir eine Referentin aus dem Institut für ökologische Raumentwicklung. Die hat etwas über Postwachstumsgedanken erzählt, dass die Studierenden mit diesen Dingen auch noch mal in Berührung kommen. Solche Dinge passieren dann im Winter ja.
Dr. Reutemann: Noch zur Ergänzung dann, die-. Sie mussten sich im Wintersemester Gedanken machen die Studierenden, wie denn der Acker dann im Sommersemester ausschauen soll, welche Früchte, welche, was wird gesät, was wird gepflanzt auf dem Acker? Und es waren dann doch einige dabei, die es dann bedauert haben, eben nicht ins Sommersemester zu gehen, aus verschiedensten Gründen, weil sie das dann nicht mit umsetzen können. Und das Sommersemester setzt das jetzt sozusagen, die Studierenden um, um das Ganze sozusagen, was sie sich vorher überlegt haben.
Gast: Hallo, gibt es schon die Überlegungen, dort auch in gewisser Weise auf Historie zurückzugreifen, auch hinsichtlich der Jahreszeiten bzw. hinsichtlich der Fächerkontraste oder des Zusammenwirkens? Da gab es ein sehr bekanntes Modell in Dresden an der 45. Volksschule, die heute das Hülße-Gymnasium ist. Dort hatte der weltbekannte Rosenzüchter Theodor Simmgen eine Arbeitsschule integriert, die in 1927/28 erst gebaut wurde. Und er hat nicht nur seine Rosen, sondern auch andere Pflanzen in dem dem Schulgarten angebaut, angepflanzt. Und aller Unterricht in der Schule konzentrierte sich auf den Schulgarten, also auf die Pflanzen das ganze Jahr über, das in jeder Sprache, das in Passung zu jedem Unterrichtsfach. Vielleicht ist das mal andenkbar und das liegt alles konkret vor. Auch was er damit geschafft hat. Also er hat nicht nur seine Rosen gezüchtet, er hat auch eine Pflanzenschule in Pillnitz betrieben. Da gibt es also viele Dinge, die da Anknüpfungspunkte sein können und die Sache vielleicht noch ein bisschen bunter machen.
JProf. Markert: Das ist eine sehr schöne Anregung. Vielen Dank dafür. Das war mir jetzt persönlich ehrlich gesagt noch nicht so bekannt. Ich bin seit, also mitten in Corona gekommen. Da war noch wenig erstmal so mit vielen Leuten kennenlernen. Aber so ein Gymnasium wäre auf jeden Fall interessant auch glaube ich für das Fach Geografie. Berufsbildende Schulen da ist das, gibt es ja wahrscheinlich auch für Landwirtschaft und Gartenbau. Aber da wo Ernährung und Hauswirtschaft sich abspielt, die haben dann meistens so vielleicht, wenn sie Brauer und Mälzer mitausbilden, haben dann so Hopfen oder so was, dann sind es eher solche Pflanzen. Aber das ist sehr interessant. Da können wir gerne noch mal nachforschen, auch inwiefern die das heute noch integrieren in, im Schulalltag und inwiefern das heute noch gelebt wird. Also was wir auch machen, sind Exkursionen an Schulen. Also wir werden zum Beispiel nächste Woche. eine, übernächste Woche eine Schule in Leipzig besuchen, die auch so einen Acker etabliert hat. Und dann wäre das auch noch mal eine schöne Anregung hier für eine Exkursion innerhalb Dresdens. Danke.
Dr. Reutemann: Wissen Sie, ob die das auch noch heute pflegen? Dieses dieses System, was Sie gerade beschrieben haben, dass so alles von den Pflanzen ausgeht, dieses System?
Gast: Äh, das hat jetzt einen neueren Status. Und zwar hat die Universität Freiberg sich dieser Schule angenommen und die werden mit ihren Ausrüstungsmaterialien der Universität, mit den Ausbildungszielen sich ihre Studenten dort heranziehen. Und die Eltern und Schüler wissen also mit Schulbeginn, wo es hingeht, was der Weg sein kann und was und was dann die ganz großen Perspektiven ermöglicht.
Gast: Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das Hülße-Gymnasium in Dresden ist es dann auf jeden Fall nicht. Weil an der Schule war ich und da ist es auf jeden Fall nicht passiert. Ja genau, Sie machen das auf jeden Fall heute nicht mehr. Aber eine Schule, die das in Dresden ganz stark macht, ist die die Montessorischule in Striesen, die Montessori-Huckepack Schule. Die haben sowohl einen eigenen Schulgarten und da immer eine FÖJ-Stelle, als auch ein Waldgrundstück in Struppen, das sie bewirtschaften. Und genau das wäre glaube ich ganz spannend.
JProf. Markert: Danke auch für die Anregung.
Dr. Reutemann: Genau.
Moderator: Was ist das denn, wenn ich jetzt in so einem Garten als Studierender oder Studierende komme? Was ich mir praktisch mitnehme, wofür werde ich da sensibilisiert?
Dr. Reutemann: Ja wofür werde ich sensibilisiert? Das ist eine gute Frage. Es sind verschiedenste Sachen. Ich nenne vielleicht mal zwei. Dann machst du weiter. Was mir jetzt so einfällt ist also erstmal, dass man weiß, wie ist eine Fruchtfolge. Das einfach diese praktischen Erfahrungen da sind, dass man weiß, was man anpflanzt. Wir haben da auch die unterschiedlichsten Erfahrungen der Studierenden. Da kann eigentlich wirklich jeder kommen. Er muss keine Erfahrung damit haben. Aber es gibt auch Studierende, die kommen aus der Landwirtschaft, von ihren Eltern beispielsweise. Da passt das dann auch sehr gut. Und sie nehmen so für sich Inspiration mit, wie man das vielleicht mit Schülerinnen und Schülern umsetzen kann.
JProf. Markert: Weiterhin hoffen wir natürlich, dass sie sich auch diese Wichtigkeit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte jetzt Freitag ein Blockseminar, wo ein Studierender war, der in der allerersten Kohorte mit dabei war im Sommersemester 2022. Und der hat mir noch mal rückgemeldet. Er hat tatsächlich auch für sein Privates was mitgenommen. Der baut jetzt auf seinem Balkon auch selber Pflanzen an, hat sich damit vorher sonst nicht so beschäftigt. Und hat mir aber auch nochmal rückgemeldet, dass er das ganz wichtig findet, dass sie dieses Thema jetzt in die Lehramtsausbildung so integriert ist. Aktuell befinden wir uns damit noch in so einem Zusatzmodul für die Lehramtsausbildung und hat selber noch mal. Also die Studierenden, die es selber absolviert haben, wünschen sich eigentlich, dass wir es mehr in diese grundlegende Lehramtsausbildung mit integrieren. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. Aber das ist auch noch so eine Idee. Außer der Idee auch nicht Lehramtsstudierende mit hier hineinzuholen. Und was sie auch noch lernen, ist so dieses ähm, was einer BNE auch so inhärent ist, Verantwortung zu übernehmen. Die müssen sich ja selber kümmern um diesen Acker, die müssen sich absprechen, müssen miteinander kommunizieren, sie müssen es aushalten, wenn andere anders damit umgehen. Sie müssen das miteinander regeln, um dann am Ende auch wirklich die Früchte ihrer Arbeit ernten zu können. Also jetzt sind die Salate und die ersten Erdbeeren reif, dann merken sie okay, es hat geklappt. Aber auf dem Weg dahin ist es ja eben nicht einfach. Man muss miteinander kommunizieren. Sind 20 Jugendliche oder 20 junge Erwachsene, die da arbeiten. Und dann ist es noch so, der Plan, den man sich gemacht hat, geht ja nicht immer auf. Also jedes Jahr bringt andere Witterung mit sich. Wir haben jetzt selber beobachtet, im Sommersemester 2022 lief das anders mit der, mit den Pflanzen, wie die geworden sind, als wenn es in diesem Sommersemester auch damit müssen sie dann klarkommen. Vögel sind auch dran interessiert an den Früchten, die da wachsen oder Hasen zum Beispiel. Auch damit muss umgegangen werden. Also so dieses: Ich mache mir einen Plan und der wird aber vielleicht von jemandem durchkreuzt. Und dann muss ich wieder gucken, wie ich damit umgehe. Eine Situation verläuft anders, als ich sie erwartet habe. Und wie reagiere ich jetzt? Das sind alles so Dinge, die einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ja zu eigen sind und die wir denen auch mit vermitteln wollen, den angehenden Lehrkräften. Da wir hier bei Bildung für nachhaltige Entwicklung um nichts weniger reden als der Umgang der Menschheit mit der Klimakrise, die wir gerade haben, die wir ja nicht gerade verhindern, sondern wir sind gerade dabei, mit der Klimakrise umzugehen.
Dr. Reutemann: Vielleicht, vielleicht auch noch eine Ergänzung, weil du sagtest, dass ein Studierender sich freiwillig sozusagen weiter engagiert in dem Zusammenhang. Wir haben auch in der Geografie jetzt Studierende, die dabei gewesen sind im letzten Sommersemester, die sich dann sehr für das Thema an sich weiter engagieren. Und das führt dann so weit, dass sie direkte Ausbildungen machen für BNE. Eine Studierende, die fliegt jetzt, was sie nicht so gerne möchte, nach Zypern. Wo direkt also Lehrkräfte weltweit zusammenkommen und schreibt dann auch ihre Staatsexamensarbeit bei uns zu diesem Thema. Und das ist dann schon sehr spannend, wenn man dann immer wieder hört: Ja, die Inspiration habe ich von dem Seminar mitgenommen an der Stelle.
Moderator: Okay, das hört sich sehr spannend an, was man damit erreichen kann und auch, dass das so frei ist. Ich bin an der frischen Luft ja als Studierender. Ich erfahre mal was wir ja, was mit meinen Händen. Da habe ich auch noch mal ein anderes Medium, das mit zum Begreifen hilft. Ähm, wie ist das denn? Nach welchem Prinzip bewirtschaftet ihr denn den Garten? Oder nach welchen Grundlagen oder Regeln muss sich der Student dann halten? Oder?
JProf. Markert: Also das ist jetzt eigentlich so ein bisschen Aufgabe des Acker e.V. sozusagen. Die kümmern sich darum, das ist eine Permakultur, die da angelegt wird. Also man tut halt Pflanzen nebeneinander anbauen, die unterschiedliche Schädlingsgruppen haben, um sich dann gegenseitig zu schützen. Ähm, ja, Herr Neinhuis kann bestimmt noch mehr ergänzen, als ich das jetzt kann. Genau aus dem Grund haben wir Expert:innen des Acker e.V. vor Ort und die machen das dann, setzen es dann um, mit den Studierenden. Und es werden vor allem auch heimische Sorten auf jeden Fall angebaut. Wir jetzt keine exotischen Sorten oder irgendwie so was an.
Dr. Reutemann: Ja also so Starkzehrer-Pflanzen wie die Tomate, die wurde jetzt zum Schluss erst ausgebracht. Wir haben auch um das den Studierenden noch zu zeigen, dass eben da ein System drinsteckt, hat jetzt die Ackercoachin, das fand ich persönlich sehr interessant, so ein Experimentierfeld angelegt. Wo einfach irgendwelche Pflanzen hinkamen und man dann sehen wird, man sieht es eigentlich sogar schon ein bisschen, dass sie, wenn die nicht zueinander passen, dass sie dann halt auch nicht gedeihen. Das ist so das Experimentierfeld bei uns und das, da kann man sich auch viel dann davon mitnehmen. Um zu sehen also ich muss schon drauf aufpassen, wie die Pflanzen entsprechend zusammenpassen, aber in dem Bereich sind wir auch gerade dabei, uns selber das mit anzueignen, dass wir da dann selber fit sind. Um diese Sachen auch immer stärker in die Hände der Studierenden zu legen, dass wir da die Materialien erarbeiten.
Moderator: Okay, also ist der Permakultur das Angesagte, der Gärtnermodus, den man heutzutage berücksichtigt, um mit der Klimakrise auch zurecht zu kommen oder ihr ökologisch sinnvoll zu antworten?
Dr. Reutemann: Genau. Also es wird ja gemulcht an den, auf den kleinen Beeten und es wird auch versucht sehr wenig zu gießen in dem Zusammenhang. Hast du noch. Nee, nee, das sind so die zwei Sachen damit. Also das sind so wichtige Dinge, die sich auch die Studierenden dann mitnehmen an der Stelle, dass man eben sehr viel mulchen muss, um wenig zu gießen und dass man das den Pflanzen auch antrainieren kann.
Moderator: Hier gibt es da mal eine Publikumsfrage.
Gast: Ich habe in dem Zusammenhang mal eine Frage. Wir stehen ja jetzt auch vor dem Problem, dass wir die Biologie Lehrerausbildung beginnen und das Thema ja auch sehr intensiv bespielen wollen. Dieses Thema hat ja zwei Ebenen. Auf der einen Seite die individuelle Ebene des Studenten, der jetzt da irgendwie seinen Acker betreut. Sich mit Dingen vertraut macht, die er vorher so nicht kannte und dafür für sich selber persönlich erst mal viel mitnimmt in der, im Idealfall. Die zweite Ebene ist ja: Der wird dann irgendwann Lehrer sein in der Schule. Wie viel davon kann man eigentlich in den Alltag retten, in, unter Bedingungen, wie sie heute an sächsischen Schulen, bleiben wir mal in Sachsen, herrschen. Sprich Lehrermangel, enormer Druck auf die Lehrkräfte. Ist das unter den gegenwärtigen Bedingungen überhaupt möglich? Oder leben wir da in einer etwas idealisierten Welt der Universität, wo wir uns was bauen, was wir ganz toll finden, aber es scheitert dann am Ende vor Ort?
JProf. Markert: Genau. Und wir haben, wir haben die Erfahrung noch nicht. Unsere Studierenden machen das jetzt. Wenn die rausgehen, wir hoffen wir bleiben mit ihnen Kontakt und haben dann diese direkte Rückmeldung. Das gibt es ja noch nicht. Wir haben ja erst genau letztes Sommersemester angefangen und wir hoffen einfach, dass die diese enorme Begeisterung, die wirklich da ist, mitnehmen können, mitretten können und dann eventuell Kolleg:innen anstecken können. Es gibt ja bestimmte Schulformen der, die Grundschule, die haben den Sachunterricht, die haben in der Regel auch so eine Fläche, da ist das einfacher zu etablieren. An den beruflichen Schulen Ernährung und Hauswirtschaft, die haben auch manchmal so Flächen. Gymnasien könnte es schon an der Fläche auch einfach scheitern, könnte es schon schwierig sein. Und und dann ist es uns auch wichtig, dass sie eben diesen Gedanken für eine BNE auch mitnehmen, die sie ja nicht unbedingt nur an einem Acker oder einem Schulgarten wieder umsetzen müssen. Also wir bringen ja auch andere Themen mit rein und dass sie vielleicht einfach die Wichtigkeit begreifen, wie wichtig es ist, eine BNE mit umzusetzen. Diese Themen mit den Lernenden, mit den Schüler:innen zu diskutieren und zu besprechen. Und vielleicht kristallisiert sich das dann auch ganz anders, dann nicht an einem Schulgarten aus, sondern an da werden Sensoren aufgestellt, um irgendwelche Gebäude-Wärmeemissionen zu messen oder so. Auch das sind ja Themen, wie man dann eine BNE begreifbar machen kann für Schüler:innen. Wir machen es ja hier jetzt eben an dem Acker, weil es total schön ist, gerade für meine Professur, wo Ernährung eine ganz wichtige Rolle mitspielt. Aber das ist halt ein Thema davon. Und die sächsischen Schulen, das ist ja auch wir haben die Landesstrategie für BNE, wir haben in der TU Dresden ist BNE auf jeden Fall in der Grundordnung und eine wichtige, auch ein wichtiges Thema. Also wir kommen an diesem Thema einfach nicht mehr vorbei. Und unsere Studierenden, die eben angehende Lehrer:innen sind, die dann jetzt in fünf, sechs Jahren vielleicht in der Schule wirklich ankommen, die werden mit dem Thema ja weiterhin konfrontiert sein. Das ist ja ein Thema, womit sich auseinandersetzen müssen und worauf sie ihre Schülerinnen vorbereiten müssen. Und da ist es dann hoffentlich hilfreich. Dann greifen Sie hoffentlich darauf zurück. Ja, aber ja, es ist ein extra Aufwand aktuell auf jeden Fall noch. Ja, aber wir sind auch, auch im Ministerium ist BNE als Thema angekommen. Und vielleicht ändern sich auch an Schulen irgendwann Bedingungen, um das besser umsetzen zu können. Das ist die große Hoffnung.
Dr. Reutemann: Wenn ich das noch ergänzen darf. Also die Herausforderungen in den Schulen sind riesig momentan. Das steht völlig außer Frage. Aber oftmals ist es auch so, wenn jemand mit so einer Idee kommt, dass man ihn auch erst mal gewähren lässt. Wenn man da dafür brennt, dass man das dann vielleicht auch umsetzt. Und wir wollen eben diese Begeisterung für den Acker auch zeigen, dass es das wirklich auch gibt an weiterführenden Schulen. Und da sind wir in dem Beispiel an einer Schule in Leipzig, wo das auch durchgeführt wird und dass man mal sieht, dass es auch in der Realität machbar ist, an einer weiterführenden Schule mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, mit all den Herausforderungen, die auch dort sind. Also wie hält man Schülerinnen und Schüler bei der Stange? Wie kann man sie motivieren, dass sie länger als einen Sommer da mitarbeiten? Das wäre ja auch so eine Sache. Denn je älter sie werden, umso weniger Interesse ist manchmal leider da, um den Acker zu bewirtschaften an der Stelle. Aber deshalb versuchen wir halt auch so Beispiele mitzuzeigen, dass das auch nicht alles Utopie ist an dieser Stelle.
Moderator: Ja nochmal eine Publikumsfrage.
Gast: Auch dafür gibt es ein Beispiel bei Dresden ganz nahe von Dresden, und zwar die Kurfürst-Moritz-Schule, in die Kurfürst-Moritz-Schule in Moritzburg, ist in Moritzburg. Also gleich neben Dresden, gehört vom Stadtteil eigentlich noch zu Boxdorf. Und das ist eine Gemeinschaftsschule, eine sehr moderne Gemeinschaftsschule, die eigentlich ein musisches Profil hat. Aber es gibt dort auch einen Schulgarten, und das wird von den Schülern sehr, sehr positiv darüber berichtet, über die Erfahrung im Schulgarten mit allem, was dazugehört. Also es ist alles sehr nahe.
JProf. Markert: Ja, also es gibt sie, diese positiven Beispiele und man kann nur hoffen, dass man die jetzt mehr in die Fläche tragen kann, auch wenn man das wirklich direkt gleich mit in die Lehrer:innenbildung integriert. Wir werden es rausfinden.
Dr. Reutemann: Ja, und wir wollen es auch in der Professur für geografische Bildung eben in die bodenständige Ausbildung mit einbringen in als außerschulische Lernorte, dass dann Studierende auch direkt aus mehreren Bereichen auswählen können. So sind unsere Vorstellungen erstmal und wo eben eins der Acker ist, um sich da mit Konzepten auseinanderzusetzen, sodass man dann doch schon ein bisschen tiefer dort eintauchen kann in den Bereich.
Moderator: Ähm für euch ganz persönlich. Wo seht ihr denn dann euch mit dem Garten in einigen Jahren? Wollt ihr den auch so öffnen oder was ist eure Vision dazu?
JProf. Markert: Wir haben schon Vorstellungen, wie das so weitergehen könnte. Und wir hatten ja auch schon, glaube ich, so angedeutet. Also das, was Frau Reutemann gerade gesagt hat. Wir sind auch dabei, dass wir haben jetzt Studienordnungen wurden alle überarbeitet hier im Lehramtsstudium Wir sind auch dabei das aus diesem Ergänzungsbereich wie es gerade heißt, also dieses Zusatzbereich so rauszunehmen, eben in die grundlegende Lehramtsausbildung. Also wir hoffen, dass dann mehr Studierende noch unserer Studiengänge, also unserer des Faches Geografie und der beruflichen Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft, auf jeden Fall dieses Seminar besuchen und diesen Acker und das Konzept auf die Art und Weise hier kennenlernen. Und dann eine Vision ist eben auch, das wirklich noch zu öffnen für Studierende außerhalb der Lehramtsstudiengänge. Das ist so ein bisschen noch herausfordernder, weil die BNE da ja für die eine andere Rolle spielt. Den sollte man die schon mit vermitteln, aber für die, die brauchen die für ihre eigene spätere Tätigkeit vielleicht nicht so. Also das müssen wir uns noch mal genauer überlegen. Aber das sind auch Studierende, die später auf jeden Fall in ihrem Beruf mit Auswirkungen der Klimaveränderung zu tun haben werden. Und auch für die ist es wichtig, da schon eine Idee zu bekommen, was da mit reinspielt und auf was es da, um was es da geht. Wir haben natürlich hier eine begrenzte, also ob sich das alles immer an diesem Bildungsacker kristallisieren wird, ist auch noch nicht klar, weil auch das ist eine begrenzte Fläche. Wir können die Seminare nicht unendlich groß machen, es müssen ja auch alle was zu tun haben. Also da müsste man vielleicht auch dann noch überlegen, dass man andere Orte mit etabliert und das ist auch eine Herausforderung. Also wir haben es gerade gehört, dass das Schulsystem auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert und auch gerade eben an seine Grenzen kommt. Nicht nur in Sachsen, ganz deutschlandweit. Und auch das universitäre System ist ja ein System, was mit 90-Minuten-Slots arbeitet und der Seminarraum ist der typische Lernraum erstmal. Also auch das war und ist noch eine gewisse Herausforderung. Ich denke das ist eine Erfolgsstory, so wie es gerade aussieht, aber es hat gut geklappt. Und um neue solche Räume zu etablieren, solche Lernorte, wären dann wieder Ideen. Und dann braucht man Kolleginnen und Kollegen, mit denen man da gut zusammenarbeiten kann, wo man dann solche Sachen etablieren kann, die eben nicht so ganz dem entsprechen, was aktuell etabliert ist. Ja.
Dr. Reutemann: Vielleicht ist auch noch so eine Vision, dass wirklich diese, dieser praktische Teil der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen ankommt. Dass man sich dann damit eben auseinandersetzt über unsere Studierenden und das so eine Vision wäre für mich auch, dass sich dieses Seminar, was ja noch stark im Ergänzungsbereich jetzt ist in beiden Bereichen, dass sich das ganz stark verstetigt. Also das es wirklich so ein Teil der universitären Ausbildung wird.
Moderator: Kann man anhand der aktuellen Brisanz unserer Weltlage, unserer Einschätzung des Klimas her auch sagen, dass die die Studierenden oder die die Landschaft der Universitäten auch eine ethische, ja Mitwirkungsaufgabe erfüllen können, wenn sie die Lehrräume hier ein bisschen öffnen und die Leute, die Studierenden, draußen unterrichten und sie mehr mit der BNE in Kontakt bringen?
JProf. Markert: Also ja, auf jeden Fall. Und ich denke, so versteht sich Universität und Hochschule auch, dass sie eben wirken möchte in die Gesellschaft hinein mit dem, was dort passiert, in Lehre und Forschung. Und da ist das jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Lehrer:innenbildung derartig auszugestalten, um dann direkt auch in die Gesellschaft mit hineinzuwirken. Das ist auch für uns das Schöne, dass wir hier die Möglichkeit haben, im Botanischen Garten zu sein, der ein öffentlicher Ort ist. So kommt eben diese Arbeit auch, wird in die Öffentlichkeit getragen. Also Besucher:innen, die den Garten begehen, laufen vielleicht am Acker vorbei und lesen davon und haben dann eine Idee: An der TU Dresden ist so was in die Lehramtsbildung integriert. Eventuell. Also auf jeden Fall hat Hochschule diese Aufgabe und nimmt sie auch auf jeden Fall wahr. Wir haben auch, wie gesagt, ich habe schon gesagt, in den verschiedenen Ordnungen der TU Dresden Grundordnung und im Leitbild ist die BNE auch schon verankert. Und für die Lehrer:innenbildung ist das auch ein ganz großes Thema, was in sämtlichen, von allen Lehrerbildner:innen eigentlich auch zurzeit stark gesehen wird und stark überlegt wird, wie wir das mehr noch stärken können. Ja.
Moderator: Wieder eine Publikumsfrage.
Gast: Ja, ich wollte euch noch mal fragen, wie viel mehr Aufwand im Gegensatz zu anderen Lehrveranstaltungen ihr beim Bildungsacker habt? Wieviel, wie groß der Engagementteil ist und wie und wie man dann quasi im. Also die Frage zielt darauf ab, wie man quasi auch andere Kolleg:innen aus anderen Didaktiken quasi überzeugen kann, genau solche Projekte zu starten und was es da vielleicht auch Universität strukturell bräuchte?
Dr. Reutemann: Ja, das ist eine total spannende Frage. Also der Aufwand ist schon groß, aber wir machen ihn sehr gerne, wenn man das so sehen kann. Also man nur so ein minimales Beispiel. Wir haben, unsere Ackercoachin hat zu uns gesagt, wir sollen uns einen besonderen Mulch organisieren und das hat uns fast eine Woche gekostet, um ihn dann nicht zu haben und eine andere Variante zu nehmen. Also es gibt da auch mal Misserfolge an der Stelle. Aber wir zählen eigentlich die Stunden nicht, wie wir das, das der Acker funktioniert, sondern wir freuen uns daran, wenn die Studierenden auf dem Acker sind und vom Acker begeistert wieder in die anderen Seminare gehen. Wir haben für uns, wir sind ja nun auch zwei Fakultäten auch gute Möglichkeiten gefunden, dort zu arbeiten über Videokonferenzen, was ja heute kein Problem mehr ist, dass man da die Termine sich einstellt und wir planen dann auch immer gemeinsam.
JProf. Markert: Genauso du hast jetzt den Organisationsaufwand schon mal so ein bisschen. Also man kann sich da gut, es sind größerer Kommunikationsaufwand auf jeden Fall, wenn man unterschiedliche Fakultäten, dann der Acker e.V. mit dem Honorar, dieses Geld, was da extra da fließt, das muss man auch jedes Mal einwerben. Wir hatten letztes Jahr hat uns die Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden unterstützt. Dieses Jahr haben wir den Antrag bei der Kommission Umwelt gestellt, die uns da unterstützt haben. Also das ist jetzt in der Anfangsphase muss das immer neu eingeworben werden. Vielleicht kann man das noch mal anders verstetigen, dass diese, dass solche Sachen dann kommen. Und weil ansonsten wenn wir Kolleg:innen anfragen, wir hatten ja auch gesagt wir haben so Referentinnen drin, die sind da eigentlich sehr offen für. Das ist ja dann an der Stelle auch nur so ein einmaliger Beitrag sozusagen. Aber es ist schon eine Herausforderung, auch so, wenn unterschiedliche wissenschaftliche, also Ideen von unterschiedlicher wie funktioniert Wissenschaft, wie funktioniert Lehre dann aufeinandertreffen, wenn man das dann auseinanderdividieren muss. Hm, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, so und so viel Mehraufwand. Der Mehraufwand ist glaube ich am Anfang auch, erst mal loszugehen ist wahrscheinlich die Herausforderung. Und wenn das dann gut eingestielt ist, wird es auch wieder weniger Aufwand sozusagen. Und nicht nur wir als Dozentinnen haben Aufwand, die Studierenden haben ja auch eine Art Mehraufwand. Also die müssen, dieser Ort hier, wir haben immer 20 Minuten zwischen den Lehrveranstaltungen an der TU Dresden, die müssen dann hier rausfahren zum Botanischen Garten, der eigentlich jetzt nicht so mitten zwischen den Hörsälen oder so liegt. Also es ist noch mal ein gewisser Weg sozusagen. Dann müssen die, es reicht nicht aus, sich eben im, zu der einen Seminarzeit nur zu kümmern. Die müssen das wirklich begreifen, dass sie sich auch hier verantwortlich fühlen und noch zwischendurch in ihrer Selbststudienphase noch mehr kommen und sich das wirklich um diese Fläche noch mit kümmern. Also es ist so ein anderes Denken auch von: Wie funktioniert vielleicht mein Lernen hier auch an der Universität? Das erfordert auch von Studierenden, also es ist nicht nur dass wir auf Dozenten sich, auf Dozentinnenseite uns da so ein bisschen umstellen müssen, vielleicht andere Dinge oder Dinge anders laufen als in anderen Lehrveranstaltungen. Auch die Studierenden müssten das annehmen. Bisher ja, es ruckelt sich. Man trifft manchmal auf Schwierigkeiten, die man nicht so erwartet hätte. Aber auch das, denke ich, wird sich ja hoffentlich besser gestalten, wenn dann mehr Leute solche Extraangebote vielleicht machen. Mal andere Wege gehen, mal fakultätsbereichübergreifend mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, dass dann auch Verwaltung eventuell da andere Wege sieht und sich dran gewöhnt, dass nicht alles so läuft, wie es bisher immer gelaufen ist. Das muss man einfach immer wieder probieren und angehen.
Dr. Reutemann: Bei deinen Ausführungen ist mir noch eingefallen, wir haben ja auch studentische Hilfskräfte, die jetzt mit aktiv sind. Das ist auch schon mal wieder so ein Schritt, dass der Mehraufwand etwas geringer wird, weil die wirklich ganz wichtige Aufgaben übernommen haben. Das ist zum einen eben auch die Materialien zu besorgen, die wir brauchen, dass wir das nicht mehr alleine machen müssen. Dann auch die eine Studierende, die hat eine Ausschreibung jetzt vorgenommen für einen Wettbewerb, in dem wir das Projekt gerne einreichen wollen. Das man also auch da immer ein bisschen breiter schaut als nur auf die 90 Minuten, in die gerade das Seminar passt, an der Stelle.
Moderator: Ich habe nochmal eine Nachfrage zu den Methoden, die dann dort angewendet werden, weil das betrifft quasi auch den Arbeitsaufwand als Studierender. Ich bin dort ja nicht nur der Teilzeitgärtner, als den ich da mal einspringe, sondern Sie nannten Frau Reutemann einen Elevator Pitch. Oder es gibt Reflexionsaufgaben, die mit an die Hand gegeben werden.
Dr. Reutemann: Da würde ich vielleicht was zum Elevator Pitch sagen und du zum Konzept? Also der Elevator Pitch, das ist eine sehr schöne und knackige Variante, um eine Idee vorzustellen. So wie das der Name schon sagt, dass man in den Fahrstuhl steigt und eine begrenzte Zeit hat, bis der Fahrstuhl oben angekommen ist. Und da muss man jemanden sein Konzept verdeutlicht haben. Und das ist jetzt in 14 Tagen werden, das wieder die Studierenden gestalten, diesen Elevator Pitch und das ist immer wirklich sehr spannend zu sehen, mit welchen Ideen die da auch herangehen. Dass man wirklich versucht, da das nicht nur ich habe vor ein Konzept so und so zu gestalten, sondern dass sie da wirklich sehr kreativ herangehen. Und das bringt den Studierenden natürlich auch wieder sehr viel in ihrer eigenen Ausbildung, dass sie selber diese Methode anwenden und wissen, was da eben dazugehört.
JProf. Markert: Vielleicht ergänzend dazu will ich auch noch mal sagen dieses Elevator Pitch, das ist ja was, was so aus der Wirtschaft kommt, so ganz schnell irgendwie eine Idee, eine Projektidee voranzubringen, zu pitchen. Halt so höher, schneller, weiter. Was ja genau eigentlich auch ein Punkt ist, den wir mit den Studierenden diskutieren, den wir eigentlich infrage stellen wollen. Und da ist das ganz nett, dass wir das jetzt für das BNE-Seminar, diese Methode mit okkupiert haben sozusagen. Und die jetzt mal in einem anderen Kontext noch mal nutzen. Das ist so eine Sache, die, die machen. Dann haben, bieten wir Reflexionsanlässe an, also uns ist auch ganz wichtig, dass sie eben darüber nachdenken, was sie dort tun. Sicherlich für sich selber persönlich, was sie da mitnehmen. Aber auch was nehme ich jetzt mit als angehender Lehrer, angehende Lehrerin, Was kann ich hier eventuell nutzen, um dann später in meiner Lehrtätigkeit noch einzusetzen? Also wir haben da verschiedene Leitfragen gestellt auf der Lernplattform Opal, das fiel vorhin schon mal, ist diese Lernplattform. Dann haben die die Möglichkeit, die müssen fünf aus acht oder neun möglichen Reflexionsanlässen dann bearbeiten. Auch das ist Teil der Prüfungsleistung zum Beispiel, um die noch mal so ein bisschen ins Denken zu bekommen. Die denken auch so ganz viel drüber nach. Aber es ist noch mal was anderes, wenn ich das auch wirklich nochmal ausformulieren muss und noch mal aufschreiben muss. Und ein anderer Teil der Prüfungsleistung ist dann noch, dass sie am Ende, nach dem einen Semester oder zwei Semestern, ein Lehr-Lern-Konzept erstellen wollen, wie eben die das Thema BNE selbst in der Schule aufgreifen würden. Wo sie eben auch eine Ackerfläche mit integrieren sollen in dieses Lehr-Lern-Konzept. Und wir haben die Prüfungsleistung, die können selber wählen, ob sie eben nur die Reflexionsanlässe bearbeiten, dann kriegen sie einen Leistungspunkt. Wenn sie ein Semester teilnehmen, Reflexionsanlässe bearbeiten und so ein Konzept erstellen und diesen Pitch machen, bekommen sie drei. Und dann sind es eben fünf, wenn sie es über zwei Semester machen. Also auch da sind wir völlig offen, machen das mit Absicht auch so. Um den das, um den selber, dass sie selber entscheiden können: Ich will das so machen, das ergibt jetzt für mich mehr Sinn, wenn ich das so für mich ausgestalte. Um dann auch so eine Eigenverantwortung wieder mit reinzubringen. Dann steigen die sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester ein. Das heißt, wir haben immer Studierende, die schon in dem Semester davor mit auf der Fläche waren. Können sich also auch Dinge weitergeben, was auf der Fläche passiert ist und so ein bisschen miteinander austauschen. Also das ist eigentlich ganz schön, dass das so fluide dann ineinander übergeht sozusagen. Ja.
Dr. Reutemann: Und das machen auch immer mehr Studierende so, dass sie sowohl, also beide Semester belegen wollen, um mal zu sehen, wie es funktioniert. Gerade die, die halt im Winter anfangen und man hat dort die Planung der Beete vorgenommen, dann will man das ja sehen, wie sich das umsetzen lässt. Aber es kann genauso gut eben spannend sein für die Studierenden, die jetzt aktiv sind. Das, was mache ich eigentlich mit so einer Ackerfläche im Winter, auch dann später mit Schülerinnen und Schülern. Die muss man ja auch dann motivieren, im Winter durchzuhalten.
Moderator: Ja, aber dann gibt es irgendwann eine Belohnung, oder? Da muss ich jetzt schonmal fragen, wann wird denn dann zusammen gegessen?
Dr. Reutemann: Das ist gar nicht mehr so lang. Ich glaube am 7., 6., 06.07. wird das sein? Da haben wir, gestalten wir voraussichtlich ein Doppelseminar, an dem mal das, was schon möglich ist, geerntet werden kann. Und wir bringen noch einige Sachen mit und würden dann an der Stelle, das, den Abschluss des Seminars gestalten. Das hatten wir auch schon letztes Jahr und es kam sehr, sehr gut an. Und da kann man so nebenbei noch sehr schöne Auswertungen gestalten. Also das ist immer Bestandteil unseres Seminarkonzeptes. Herr Neinhuis?
Prof. Dr. Neinhuis: Das Ganze kreist ja jetzt im Wesentlichen um den Acker hinten. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist natürlich ein größeres Feld. Jetzt als Hausherr hier, der die Fläche ja bereitstellt, aber natürlich auch eine möglichst breite Nutzung möchte. Welche Themen würden Sie sich denn wünschen oder vorstellen können, um wie man dieses Thema BNE hier im Garten noch erweitern könnte? Also was wäre eventuell noch an ergänzenden Angeboten denkbar, die wir hier auch als Botanischer Garten bzw. Fakultät Biologie vielleicht noch beisteuern können?
JProf. Markert: Also allein das Thema Biodiversität ist ja hier super zu erklären. Dafür gibt es ja die Voraussetzungen schon. Das kann man hier gut festmachen. Ähm, dann. Wir hatten auch schon mit Kollegen gesprochen, die so Landnutzung. Ich weiß nicht, ob die noch an der, die war bei der Geografiefakultät, die hat über Geräusche dann auch zum Beispiel erfasst wie viele Lebewesen, wie lebendig dieser Ausschnitt des Ökosystems da gerade ist. So was ist vielleicht auch noch ganz spannend, dass man dann, also ist ein botanischer Garten, aber dass man eben die. Die Nützlinge braucht es ja um die Pflanzen, dass die sich weiter vermehren können. Dass man das vielleicht noch mal so ein bisschen mit stärker macht. Ist Sie noch da? Es war eine Kollegin, die Frau äh, so das wäre, genau die Frau, genau Frau Professorin Cord war das. Die hat da ganz viel Sachen gemacht. Dann von den Lebensmitteln, wir haben jetzt, wir sprechen jetzt viel von Pflanzen, die nutzbar sind für Ernährung. Wir brauchen aber natürlich, um gutes Klima zu haben, auch Pflanzen, die wir nicht nur verzehren, sondern auch andere Pflanzen sorgen ja dafür, dass CO2 gespeichert wird und dass das einen Ausgleich erfährt. Also auch das könnte man noch mal stärker machen. Vielleicht inwiefern sich die Pflanzenarten dann unterscheiden von der CO2-Nutzung und Umwandlung dann. Vielleicht gibt es da noch Unterschiede? Da kenn ich mich jetzt selber zu wenig aus, weil ich nicht Botanikerin bin. Ähm.
Dr. Reutemann: Bring in den Schulgarten-Konzept, in das Schulgarten-Konzept, was sich ja jetzt entwickelt. Dass man das eben ganz stark, eben die Bildung für nachhaltige Entwicklung hier hineinnimmt und wo es ja auch schon einige interessante Ansätze gibt. Das fällt mir da noch ein.
JProf. Markert: Und dann das Thema der Landnutzung ist auch immer noch so ein großes Thema, aber da fällt mir jetzt nicht sofort ein, wie man das an dem Botanischen Garten noch mal gut abbilden kann. Also was nutzen wir Menschen eben für, zum Wohnen, für Fortbewegung und was pflastern wir hier zu auf dem Planeten? Das ist noch mal so ein wichtiger Punkt auch. Da wüsste ich jetzt aber nicht so richtig, wie man das am Botanischen Garten noch mal. Ne, ne.
Dr. Reutemann: Ja und Schülerinnen und Schüler werden ja schon durch die Botanikschule auch eingebunden. Vielleicht gibt es da auch noch Möglichkeiten stärker so diesen Nachhaltigkeitsgedanken noch mit aufzunehmen. Da kenn ich mich leider auch nicht in dem Konzept weiter aus, aber es wäre auch noch eine Möglichkeit.
Moderator: Ja, aber das ist doch schon einiges, wenn ich sage, ich bin vielleicht in der Stadt groß geworden und ich habe keinen eigenen Garten im Hinterhaus mit und hab mein Essen bis jetzt immer im Supermarkt gekauft. Dann ist es doch eine große Erfahrung, wenn ich einmal den Lebenszyklus mitgemacht habe hier, dass ich sehe, dass das permanent jeden Tag nicht nur ein Monitoring, sondern auch quasi meine Zuneigung braucht. Also mein Voraus-, und mein Vorausschauen und Vorausplanen. Und das kann ich natürlich in alle Bereiche übertragen. Das ist nicht nur für die Lehrer wichtig, das ist besonders schön, weil die es gleich wieder weitertragen können. Aber im Generellen ein sehr offenes Gut für uns, für alle und in jeder Hinsicht wichtig, das so zu betreiben. Gibt es für euch noch mal einen Werbeslogan vielleicht? Denn wir sind jetzt dann am Ende. Wenn ihr Studenten und Studentinnen mit noch ins Boot holen wollt?
Dr. Reutemann: Eigentlich brauchen wir keinen Slogan, weil sie noch kommen und die Plätze innerhalb von wenigen Minuten in Opal ausgebucht sind. Deshalb habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken über den Slogan gemacht. Vielleicht.
JProf. Markert: Wir hatten jetzt letztens so eine Lehramtsveranstaltung TEACHERMANIA und da hatte ich den CampusAcker auch, den Bildungsacker auch vorgestellt. Und da hatte ich dann so als Slogan "Lernen im Grünen", weil das wirklich draußen ist und das zieht noch mal sehr.
Moderator: Okay. Gibt es noch Fragen aus Seite des Publikums?
Gast: *Unverständig*
Dr. Reutemann: Das ist auch spannend. Ja.
JProf. Markert: Das ist das Nächste. Nicht nur die Selbstlernzeit im Semester, sondern auch die Selbstlernzeit in den Semesterferien. Also das ist ein öffentlich zugänglicher Ort, das wissen die auch alle und auch da müssen sie sich kümmern. Also die organisieren das wirklich selber in so einem Pad, dass dann jede Woche jemand kommt. Das hat in den letzten, in der letzten vorlesungsfreien Zeit ganz gut geklappt eigentlich. Also der, die müssen da noch gehen. Es ist auch noch Ernte abzuholen. Die Tomaten, die werden in der Regel erst in der vorlesungsfreien Zeit reif. Das passiert nicht vorher, also da müssen die weiter dranbleiben. Das ist ein bisschen auch eine Herausforderung. Nicht alle Studierenden leben ja auch hier, manche fahren auch nach Hause zu Eltern oder Familie. Die Lehramtsstudierenden haben immer noch so Praktika in, in Schulen dann auch. Die Schule geht ja dann wieder im August oder so los, wenn hier noch vorlesungsfreie Zeit ist. Dann sind die in Schule zu so Blockpraktika, also wirklich am Stück und machen da auch Unterricht. Haben also gar nicht die Möglichkeit vielleicht nach Dresden zu kommen. Das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, aber die haben sie das letzte Mal gut gemeistert und wir werden sehen, wie es dieses Mal läuft. Ja.
Dr. Reutemann: Es kristallisieren sich dann aber auch immer Studierende heraus, die das dann besonders machen. Man kann ja nicht sagen, dass das wirklich alle 20 mit der gleichen Begeisterung machen. Da gibt es schon welche, die dann das auch sich sehr verantwortlich fühlen, um den Acker dann weiter bis zum Ende zu begleiten. Aber dieses Problem haben ja auch die Schulen, die mit Acker e.V. zusammenarbeiten. Also da ist es auch so, die schreiben zum Beispiel Postkarten, dass die Eltern sich melden, wann sie da sind, dass sie halt auch mal gießen. Oder dass Schüler direkt sich verabreden, dass sie dann auch mal in den Schulgarten gehen. Das ist genau das gleiche Problem. Und da werden ja unsere Studierenden dann auch schon wieder sensibilisiert. Ich muss mir also Gedanken machen für die Zeit, wenn Ferien sind. Aber es ist wirklich eine wichtige Frage.
Moderator: Okay. Ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt rübergehen in den Bildungsacker. Dort kommen noch mal Fragen auf. Dort werden wir die Fragen beantworten. Für all jene, die online im Nachgang zuhören hört die Veranstaltung dann hier auf. Ich würde mich jetzt insofern einmal bedanken bei Frau Doktorin Simone Reutemann und Frau Professorin Jana Markert für das Referat, für die vielen Antworten, die ihr uns gegeben habt. Und auch noch mal für ja, an die Mithilfe des Botanischen Gartens und die Menschen, die sich dort vor Ort auch noch mit kümmern. An dieser Stelle machen wir jetzt Schluss und wechseln unseren Veranstaltungsort mal in die Livebegehung. Vielen Dank!
Das neue Bauen: Chance und Notwendigkeit - Prof. Dr.-Ing. Manfred Curbach
Das Bauen ist zurzeit für ca. 25 % des CO2-Ausstosses und für 50 % des Verbrauchs an Material verantwortlich. Da wir angesichts einer weiter steigenden Bevölkerung und großer Wohnungsnot nicht weniger bauen können, müssen wir anders bauen. Ein Mosaiksteinchen im Neuen Bauen ist der Carbonbeton, den einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet - Prof. Manfred Curbach- näher beleuchten wird.
Intro: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere". Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator Tobias Dombrowski: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, der Ersten der Reihe "Triff die Koryphäe unter der Konifere"! Mein Name ist Tobias Dombrowski. Ich begleite Sie durch die Veranstaltung durch, als Moderator der Dialogveranstaltung zwischen Wissenschaft und Bevölkerung, zwischen Austausch im Sinne von...ja, also hin zu Forschung, Fortschritt und wie ich das nennen möchte, dem allgemeinen Frohsinn der Wissenschaften. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal, da es ja Auftaktveranstaltung ist, einmal ein Dank aussprechen, auch an die Hintergrundstrukturen. Wir haben hier viele Mitarbeiter im Botanischen Garten, Gärtner, Handwerker, Techniker, ein großes Sekretariat, bestehend aus Steffi Hommel, Emily Göbel, Reinhild Müller, Michael Kaps und Cornelia Suchantke sowie eine tätige Leitung dem Direktor Christoph Neinhuis, ähm einer technischen Leitung aus Matthias Bartusch und Uta Lembcke und einer Kustodin und wissenschaftlichen Leitung Barbara Ditsch. An dieser Stelle dürft ihr gerne mal Applaus geben. Vielen Dank dafür. Das ganze Programm wird getragen durch das Vorhaben "Technische Universität im Dialog", gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Länder. Das heutige Thema ist: "Das neue Bauen: Chancen und Notwendigkeiten". Hierzu haben wir eine Koryphäe eingeladen, die neben mir sitzt. Die neben mir sitzt, man konnte das eben nicht hören. Herr Professor Dr. Manfred Kurbach, Guten Tag! Ich möchte Sie kurz einführen für die Menschen, die Sie noch nicht kennen. Und gleich dazu erwähnen wir haben telefoniert miteinander und im Vorfeld haben wir, konnten wir uns auf oder haben wir ein Du miteinander ausgemacht. Ich nehme das jetzt einfach mal mit hinein in das Gespräch. Nichtsdestotrotz, in der Recherche über ihre, über Ihre Person, habe ich eine riesige Vita gefunden und ich möchte nur mal ein paar Punkte durchgehen und benennen, was sie alles mitgebracht haben und durchgemacht haben. Sie sind geboren in Dortmund, haben ein Studium der Bauingenieurswesen in der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, waren anschließend eine Zeit lang in den USA an der Universität Princeton, haben dort Brückenbau in den USA zu diesem Thema geforscht und auch zu Robert Mayard. Dieser war ein Schweizer Brückenbauer mit, der mit dem Material Stahlbeton gearbeitet hat. Ähm. Da können wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen als Einstieg. Im Anschluss waren sie wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch bei dem bekannten Ingenieur Josef Eibl an der Universität Dortmund und promovierten 1987 an der Universität zu Karlsruhe. Seit 1994 sind Sie jetzt Inhaber des Lehrstuhls für Massivbau an der Technischen Universität Dresden. Jetzt gibt es ein Sammelsurium aus an Auszeichnungen und verliehenen Mitgliedschaften, wie zum Beispiel der Ehrendoktorwürde der Technischen Universität von Kaiserslautern, Mitwirkung an einer großen Anzahl an Projektkoordination und Verbundprojekten. Auch darüber werden wir sprechen. Und sie haben viele Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften oder Funktionen in verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften und Gremien inne. Zudem ein eigenes Ingenieurbüro Curbach Bösche Ingenieurpartner. Also vielen Dank für Ihr Kommen. Gerne auch ein Applaus hierfür. Das ist schon. (...) Genau Jetzt haben wir ein Gespräch zwischen Ihnen und eigentlich nicht zwischen mir und Ihnen, sondern zwischen unseren Gästen. Da möchte ich herzlich einladen. Jeder, der Fragen hat, darf sich gerne von mir aus gerne, dann ist es belebt, zwischendurch melden. Wir finden den roten Faden immer wieder zurück oder gegen Ende hin wird Zeit sein für Fragen. Ich würde gerne jetzt das Mikrofon einmal an dich weitergeben. Du darfst etwas zu dir sagen und wenn du möchtest, habe ich gleich eine Einstiegsfrage oder ein Einstiegsthema. Wir haben oder bauen immer noch mit Stahlbeton. Wann hat es dann angefangen? Und was könnten aus Ihrer Sicht Notwendigkeiten sein, die sich daraus ergeben ein anderes Material zu finden?
Prof. Manfred Curbach: Ja, vielen Dank für die netten Worte zur Einführung. Dazu sage ich nichts mehr. Sie haben jetzt genug über mich gehört. Wir könnten tatsächlich mal übers Bauen reden und über das Bauen mit Stahlbeton. Fangen wir mal mit Beton an. Da heißt es ja oft, die Römer hätten den erfunden und das wäre ja schon ein ganz altes Material. Die Römer haben es nicht erfunden. Es waren die Phönizier. Und wer weiß, ob es nicht vorher schon jemand war. Also wir haben tatsächlich erste Nachweise für etwas, nennen wir es mindestens Betonähnliches, von vor etwa über 8000 Jahren. Das heißt also, so lange gibt es schon einen künstlichen Stein. Die Römer haben das tatsächlich vervollkommnet. Es heißt so oft, die haben den Opus caementicium dann daraus gebildet. Und das sei dieses Wundermaterial, mit dem zum Beispiel der Pantheon gebaut worden ist. In Wirklichkeit waren die Römer schon viel cleverer, denn die haben nicht eine Betonrezeptur entwickelt, wie Vitruv das in dem einen Buch geschrieben hat, sondern die haben tatsächlich dem Beton, je nachdem, was für Materialien vor Ort waren, modifiziert. Und es gibt anderen Beton, der auf dem Gebiet des heutigen Deutschland entstanden ist als in Frankreich oder in Spanien. Also die waren schon ganz schön clever, aber das Bindematerial, das das alles zusammengehalten hat, der Kleber war im Wesentlichen Kalk. Kann sehr lange halten. Wissen wir auch. Wir wissen nicht, was alles die Römer noch gebaut haben und was nicht mehr steht. Das heißt also, man sollte nicht auf die Idee kommen, sagen der römische Beton, der war so haltbar, der hält heute noch. Nur die Bauwerke, die heute noch stehen, können wir da als Beweis heranziehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist auch so manches im Laufe der Zeit gealtert oder vielleicht sogar zurückgebaut worden im Sinne eines ganz hervorragenden Recyclings. Denn als die Wasserleitungen zum Beispiel nicht mehr verwendet wurden, haben die Bauern der Umgebung die ganzen Viadukte, die da standen, zurückgebaut und haben damit ihre Ställe gebaut. Ein ganz wichtiger Schritt war dann um das Jahr 1750 herum, wo ein neues Bindemittel entdeckt worden ist. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, der so genannte Portlandzement. Das ist tatsächlich eine etwas andere Entwicklung als der Kalk, wird schneller hart, wird auch härter. Und das war dann der Ausgangspunkt tatsächlich für eine noch häufigere Verwendung von Beton. Aber alles unbewehrt. Und dann gab es mindestens zwei Leute, die unabhängig voneinander entdeckt haben, dass man dieses ganze Material noch haltbarer machen kann, wenn man, wir nennen es mal Eisen dort hineinlegt. Das Eine war ein Gärtner in Paris, der sich geärgert hat. Monet hieß der, dass seine Blumenkübel immer wieder zerbrechen, und der hat tatsächlich dann solche Stahlringe da reingelegt. Das hat funktioniert. Er hat das zum Patent angemeldet, war auch wirtschaftlich eine Zeit lang damit relativ erfolgreich. Aber er hatte keine Ahnung, warum das funktionierte. Und da gab es einen Anderen: Lambo. Der hat sich immer geärgert, dass seine Holzboote, er hatte so einen kleinen größeren Bauernhof, seine Holzboote im Teich immer vermodert sind. Also hat er aus so einem dünnen Stahldraht und so einem betonähnlichen Material Boote gebaut. Der hat auch schnell begriffen, wie das zusammenhängt, war aber nicht so ein cleverer Geschäftsmann. War auch lange Zeit in Vergessenheit geraten. Jetzt kennt man so langsam die Geschichte wieder. Und das war eigentlich der Ursprungspunkt des neuen Stahlbetons. Und in gewisser Weise waren das zwei Materialien, die passten hervorragend zusammen. Zum Beispiel schützte der Beton, wenn er dick genug war, den Stahl, der innen drin lag, vor Korrosion. Das geht in dem Fall über den pH-Wert. Also der Beton selber ist eine starke Base, hat ein pH-Wert von zwölf, zwölf 1/2. Und auf die Art und Weise ist der Stahl innen drin vor Zutritt von Sauerstoff geschützt. So lange wie dieser pH-Wert so hoch bleibt. Wir wissen heute, und das ist noch nicht so alt die Erkenntnis, vielleicht 30-40 Jahre, dass durch das CO2 der Luft diese, diese diese Lauge carbonatisiert. Das heißt also, der PH Wert nimmt ab und die Sauerstofffront kann immer näher zum Stahl hinkommen. Und irgendwann ist diese Betondeckung, wie sie heißt, dann durchdrungen. Und dann schließlich kann die Korrosion beginnen. Für Innenräume gilt das weniger. Aber überall, wo Betonbauteile außen sind, kann es nach 40, 60, 80 Jahren dann zu der Korrosion kommen. Und jetzt ist das Blöde, dass der Stahl, wenn er rostet, ein höheres Volumen entwickelt, als er vorher hatte. Rost ist voluminöser als der Stahl vorher. Jetzt fängt dieser Rost an, von innen gegen den Beton zu drücken. Und dann schließlich gibt es irgendwann Abplatzungen. Das ist das, was man beobachten kann bei manchen Bauwerken. Und dann laufen irgendwann Rostfahnen runter, das ist nicht wirklich schön. Wir wissen heute Stahlbeton hält nicht ewig. Das ist sozusagen die Geschichte, aber du wolltest ja wissen, warum wir jetzt was anderes bräuchten. Um diesen pH-Wert im Beton zu erzeugen, zum Schutz des Stahls braucht man eben diesen Portlandzement und den darin enthaltenen Klinker. Bei der Herstellung des Zement, dieses Bindemittels wird Kalkstein angesäuert. Dabei entsteht aufgrund des chemischen Prozesses CO2. Durch den Prozess alleine sind das 2/3 des CO2, die bei der Zementherstellung entstehen. Jetzt ist das von den Mengen her, wenn man nur einen Kubikmeter Beton anguckt, nicht so wirklich wahnsinnig viel. Aber Beton ist nach Wasser das am häufigsten, oder damit also das zweithäufigste Material, was auf dieser Erde verwendet wird. Und allein deswegen, durch diese Zementmenge, die dabei erforderlich ist, ist der Beton oder die Zementherstellung besser gesagt für 7 bis 8 % des gesamten CO2 Ausstoßes auf der Erde verantwortlich. Wäre es ein Land, wäre es, glaube ich, das drittgrößte, der drittgrößte CO2-Ausscheider. Das heißt also, diese unglaublichen CO2 Mengen sind es, die uns heute Probleme bereiten. Heute ist es nur schön warm. Wenn man das über Jahre oder Jahrzehnte guckt, wissen wir: Das Klima wird wärmer. Wir haben jetzt bisher 1,2 Grad globale Temperaturerhöhung. Und wir wissen auch, dass es einen sehr engen kausalen Zusammenhang zu dem ausgestoßenen CO2 dort gibt. Das wurde schon in den 60er Jahren als Treibhauseffekt bezeichnet. Mittlerweile ist das sehr gut nachgewiesen, dass CO2 und Klimawandel eng zusammenhängen. Wir sind also tatsächlich gefordert anders zu bauen. Man könnte ja auch sagen: Naja, dann lassen wir den Beton halt weg, dann bauen wir eben nicht mehr mit Beton. Wäre ja eine Option. Gibt auch viele, die sagen dann lass uns alles mit Holz bauen. Wenn wir das, was wir jetzt im Moment aus Beton bauen, aus Holz bauen wollten, wäre die Erde sehr schnell abrasiert, und zwar in ungefähr einem Jahr. Und da müssen wir wieder 30 Jahre warten, bis das Holz nachgewachsen ist. Das heißt also, da wir außerdem noch eine wachsende Erdbevölkerung haben, können wir jetzt auch nicht weniger bauen. Auch die, die jetzt noch in den nächsten 20 Jahren geboren werden, haben das Recht auf ein würdevolles Leben und auf ein gesundes Wohnen und Arbeiten. Das heißt, die haben Ansprüche, die wir ihnen auch nicht verwehren können. Im Gegenteil, wir sollten sie ihnen erfüllen, denn sonst gibt es eine ganz große Bewegung plötzlich über die Erde. Die wollen wir auch nicht. Also wir können nicht weniger bauen, wir müssen anders bauen. Wir brauchen ein neues Bauen.
Moderator: Es gibt dann zusätzlich auch noch die Knappheit von Sand. Die, die du benannt hattest. Es benötigt auch eine andere Zusammensetzung für den neuen Stahlbeton von Grundmaterialien?
Prof. Curbach: Also Beton ist eigentlich ein 3-Stoff-Material. Sie brauchen Wasser, Zement und feste Zuschläge. Sand ist dabei ein großer Anteil. Und eigentlich könnte man sagen Sand gibt es doch genug in der Sahara, an den Stränden dieser Welt. In Deutschland. Dazu muss man wissen in Deutschland kommen wir nur an ungefähr 2 % des verfügbaren Sandes heran, weil bestimmte Flächen unter Denkmalschutz oder unter Naturschutz stehen. Denkmal- auch oder nur der Naturschutz stehen oder auch nicht abbaubar sind. Manche Sande sind nicht geeignet, zum Beispiel Mainkies und Mainsand ist viel zu weich. Den Wüstensand kann man nicht verwenden, weil er zu rund ist und zu gleichmäßig und dazu auch eine chemische Zusammensetzung hat, die zumindest nicht förderlich ist für den Beton. Also muss man den Sand jetzt daher nehmen, wo er dann tauglich ist. Ich weiß nicht, wer ab und zu mal Böhmermann guckt Freitagsabends? Da gab es mal vor einigen Monaten eine wunderbare Sendung über die Sandmafia. Die gibt es tatsächlich und die ist hoch kriminell. Es gibt Schiffe, die des Nachts zu Inseln der Malediven fahren, dort nachts einen Strand abbaggern und den Sand dann in die arabischen Länder bringen, um dort die Hochhäuser zu bauen. Das gleiche im Südchinesischen Meer. Auch dort werden ganze Strände nachts abgebaggert. Die Inseln sind anschließend dem Untergang geweiht. Das heißt also, wir können es uns auch nicht leisten, mit dem Sand weiter so umzugehen, wie wir das im Moment tun. Alternativen zum Sand haben wir wenige. Wir können natürlich den Saharasand bearbeiten. Auch da gibt es erste Vorschläge, aber das ist wiederum mit sehr viel Energie verbunden. Und solange wir die nicht nur aus regenerativen Quellen versorgen oder beziehen, macht es auch nicht so viel Sinn. Also wir müssen unbedingt mit der Menge an Sand drastisch runter.
Moderator: Okay, jetzt haben wir ein gutes Bild vom Stahlbeton und von den Notwendigkeiten, wie wir in Zukunft anders bauen müssen. Wie sieht denn jetzt das Bild aus, das du, Manfred, für dich im Kopf hast und mit dem Forscherteam, was du in die Welt bringen möchtest? Was genau möchtest du bauen? Für wen wird das gebaut? Gib mal einen kurzen Abriss der Vision.
Prof. Curbach: Das Wort kurz war jetzt gefährlich. Sie haben gerade aus meinen Worten da gehört, dass das Problem ist mit dem Stahl im Beton, dass der irgendwann beginnt zu korridieren. Wobei ich gleich dazu sagen will, ich habe absolut nichts gegen Stahl. Ich werde nachher mal über ein Bauwerk erzählen, wo auch jede Menge Stahl drin ist. Ich habe nur was gegen Stahl im Beton. Weil dadurch jede Menge Beton erforderlich ist, um den Stahl zu schützen. Was wäre es doch für eine gute Idee, ein Material im Beton zu haben, das nicht rostet. Vor über 100 Jahren hat ein Vorvorvorgänger von mir, Fritz von Emperger, gesagt: "Das mit dem Stahl ist nicht gut, das hat keine Zukunft. Der ideale Werkstoff im Beton ist Holz.". Wir wissen heute, dass er sich damit nicht durchgesetzt hat. Aber sie merken daran, wie früh die Gedanken schon kamen, den Stahl zu ersetzen, weil er eben nicht so optimal ist. Es gab immer wieder Versuche, was zu verändern und es war dann zu der Zeit, wo ich hier nach Dresden kam, wo ich den Professor Offermann kennengelernt habe, wo dann die Idee entstand: Könnten wir nicht Glas nehmen auf einer Textilmaschine verarbeiten, so dass es als Bewährung in den Beton eingelegt werden kann? Das war '94, das haben wir probiert und es hat funktioniert. Und die Ergebnisse waren dermaßen überzeugend, dass wir gesagt haben: Da müssen wir jetzt weitermachen! Es gab eine Menge Leute, die haben das belächelt, die haben gesagt Ach, lass die mal machen. Manche haben dann gesagt oder sogar ein ziemlich berühmter Bauingenieur, der sagte "In drei Jahren ist es wieder tot.". Wir haben uns angestrengt. Wir haben relativ viel Forschungsmittel erstmal einwerben können, um die Grundlagen zu erforschen, dieser Kombination aus Glasfasern und Beton und haben dann 2002 etwa gemerkt; wir hatten schon vorher ein Screening gemacht ,was für Materialien gibt es denn noch? Aramid, Carbon? Wir haben damals alles gecheckt, was so ging. Glas war damals noch das, sagen wir mal, Vertretbarste auch vom Preis her, aber Carbon wurde immer billiger damals. Und 2002 oder drei war es, wo wir die Entscheidung getroffen haben: Wir wechseln auf Carbon. Das ist ein hervorragend geeignetes Material mit sehr hoher Festigkeit, wirtschaftlich interessant. Man kann jetzt sagen na ja, es ist vielleicht teuer. Wenn Sie jetzt so an Carbonfahrrad denken oder im Tennisschläger oder in den Skiern, überall, wo Carbon draufsteht, ist das Preisschild gleich viel höher. Und wenn ich Ihnen sage, was ein Kilo kostet, dann werden Sie sagen, Ja, ich habe doch recht gehabt. Ein Kilo Stahl kostet jetzt wieder ungefähr 1€. Ein Kilo Carbon kostet jetzt ungefähr 12 -14€. Ja also doch teuer. Aber die Dichte von Carbon ist bloß 1/4 der Dichte von Stahl. Das heißt, wenn Sie ein Kilo kaufen, kriegen Sie bei Carbon die vierfache Menge. Jetzt ist die Festigkeit ungefähr 4.000 Newton je Quadratmillimeter statt 500, also achtmal so hoch. Wir nutzen ungefähr 2000 jetzt für unsere Sachen, also viermal so viel, also Viertel an Dichte, vierfache Menge an Festigkeit ist schon der Faktor 16. Das heißt, das Carbon ist heute, wenn man es auf die Leistung bezieht, schon billiger als Stahl. Dadurch, dass wir jetzt aus dem Carbon jetzt solche Gelege machen, kommt wieder ein bisschen Geld dazu was wir aufwenden müssen. Wir machen auch Stäbe aus dem Carbon. Beides aber jetzt eben Materialien und das ist wichtig, die nicht korrodieren. Und wir können das, wenn wir es in den Beton einbetten, jetzt nicht mehr acht, zehn oder zwölf Zentimeter dicke Konstruktionen machen, oder müssen wir nicht mehr. Wir können ein Zentimeter nehmen und tatsächlich so dünn dann bauen, da sehen Sie, es sind zwei Lagen Carbon drin, dieses kleine Treppenstückchen hier. Das heißt also, allein dadurch, dass wir jetzt ein nicht rostendes Material nehmen, können wir die Materialmenge mindestens um 50 % reduzieren. Das klappt in jedem Fall. Und wir haben schon gezeigt, bei bestimmten Bauteilen und bestimmten Konstruktionsprinzipien können wir bis zu 80 % Material sparen. Das heißt auch 80 % weniger Sand. Und beim Bindemittel ist es jetzt so, jetzt brauche ich ja kein Bindemittel mehr, das mir diesen hohen pH-Wert erzeugt. Ich kann ja andere Bindemittel nehmen. Das heißt, im Moment sieht die Rechnung so aus: Wenn wir 50 % Material sparen, sparen wir über 70 % CO2. Und das ist noch steigerbar. Das heißt, wir können tatsächlich einem klimaneutralen Bauen, einem nicht CO2 erzeugenden Bauen damit sehr nahe kommen. Im Moment wird dieses Carbon noch aus Erdöl gemacht. Können Sie sagen: Mist. Wobei ich gleich sagen muss so schlecht ist das gar nicht. Aber man kann es eben zum Beispiel auch machen herstellen aus dem Lignin, aus Holz, das ist mittlerweile aus der Forschungsphase schon raus. Das heißt also, wir schaffen das jetzt schon, auch industriell, aus Lignin, aus Holz Carbonfasern herzustellen. Damit hätte der Herr von Emperger 100 Jahre später doch noch recht gehabt. Und was noch schöner ist und was auch klappt, wir können auch Carbonfasern aus dem C des CO2 aus der Luft gewinnen. Das heißt, wir können sogar das CO2 senken dadurch, dass wir diese Bewährung herstellen. Da arbeiten wir mit einem Münchner Chemiker zusammen, Professor Brück. Der hat eine Algenform gefunden- Blaualgen, die sich vom CO2 der Luft ernähren und als Ausscheideprodukt ihres Stoffwechsels Polyacrylnitril herausbringen, PAN. Das wiederum ist ideal geeignet, um durch Pyrolyse daraus dann diese Carbonfasern zu machen. Auch aus Erdöl wird dieses PAN erst gemacht und dann wird es durch Pyrolyse dann zu Carbonfasern verändert. Das heißt also. Wir können damit zumindest was die Bewährung anbelangt, sogar eine CO2-Senke erzeugen und können insgesamt damit dann zumindest wenn man mit Beton dann bauen will, klimaneutral bauen. Und das ist das Neue am Carbonbeton.
Moderator: Ja, ich habe von dem PAN gelesen und wie das hergestellt wird, dass man da auch noch dran forscht an anderen Möglichkeiten. Der - man nennt es Precursor. Ist das Precursor? Also okay das englische Wort Precursor. Und man hat sich eben auf dieses, ich nenne es jetzt einfach der Einfachheit halber, PAN bislang, also wie sagt man, verständigt. Genau. Nun ist es so, man tut das in welcher Industrie? Wie sieht die Industrie aus? Haben wir die Industrie hierfür schon oder brauchen wir andere Werkhallen, um das dann auch produzieren zu können?
Prof. Curbach: Das hängt jetzt davon ab, ob wir weiterhin jetzt aus dem Erdöl das machen wollen. Da gibt es weltweit eine große Zahl von Firmen, die das herstellen, auch mehrere in Deutschland SGL zum Beispiel, in der Nähe von Augsburg, in Meitingen, Wuppertal eine Firma. Die machen aus dem Erdöl jetzt noch im Moment die Carbonfasern. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil es ja so klingt: Na ja, das Erdöl, das ist nicht gut. Das kann man anders sehen, wenn es denn die erdölproduzierenden Länder auch anders sehen wollten. Im Moment ist der Erdölpreis ziemlich niedrig, merkwürdigerweise. Denn die erdölexportierenden Länder versuchen im Moment so viel wie möglich Erdöl zu verkaufen, solange sie es noch abgenommen bekommen für die Energieerzeugung oder für viele andere Prozesse. Wenn der Bedarf an Carbonfasern hier für Stäbe oder solche Gelege wächst, dann könnte das Erdöl eingesetzt werden, ohne dass dabei CO2 entsteht. Das heißt, wenn man den erdölexportierenden Ländern jetzt ja nicht nur sagen würde, sie auch überzeugen würde, dass sie in fünf oder in zehn Jahren jede Menge Erdöl verkaufen können für die Herstellung von Carbonfasern könnten die ihren Preis sogar wieder anheben. Das würde für die Carbonpreise da dann nicht so extrem schlimm sein und sie würden jetzt das Erdöl nicht so, man muss fast sagen verschleudern. Denn jetzt wird das meiste verbrannt und damit entsteht CO2. Also es wäre durchaus sinnvoll, das Erdöl, das noch da ist und solange es noch da ist, sagen wir 30, 40 Jahre lieber für Carbonfasern zu verwenden als für die Energieerzeugung. Aber soweit sind wir leider noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Die Industrien für Lignin und CO2 gibt es noch nicht. Das mit dem Lignin ist jetzt industriereif, die Ersten fangen damit gerade an. Im CO2 aus der, das CO2 der Luft zu nehmen ist tatsächlich noch im Forschungsstadium. Wir haben das erste kleine Stückchen Carbonfaser aus so einer Algenproduktion schon gesehen und es gibt es schon. Aber das industriell aufzubauen ist noch mal eine ganz andere Nummer. Aber auch daran wird gearbeitet.
Moderator: Wir haben also jetzt die Vision. Wir haben das Material, das schon da ist. Kann man sich das wo angucken?
Prof. Curbach: Ja, kann man. Der Herr Neinhuis hat mich immer gefragt, ob wir mal eine Brücke bauen können im Botanischen Garten. Das müssen wir noch machen. Dann könnte man gleich um die Ecke gehen. Im Moment kann man es sich aber auch schon angucken, weil es schon eine ganze Menge an Bauwerken gibt, die entweder mit Carbonbeton verstärkt worden sind oder die neu gebaut worden sind. Und damit bin ich bei den zwei großen Anwendungsgebieten. Das eine ist die Verstärkung vorhandener Gebäude. Das ist vielleicht volkswirtschaftlich sogar noch die wichtigere Anwendung, denn wir haben ja schon eine gebaute Umwelt und diese Umwelt ist sehr, sehr viel wert. Und wir erleben es tatsächlich, dass immer häufiger auch tatsächlich alte Bauwerke abgerissen werden. Das müsste nicht sein. Gerade die ganzen alten Stahlbetontragwerke aus den 20er, dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts kann man hervorragend jetzt durch eine ganz dünne Schicht aus feinem Beton mit so einem Textil drin, das jetzt irgendwo da ist, mit so einer Lage Textil verstärkt werden. Und damit kann die Tragfähigkeit so einer alten Struktur schlicht verdoppelt werden. Und wir haben das jetzt an vielen Bauwerken schon gezeigt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Beyer-Bau kennt in Dresden sozusagen die Heimstatt der Bauingenieure. Wir wurden da 2016 ausgesiedelt, weil das gesamte Bauwerk verstärkt, saniert werden sollte und der Statiker war nicht in der Lage, die acht Zentimeter dünnen Decken des Beyer-Baus nachzurechnen. Also hat er den Vorschlag gemacht, die alten Decken rauszureißen, die er nicht nachrechnen konnte, und durch Stahlbetondecken zu ersetzen. Das tat mir natürlich in der Seele weh und wir haben es erreicht, dass sämtliche Decken und Unterzüge im Beyer-Bau jetzt mit Carbonbeton verstärkt sind. Es hat also alles stattgefunden, es wurde auch alles jetzt nachgewiesen. Zur Sicherheit wurden auch noch experimentelle Sicherheitsuntersuchungen angestellt. Das heißt also, der Beyer-Bau ist durch Carbonbeton in der vorliegenden Form gerettet worden. Was ähnliches mit der größten noch stehenden Schale von Ulrich Müther in Magdeburg. Ich weiß nicht, wer da am Elbufer diese Hyparschale kennt? Wunderbares Tragwerk mit einer riesengroßen freien Fläche drin, weil keine Stützen erforderlich sind. Es ist so eine Kombination aus vier Hyparschalen. Diese Schale war auch acht Zentimeter dick und sah nicht mehr gut aus. Da war auch Stahlbewährung drin. Die Stahlbewährung ist verrostet, der Beton ist abgeplatzt und da die Schale unter Denkmalschutz steht, hat man sich schwer getan, sie abzureißen. Also hat man sie einfach vor sich hinvegetieren lassen. Und da ist tatsächlich mit Carbonbeton diese Schale gerettet worden. Ein Zentimeter auf der Oberseite, eins Zentimeter an der Unterseite und die wird jetzt, das haben wir jetzt 23, die wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, dann auch wieder dann den Betrieb abgeben. Es findet gerade der Innenausbau statt, die Verstärkung war schon. Und so gibt es eine Menge Bauwerke, die jetzt schon mit Carbonbeton verstärkt worden sind. Was anderes ist es neu zu bauen. Da kann man natürlich von der Möglichkeit so dünn zu bauen, auch Profit ziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Bauelementen wie Fassadenplatten, zum Beispiel auch Sandwichplatten, die verwendet werden können, die schon Zulassungen haben. Aber um mal so richtig zu zeigen, was alles geht, ist ein Versuchsgebäude entstanden, am Fritz-Foerster-Platz auf dem Unigelände. Der sogenannte Cube und der Cube besteht aus zwei Teilen, einmal einer Box. Das ist tatsächlich nur eine rechteckige Kiste, wenn man so will. Die Wände bestehen aus einem Doppelwandsystem aus Carbonbeton und sind ungefähr 27 Zentimeter dick. Damit sind sämtliche bauphysikalischen Vorgaben erfüllt, vor allen Dingen Wärmeschutz, Schallschutz und dergleichen mehr. Eine Wand aus Stahlbeton mit der zugehörigen Dämmung ist aber so ungefähr 44 Zentimeter dick. Das heißt also, wir haben jede Menge Fläche gewonnen, denn Bauwerke werden ja außen gemessen. Wenn sie ein Bauantrag stellen, dann wird außen gemessen. Es ist 12 Meter, darf 12 Meter breit sein. Wenn Sie die Wände dünner machen, bedeutet das, dass Sie innen mehr Quadratmeter haben. Und ein Mitarbeiter hat in seiner Dissertation dann mal das alles ausgerechnet. Was kostet es aus Stahlbeton? Was kostet es aus Carbonbeton? Der Quadratmeter Wand kostet aus Carbonbeton ein bisschen mehr, aber durch die gewonnene Fläche wird es günstiger. Und seine Berechnung lief darauf hinaus: Sobald der Quadratmeter nutzbarer Fläche innen für über dreieinhalbtausend Euro je Quadratmeter gebaut werden muss, wird es günstiger, mit Carbonbeton zu bauen. Und wenn ich heute die Wohnungsbaugesellschaften höre, die sagen: Im Moment kann ich nur für vier, viereinhalb, teilweise sagen sie mir für 5.000 € die Quadratmeter neu bauen. Also das lohnt sich heute schon aus wirtschaftlichen Gründen mit Carbonbeton zu arbeiten. Der andere Teil dieses Cubes besteht aus einer geschwungenen Form. Entwickelt worden von dem Professor Henn. Ich denke, einer unserer berühmtesten Architekten, die wir in Deutschland haben und der von Carbonbeton überzeugt ist. Und mit dieser Schale soll gezeigt werden, dass eben auch eine neue Architektursprache möglich ist, weil ja die Bewährung. Ich habe es gerade mal gesehen bei jemandem, die lässt sich auch leichter biegen. Das heißt also, wenn ich gekrümmte Flächen herstellen will, ist es viel leichter, das mit solch einem Carbongitter zu machen, als ja hier, als mit einer Stahlbewehrung, bei der das Biegen ganz schön aufwendig ist. Jetzt haben wir diesen Twist, wie er heißt, noch traditionell hergestellt, in dem es gesprüht oder gespritzt wurde. Das wird in Zukunft auch andere Verfahren geben, um mit Carbonbeton zu bauen. Da ist die additive Fertigung jetzt in der Forschung. Pultrusion und Extrusion sind denkbar. Also da haben wir eine Menge Möglichkeiten, auch anders und dann wahrscheinlich sogar wieder günstiger zu bauen. Ansonsten ist der Twist uns teurer geraten als ein normales Bauwerk, gebe ich gerne zu. Aber das ist oft so mit neuen Entwicklungen. Wenn wir mal etwas weiter zurückgehen und denkt man an die Eisenbahn. Die Eisenbahn war ja, so würden wir das heute sicherlich gerne alle sagen, eine disruptive Innovation. Und wie war das 1835, als der erste Zug von Nürnberg nach Fürth fuhr? Die Personenwagen waren Kutschen, die man einfach auf die Gleise gestellt hat, und es hat 30, 40 Jahre gedauert, bis sich eine eigene Waggonbau-Industrie entwickelt hat, die neue Entwurfsprinzipien für solche Personenwagen entwickelt hat. Und deswegen sehen eben ICEs heute nicht mehr aus wie Kutschen. Aber man hat erst mal begonnen mit der alten Konstruktionstechnik und so haben wir es jetzt auch gemacht. Wir haben zwar eine eine disruptive Innovation, behaupte ich mal, mit dem Carbonbeton, aber die Herstellverfahren sind noch die, die wir vom Stahlbetonbau kennen. Aber das entwickelt sich jetzt auch. Wir haben noch einen Sonderforschungsbereich jetzt bewilligt bekommen, wo wir solche neuen Konstruktions- und Herstellstrategien entwickeln wollen für den Carbonbeton. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Deswegen sie können sich den Cube auch angucken.
Moderator: Ganz kurz für mich. Ich habe die zwei Worte Pultrusion und Extrusion. Spreche ich das richtig aus? Was ist das denn für mich als Laie in der Herstellungsverfahren?
Prof. Curbach: Dann müssen wir jetzt mal die Jahreszeit wechseln und mal den Winter gehen. Weihnachten. Wir wollen Plätzchen backen. Und da gibt es solche schönen Geräte, mit denen man also spritzt. Wie heißen die? Teilchen. Plätzchen? Ja, Plätzchenspritze. Das heißt, die stopfen einen schönen weichen Teig hinein, kurbeln. Und vorne kommt über durch eine Form geprägt, zum Beispiel dann so eine kleine Wurst heraus, die noch weich ist und die man dann verformen kann. Und kann Ringe oder was auch immer daraus formen. Das ist Extrusion, das heißt man drückt etwas heraus. Pultrusion heißt ziehen. Wenn zum Beispiel Bewährung drin ist bei uns, dann kann man an der Bewährung auch ziehen und auf die Art und Weise den Beton aus diesem Gerät herausziehen. Und wir haben da solche Geräte jetzt entwickelt, mit denen man im Moment noch kleine Stücke per Pultrusion und Extrusion erstellen kann. Aber wir stellen uns vor, dass das nachher dann zum Beispiel Öffnungen sind, die vielleicht 1 Meter breit sind, ein Zentimeter hoch. In der Mitte befindet sich eine Textillage und der Beton wird rausgepresst. Anschließend ist es ja noch weich. Man kann es dann zum Beispiel krümmen, man kann es falten. Und Faltkonstruktionen sind aus Carbonbeton ja fast ideal herzustellen, weil eine hohe Steifigkeit mit sehr wenig Material verbunden ist.
Moderator: Danke. Wie darf ich mir das dann jetzt vorstellen, in zum Beispiel deiner Werkstatt, wenn du da werkelst? Gibt es da dann, ähm ja, ein Gelege zum Beispiel. Und dann gibt es dann Maschinen und die zerren daran und. Und die stoßen mal daran und die versuchen neue Formen und ähm,(...) Wann ist das Gelege dann letzten Endes fertig? Wenn es eingelegt ist in den Beton und dann dort wieder Stöße und Druck abbekommt und die prüft ihr dann? Wie sieht da eigentlich dieser Forschungsprozess konkret dann aus?
Prof. Curbach: Wir müssen uns die verschiedenen Herstellprozesse dann so vorstellen. Dieses Textil zum Beispiel wird auf einer Textilmaschine erst produziert. Da gibt es verschiedene Hersteller bereits. Entwickelt worden ist das von dem Professor Offermann hier in Dresden. Der wiederum hatte seine Erfahrungen gesammelt mit einem Herstellverfahren, das die meisten hier vielleicht noch kennen. Malimo, Malimo-Technik, das ist sozusagen die Weiterentwicklung der Malimo-Technik. Das wird eben erst mal auf der Textilmaschine gelegt. Es ist kein Gewebe. Das heißt also, die einzelnen Fasern, die gehen nicht wellenförmig rauf und runter, sondern es sind gerade Stränge, die aufeinander gelegt werden und dann mit so einer Nähmaschine, das ist der rote Faden hier, vernäht werden. Anschließend wird dann dieses Textil in eine Wanne gelenkt und getränkt. Wir brauchen ein Material, das Carbon und Beton dann miteinander verbindet. Da gibt es je nach Anwendung verschiedene. Das sind Epoxidharze, dann ist es sehr steif. Polyacrylate, dann ist es ein bisschen weicher. Styrol-Butadien, dann ist es sogar sehr weich und sehr leicht händelbar und sehr leicht biegbar. Und diese Textilien bekommen wir dann in das Labor, wo die Betoniermaschine steht. Dort wird dieser Beton angerührt und dann in eine Form gebracht, in der das Textil eben entweder dann mit reingelegt wird oder vorher schon drin liegt und dann erhärtet der Beton und es entstehen eben solche Strukturen und die werden dann in Prüfmaschinen wie hast du gesagt, gezerrt oder gezogen oder gedrückt, gebogen, auf jede Beanspruchung hin überprüft, die irgendwo in einem Bauwerk auftreten kann. Und daraus gleichzeitig haben wir mathematische Modelle entwickelt, um dann all das, was wir im Versuch dann sehen, auch rechnerisch entweder nachvollziehen zu können oder auch vorauszuberechnen. Und das sind nachher sogenannte Bemessungsmodelle, die dann in einer Norm Eingang finden, damit dann der Carbonbeton auch regelgerecht, normgerecht bemessen und angewendet werden kann.
Gast: Wo liegt denn da die optimale Maschenweite für solche Gewebe? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das sehr siebähnlich klein wird, dann drückt es das Gewebe ja beim Einfüllen des Betons an den Boden. Und wenn es ja zu weit ist, dann bringt es nicht den Effekt, den wir brauchen.
Prof. Curbach: Ich hätte unbedingt mehr Proben mitbringen müssen. Es ist so, dass das hier ein Gelege ist, das ist geeignet so für 1 bis 2 Millimeter Größtkorn und das ist auch so eines, das dann zum Beispiel bei Verstärkungen zum Beispiel von unten gegen eine Decke dann betoniert wird mit so einem feinen Beton. Wir haben aber auch andere Betonrezepturen entwickelt, mit vier und acht Millimeter Größtkorn eine Sorte sogar 16 Millimeter Größtkorn. Da sind die Maschenweiten dann deutlich größer, so als wenn hier jede zweite, jedes zweite Garn fehlen würde. Und dann sind dann meinetwegen bei dem hier. Also dann ist hier oben das besetzt und dieses hier, und das sind jetzt eben 50.000 Filamente, dieses Zusammenkommen. Und dann werden da eben die auch nochmal gefacht, da können das dann auch 100 oder 150.000 sein, aber dann eben mit dem großen Abstand. Und dann kann man eben auch mit einem acht Millimeter Größtkorn arbeiten. Also wir haben mittlerweile schon sagen, so zehn, 15 völlig verschiedene Textilstrukturen, auch solche, die in beide Richtungen gleich viel Bewährung haben. Das hier ist eine, da ist das senkrechte jetzt hier deutlich dünner, weil man da in der Richtung nicht so viel Carbon braucht wie jetzt in der Längsrichtung.
Moderator: Wenn wir uns das Material noch mal angucken, das Gelege. Soweit ich jetzt ein davon Bescheid weiß. Ähm hat ja, ein Garn besteht aus 50 bis zu 50.000, genau, bis zu 50.000 kleinen Strängen, die verwoben werden. Ähm. Dann kommt noch mal eine Ummantelung drumherum und schlussendlich sagen wir oder schmücken das dann mit Begriffen und aus der Empirie heraus, dass es unschmelzbar ist und korrosionsbeständig. Wie ist es denn jetzt, wenn wir auf die Idee kommen, wir wollen davon etwas recyceln? Oder wir wollen damit etwas anderes machen? Ein Bauprojekt muss abgebrochen werden. Wie sieht denn die Material-Ökobilanz aus? Kannst du da was dazu sagen?
Prof. Curbach: Also noch mal zu dieser Zahl 50.000. Also in den Maschinen zur Carbonherstellung werden sogenannte Filamente hergestellt. Filamente sind eben hauchdünne Fäden, Durchmesser 6 bis 8 Mikrometer. Und von denen werden 50.000 zusammengeführt und ergeben dann ein Garn. Und das sind hier in diesem Beispiel hier die dickeren Garne. Das sind also 50.000 Garne, 50.000 Filamente, ein Garn. Wenn wir jetzt das nachher verarbeitet haben, es geht jetzt zu der Frage des Wertstoffkreislaufs. Ist ja wichtig, kann man jetzt die wieder voneinander trennen? Da sagte ich ja vorhin, wir haben drei verschiedene Tränkungschemikalien, die können sich auch noch mal unterscheiden im Detail vom Epoxidharz über diese Acrylate bis zu Styrol-Butadien. Die dafür sorgen, dass wir einen optimalen Verbund haben zwischen Beton und Carbon. Optimal heißt nicht fest, denn Carbon ist spröde, Beton ist spröde. Wenn ich die beiden ganz fest zusammenfüge, sozusagen einen ganz festen Verbund hätte, dann würde auch der Verbundwerkstoff Carbonbeton auch wieder spröde sein. Das Geheimnis besteht also darin, dass diese drei Tränkungsmaterialien alle einen, ich nenne es mal, nachgiebigen Verbund haben. Die Nachgiebigkeit hängt jetzt davon ab, welche Chemie das ist, aber sie sind in jedem Fall nachgiebige Verbünde, die dann dazu führen, dass das Verbundmaterial selber relativ duktil wird. Das heißt, wenn ich so eine Platte nehme, so ein Zentimeter dick, habe den über 60 Zentimeter gespannt und belaste das durch eine Last in der Mitte, dann biegt sich ja diese Platte durch. Und die Nachgiebigkeit des Verbundes ist so groß, dass diese Platte sich um ungefähr 20 Zentimeter durchbiegt, 20 Zentimeter, bevor sie versagt. Da ist das etwas, was wir im Bauwesen immer haben wollen ein sogenanntes Versagen mit Vorankündigung. Wir wollen nicht, dass etwas plötzlich versagt, denn dann könnte ja irgendwas passieren und keiner ist gewarnt vorher. Wenn sich aber ein Versagen durch große Verformungen oder zum Beispiel auch durch Rissbildung ankündigt, dann kann man alle Menschen in Sicherheit bringen und dann das weiter beobachten. Das heißt also, diese Nachgiebigkeit ist sehr, sehr wichtig für dieses Ankündigungsverhalten. Weil also der Verbund nicht so fest ist, sondern optimal, kann ich jetzt tatsächlich, wenn ich mit so einem Brecher rangehe und das hier klein breche, das Carbon auch wieder von dem Beton trennen. Weil die Frage des Recyclings gleich von Anfang an mit im Raum stand, haben wir da so ein ziemlich großes Forschungsvorhaben durchgeführt und haben einige Platten nur deswegen hergestellt, um sie hinterher zerstören zu können. Und dabei hat sich dann rausgestellt, man kann es wunderbar voneinander trennen. Man hatte einen Haufen da liegen aus Betonkrümeln und Carbonschnipseln. Da liegt der Haufen aber immer noch gemischt da. Wie kann ich die trennen? Bei Stahlbeton ist das nicht so schwer, weil die beiden eine unterschiedliche Dichte haben. Beton ungefähr 2,3, Stahl 7,8. Carbon hat ungefähr 1,9. Das ist von den 2,3 nicht weit genug entfernt, dass man das jetzt über eine Dichte-Art trennen kann. Es gibt aber für völlig andere Trennprozesse sogenannte kamerabasierte Systeme. Da läuft so ein Gemisch aus zwei verschiedenen Stoffen über ein Förderband. Eine Kamera nimmt das auf, kann erkennen, ob es sich in unserem Fall dann um Beton oder Carbon handelt. Und sobald diese Mischung dann über das Ende dieses Förderbands wegfällt, gibt es einen kleinen Windstoß. Wichtig ist, falsches Wort kleinen Luftdruckstoß, um das Carbon dann wegzupusten. Und auf diese Art und Weise kann man tatsächlich eine 99%ige Trennung von Carbon und Beton wieder hinkriegen. Jetzt ist es so, dann ist immer noch die Tränkung um das Carbon drumrum. Da ist es so, dass man das über eine wie heißt das? Einen thermischen Prozess voneinander trennen kann. Und dann hat man am Schluss nur noch die Carbonschnipsel, die Filamente alleine oder die Garne. Die haben eine Länge dann so zwischen fünf und 15 Zentimetern. Und aus diesen Schnipseln kann man tatsächlich auch, wie es zum Beispiel bei bei Stoffen ist, mit diesen Schnipseln kann man ein neues Garn spinnen. Das haben wir auch gemacht und dieses neu gesponnene Garn aus den Resten wieder einbetoniert, um zu schauen, wie jetzt die Festigkeit im Beton jetzt ist. Und haben dabei eine Festigkeit von 90 % der Festigkeit bekommen, die vorher die Ursprungsfasern hatte. Und das war der erste Versuch. Das heißt also, man kann tatsächlich alles wiedergewinnen und auch alles wieder verwenden. Was im Sinne der Kreislaufwirtschaft ja unbedingt auch sein muss. Jetzt sehen wir aber diesen Prozess der Kreislaufwirtschaft noch ein bisschen größer, denn es gibt ja noch andere Industriezweige, die Carbon verwenden, wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Wir arbeiten da mit einem großen Automobilhersteller in Süddeutschland zusammen. Der Kofferraumdeckel, Kotflügel, so etwas aus Carbon, nicht aus Carbonbeton, aus carbonfaserverstärktem Kunststoff herstellt. Und die müssen das Carbontextil vorher genau zuschneiden, damit es eben für den Kofferraumdeckel passt. Und diese Firma hat bei der Herstellung aller ihrer Carbonbauteile einen Verschnitt von 30 %. Und die wissen nicht, wohin damit. Und wir haben jetzt gerade ein Forschungsvorhaben, bei dem wir jetzt genau diese Schnipsel von denen nehmen, deren Reste, und machen daraus Gelege. Und im Moment machen wir Stäbe aus denen und gucken, welche Festigkeit erreichen wir damit. Um dann wiederum nachher das hier als normales Material, dann eben im Carbonbetonbau verwenden zu können. Das ist jetzt gerade eben ein Forschungsvorhaben. Sieht im Moment alles sehr vielversprechend aus. Muss aber jetzt noch zu Ende gebracht werden.
Moderator: Mich überzeugt das. Also ich möchte gern mein Haus damit bauen. Da kann ich was für die Umwelt tun. Ich kann mir einen kuppeligen Dom obendrauf basteln, basteln lassen. Wann kann ich denn damit beginnen? Wann baut mir eine Firma sowas?
Prof. Curbach: Morgen. Ja, es ist so wir haben ja ein sehr großes Forschungsprojekt gehabt. Das ist auch vom BMBF, das ist der Name schon mal gefallen heute, auch vom BMBF gefördert worden. Gesamtfördersumme, wir haben von denen ungefähr 49 Millionen Euro bekommen, um all das zu erforschen, was man zur Umsetzung in die Praxis braucht. Und da sind jede Menge Praxispartner bei. Es waren ungefähr 160 Partner und davon 70 % aus der Industrie aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Das heißt, es waren mehrere Carbonhersteller, mehrere Tränkungshersteller, mehrere Gelegehersteller, viele Baufirmen, Fertigteilwerke, also alles Unternehmen, die für die Herstellung des ganzen Carbonbetons zuständig sind oder verantwortlich sind. Und wenn man heute sagt, ich möchte gerne ein Gebäude mit Carbonbeton bauen und man macht eine Ausschreibung, dann kriegt man mit Sicherheit auch mehrere Angebote. Das heißt also, es gibt auch schon einen, ich nenne das mal gesunden Wettbewerb. Manchmal war er mir auch schon ein bisschen ungesund. Bei diesem Beyer-Bau, den ich vorhin erwähnt habe, wo es um die Verstärkung ging. Da hatte das Unternehmen, das vorher die Planung gemacht hat, damit geschätzt, dass diese Verstärkungsmaßnahme ungefähr 1 Million Euro kosten würde. Wenn man diese vielen Quadratmeter denkt, habe ich gedacht: Ja, das klingt plausibel. Das billigste Angebot, das eingegangen ist, lag bei 300.000 €. Das wurde ausgeschlossen, weil es irgendwie nicht seriös schien und konnte man auch belegen. Der Günstigste hatte aber immer noch einen Preis von 500.000, das heißt also auch deutlich weniger als vorher kalkuliert. Bei der Box, die ich da vorhin erwähnt habe vom Cube, kann man heute schon zeigen, es geht wirtschaftlich. Es gibt ein Einfamilienhaus in Leipzig, das ist schon seit einiger Zeit fertig und ist mit Carbonbeton gebaut worden. Zumindest teilweise, nämlich sämtliche Fassadenelemente und Wände. Und im Moment wird gerade ein siebenstöckiges Wohnhaus in Leipzig geplant, auch aus Carbonbeton. Also das funktioniert alles. Irgendeiner wird mich bestimmt mal fragen, welche Nachteile hat denn dieser Carbonbeton? Ein Nachteil ist, dass man im Moment für jedes Bauwerk, das man erstellt, noch entweder eine Zustimmung im Einzelfall braucht oder eine allgemeine Bauaufsicht, die Zulassung. Das sind zwei äh, Genehmigungsverfahren. Das eine ist die erste Stufe, die niedrigste, für die das Land zuständig ist, so eine Zustimmung im Einzelfall. Wenn man dann schon viel Erfahrung gesammelt hat, kann man in Berlin für den Bund dann eine sogenannte Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beantragen. Im Moment wird fast alles mit solcher ZiE gemacht. Wir haben allerdings jetzt auch schon 20 verschiedene Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen in Berlin. Und das, was jetzt am spannendsten ist, jetzt gerade wird eine Richtlinie erarbeitet. Das ist ein normähnliches Dokument. Das hatte seine Einspruchsfrist schon rum. Das war Ende März. Da wird jetzt im Sommer über alles berücksichtigt, was an Einsprüchen gekommen ist. Und wenn es gut geht, wird es Ende des Jahres fertig sein. Und wenn diese Richtlinie bauaufsichtlich eingeführt wird, das ist dann auch wieder so ein fachlicher Begriff. Dann kann jedes Unternehmen, das dann auch dafür die Berechtigung hat und die Fähigkeiten hat, dann mit Carbonbeton bauen. Aber das geht theoretisch schon morgen.
Moderator: Ich möchte jetzt mal dem Publikum auch noch mal Raum geben. Gibt es Fragen, die ihr euch noch nicht getraut habt anzuzeigen? Ja.
Gast: Ja, jetzt eine ganz naive Frage. Wenn er jetzt sein Haus hat, wie kann er...kann er dann da Löcher bohren, um seine Bilder aufzuhängen oder muss er dann kleben?
Moderator: Schöne Frage.
Prof. Curbach: Ja, tatsächlich kann man diese Wand oder diese Decke genauso behandeln wie jetzt im Moment Stahlbeton. Nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist es sogar einfacher. Stellen Sie sich vor, Sie wollen in Ihre Decke ein Loch bohren, um eine Lampe aufzuhängen. Sie haben eine schöne Schlagbohrmaschine und treffen den Stahl. Haben wir auch schon erlebt. Ist nicht so lustig. Weil das Carbon senkrecht zu seiner Längsrichtung, also in die Richtung hier, eine viel geringere Festigkeit hat, können Sie mit dem Bohrer in der Richtung tatsächlich durchs Carbon durchbohren. Das heißt, es ist sogar einfacher in Zukunft. Wir haben das auch dann überprüft. Es gibt ja noch einen Aspekt, den hast du jetzt nicht gefragt, aber ich beantworte ihn ungefragt. Ist es vielleicht gesundheitsgefährdend, mit Carbonbeton zu arbeiten? Haben wir jetzt plötzlich Asbest zwei null? Das wollen wir auch sehr genau wissen und haben deswegen in diesem großen Forschungsprojekt auch Mediziner beauftragt, das tatsächlich nach allen Regeln der Kunst zu untersuchen. Und dabei haben wir eben diesen Carbonbeton nachher gesägt, geschliffen, gebohrt, alles mitgemacht, was man machen könnte, um tatsächlich ganz feine Schnipsel vom Carbon zu erzeugen. Denn dass die Filamente alleine, die sind nicht krebserregend, die sind dick genug. Aber was passiert, wenn eben dann beim Schleifen oder Bohren dann noch feinere Partikel entstehen? Und das Ergebnis war, dass Carbonbeton genauso ungefährlich oder genauso gefährlich ist wie normaler Beton. Wenn Sie jetzt im Moment Beton sägen, schleifen, bohren, dann müssen Sie eine FFP2-Maske tragen. Die haben wir im Labor schon lange gehabt, bevor Corona irgendwo auftauchte. FFP2-Masken sind für Betonbauer eine ganz normale Sache. Die müssen sie tragen, wenn sie bohren. Und genau die muss man auch tragen, wenn man Carbonbeton bohrt, schleift oder sägt.
Moderator: Fühlt sich das dann auch anders da an, wenn man darin wohnt?
Prof. Curbach: Also Sie können ja mal dieses Teilchen hier anfassen. Ich finde Carbonbeton, also ich bin ja sowieso befangen. Klar, ich mag auch Beton in der normalen Form, wie wir ihn jetzt hatten. Aber dadurch, dass wir jetzt hier einen feineren Beton haben, sind die Oberflächen noch ein bisschen glatter, als wir das von einem normalen Beton kennen. Das heißt also, da sind weniger Poren im Beton drin, die Sie normalerweise ja an der Betonoberfläche sehen. Sichtbeton herzustellen mit Carbonbeton ist deutlich einfacher als mit normalem Stahlbeton aufgrund dieser Feinheit. Und wenn man eben jetzt im Cube zum Beispiel drinsteht auf der Innenseite. Ich finde diese Oberflächen fantastisch. Aber wie gesagt, ich bin befangen.
Moderator: Vielen Dank. Ja, hier haben wir noch eine Frage.
Gast: Könnte man die Kohlefasern noch so weit funktionalisieren, dass man dort vielleicht das Kabel schlitzen sich erspart und damit den Lichtschalter quasi direkt anbohrt und sagt: Fertig. Licht brennt?
Prof. Curbach: Ja, das haben wir im Cube alles mal irgendwo demonstriert. Es geht alles. Also man kann zum einen damit zum Beispiel nicht sichtbare Schalter in der Wand mit unterbringen, das heißt, wenn ich mit meiner Hand da auf die Oberfläche gehe, geht irgendwo das Licht an.. An zwei Teilen haben wir mal gezeigt. Man kann nämlich mit dem Carbon auch heizen. Das hat es gemeinsam mit Stahl, wenn man eine Spannung anlegt, wird es warm. Wenn ich das an Stahl anlege, der sich im Beton befindet, der ist ja dann normalerweise fünf Zentimeter weiter drin, dann wird der warm und heizt erst mal den Beton. Wir haben dann einige Probeflächen im Cube, wo das Textil eben dann wie sonst auch zwei Millimeter von der Oberfläche entfernt liegt. Da wird eine Spannung angelegt und dann bekomme ich eine Wandheizung, denn die strahlt natürlich dann sehr schnell dann auch in den Raum ab. Und Wandheizung ist noch ein bisschen schöner als Fußbodenheizung. Also man kann es nutzen. Wir haben es dann schon mal mit mit LEDs versehen. Man kann tatsächlich auch Informationen schicken. Man kann eben Licht ein und ausschalten damit. Da würde ich dann aber nicht mehr bohren, denn dann könnte ich natürlich meine schöne Stromleitung unterbrechen und dann ist das Ganze kaputt. Also das, also alles geht dann nicht.
Moderator: Gibt es denn Bücher, worüber ich mich dann auch informieren kann? Oder kommt da demnächst noch mal etwas auf uns zu in Form von Buch, Anschauungsmaterial?
Prof. Curbach: Ich wusste jetzt nicht, dass ich eine Werbeveranstaltung für Bücher machen kann, aber ich habe auch keins hier. Aber es gibt zumindest zwei Bücher, die normal auch im Handel erhältlich sind. Das eine ist ein Buch über den Cube, heißt auch einfach nur Cube. Also C-U-B-E ist bei amazon... ja prima, das kann man also kaufen. Da steht sozusagen eher populärwissenschaftlich drin, was es mit dem Carbonbeton auf sich hat, wie der entstanden ist. Und natürlich ist der Cube dann detailliert beschrieben. Und das andere nennt sich Handbuch Carbonbeton. Das ist mehr eine Zusammenfassung all der wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir in den letzten zehn Jahren erarbeitet haben, vor allen Dingen mit dem vielen Geld vom BMBF. Da stehen Bemessungsverfahren drin, aber das geht auch nachher in den hinteren Kapiteln bis zu den Lieferanten von Material. Wie man damit umgeht, mit welchen Berechtigungen man ausgestattet sein muss, um als Firma damit arbeiten zu können. Also das ist sozusagen das Handbuch Carbonbeton.
Moderator: Okay. Gibt es ja., zum Abschluss gibt es etwas, was wir uns mit nach Hause nehmen dürfen, aus dieser ganzen lehrreichen Geschichte? Nein, ich glaube, das Gelege nicht. Aber Ideen, oder äh, Hoffnungen ist vielleicht zu viel? Oder verbinden Sie auch Hoffnung, verbindest du Manfred auch Hoffnungen damit?
Prof. Curbach: Ich komme noch mal aufs Klima zurück, wenn ich sage, dass wir mit diesem Material eben sehr viel Material, aber vor allen Dingen sehr viel CO2 sparen können, ist für mich der Carbonbeton ein Mosaiksteinchen im neuen Bauen. Das ist jetzt kein Allheilmittel. Wir brauchen tatsächlich für das neue Bauen 100 solche Ideen wie den Carbonbeton, damit wir tatsächlich in Summe dann ein CO2-neutrales Bauen bis 2045 bekommen. Der Carbonbeton ist ein Mosaiksteinchen. Vielleicht ist es auch ein großes Mosaiksteinchen. Würde mich freuen. Aber es ist nicht die alleinseligmachende Lösung. Wir sprachen vorhin schon über den Holzbau. Der Holzbau ist auch sehr wichtig auf dem Weg eines klimaneutralen Bauens, aber nicht so, wie wir im Moment bauen. Denn wir nutzen Holz extrem ineffizient. Und wir müssen tatsächlich mit dem Holz, das wir zur Verfügung haben und das ist eben limitiert, möglichst viel schaffen. Da gibt es einen Kollegen von mir. Eigentlich müsste er dann auch mal hier sitzen, der Professor Haller, der sich mit dem Holzbau intensiv beschäftigt hat. Und seit rund 30 Jahren daran forscht, Holz wesentlich effizienter einzusetzen. Das nächste ist, man kann natürlich erst mal ein großes Materialscreening machen. Wie viel CO2 entsteht denn bei der Herstellung bestimmter Baumaterialien? Das kann man pro Kilogramm beziehen. Dann sieht übrigens Beton erstmal sehr viel besser aus als Holz, und erst die Menge macht den Beton da so schlecht. Man kann aber auch den CO2 Ausstoß auf die Leistung beziehen, so wie ich es vorhin mal bei dem Preis gemacht habe. Dann sind Beton und Holz auf Augenhöhe. Aber ein Material ist viel besser als alle anderen, oder zwei. Das eine ist Bambus und das andere ist Glas. Und mit beiden Materialien arbeiten wir viel zu wenig. Wir nutzen Glas im Wesentlichen zum Durchgucken, was ja auch eine wichtige Aufgabe ist. Aber man kann mit Glas auch konstruktiv bauen. Man kann Lasten abtragen über Glas. Auch daran wird geforscht, aber meiner Meinung nach auch viel zu wenig und zu langsam. Das gleiche ist mit Bambus. Auch dieses Material ist im Moment noch völlig unterschätzt und wir könnten da noch viel mehr tun. Das heißt also, wir brauchen tatsächlich viel mehr Ideen wie den Carbonbeton, um in Summe nachher tatsächlich ein klimaneutrales Bauen hinzubekommen. Wir arbeiten dran.
Moderator: Liebes Publikum, ich lade nochmal ein für Fragen.
Gast: Ja noch eine Frage zu der Akustik . Wie ist das denn, wenn, wenn er sein Haus nicht groß ja (...) Hallo? Ja, wenn er sein Haus sozusagen Höhe 2,20 oder wie, nicht viele Möbel drin hat. Ist das dann, der untere Stock hört, wenn er mit einem Tennisball klopft oder sonst was?
Prof. Curbach: Muss ich ein bisschen ausholen, denn es bezieht sich nicht nur auf die Akustik, sondern auch auf eine andere wesentliche Eigenschaft. Ich kann jetzt, wenn Sie jetzt dieses Betonteilchen jetzt hier nehmen. Ja, ich kann nicht die Decke so dünn machen. Sowohl aus akustischen, aber vielmehr auch aus Gebrauchstaulichkeitsgründen. Wenn tatsächlich die Decke nur zwei Zentimeter dick wäre und der Raum ist vielleicht fünf mal fünf Meter groß, dann würde sich diese Decke extrem durchbiegen. Und wenn sie ein bisschen hüpfen, schwingt die ja auch. Und das heißt so viel wie die Gebrauchstauglichkeit ist nicht gegeben. Um Gebrauchstauglichkeit bei einer Decke zu bekommen, brauchen sie eine bestimmte Bauhöhe. Im Einfamilienhausbau sind das so ungefähr 18 bis 20 Zentimeter. Die sind aber im Einfamilienhausbau massiv. Ich brauche aber, um die Steifigkeit gegen Durchbiegungen zum Beispiel zu bekommen, nur ganz oben zwei Zentimeter Beton und unten zwei Zentimeter Beton. Und dazwischen brauche ich eine, nennen wir es mal ein Material, das diese beiden Schichten miteinander verbindet. Das könnte ein mineralischer Schaum sein oder ein Material, das zum Beispiel besonders gut Lärm dämmt. Dann habe ich tatsächlich nur oben und unten diese insgesamt vier Zentimeter Carbonbeton statt 20 Zentimeter. Da habe ich dann also 16, 80 % gespart. Habe aber die Steifigkeit, die ich brauche, damit ich da drübergehen kann, wie ich es heute auch kann, und habe auch die Schalldämmung, die Sie ansprechen. Das gleiche gilt für Wände. Wir wollen die Wände jetzt nicht so dünn bauen, die werden nur so mehrschichtig. Wie in der Box zum Beispiel ist es ein 2-Wand-System, wo außen jeweils Carbonbeton ist und dazwischen ist noch eine nachgefüllte Betonschicht und ein Dämmmaterial. Und diese Materialien kann man dann optimieren für Schalldämmung, für Wärmedämmung. Und damit habe ich die Frage hoffentlich beantwortet.
Moderator: Okay, ich gucke mal noch mal in die Runde. (...) Ich würde dann an dieser Stelle unserem Gast vielmals danken, für Rede und Antwort stellen, standhalten. Und verweise an dieser Stelle mal auch auf die Internetseite. Also Manfred Curbach ist mit seiner C hoch 3, Carbon Concrete und Composite. Das ist ein Verein. Ist das richtig?
Prof. Curbach: Ja. Also als wir dieses Geld vom BMBF bekommen haben, hat man uns gesagt, wie wir das Geld jetzt verwalten und vor allen Dingen dann da abstimmen, das ist unsere Sache. Und wir haben uns entschieden, damals einen Verein zu gründen, in dem alle Mitglieder. Die Firmen, die Forschungseinrichtungen, die Verbände dann Mitglied waren. Und dieser Verein war damals eben aus Forschungsgründen gegründet worden. Jetzt ist das Projekt gerade zu Ende gegangen. Dieser Verein wandelt sich jetzt gerade zu einem Industrieverband, was ich hervorragend finde, weil jetzt ist ja mehr darum geht, all die Ergebnisse umzusetzen und Lobbyarbeit zu betreiben. Das ist jetzt ganz wichtig und dieser Verband C hoch 3 existiert eben weiterhin, aber jetzt sozusagen mit neuer Zielrichtung und ist ansprechbar selbstverständlich für jeden, der sich jetzt für Carbonbeton interessiert.
Moderator: Super. Wer möchte, kann da auf Facebook. Da habe ich Sie gesehen, gibt es eine Gruppe sogar. Ansonsten unter www.bauen-neu-denken.de oder www.carbon-concrete.org. Es gibt bestimmt noch weitere Zulaufstellen oder Anlaufstellen dafür (...). Wenn Sie möchten, liebe Zuschauer und Gäste, kommen Sie zum Nächsten unserer, unsere Veranstaltungen am 18.06. dort zum Thema CampusAcker-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Schauen Sie doch auch vorbei auf die auf die Internetseite von unserem Botanischen Garten, TU-Dresden.de. Im Übrigen haben wir dort auch eine wunderschöne Linksammlung zusammengestellt. Da war ich sehr angetan von, zur Pflanzenberatung, Infos zum Botanischen Garten und Museen oder Fachgruppen und Initiativen in Sachsen. Und das soll meinerseits dann auch das Schlusswort sein. Vielen Dank Ihnen, dir Manfred! Vielen Dank für die Menschen, die hierher gekommen sind und zugehört haben! Dankeschön!
Mögliche Zukünfte gemeinsam entwickeln- Professor Dr.-Ing. Jens Krzywinski
Anhand unterschiedlicher Projekte stellt Prof. Jens Krzywinski von der Professur für Technisches Design vor, wie Technologie unser Zusammenleben positiv beeinflussen kann und wie Ansätze für Zusammenarbeit angewandt werden können, um die vielfältigen Probleme unserer Gesellschaft gemeinsam aus verschiedensten Perspektiven zu behandeln.
Intro: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung „Triff die Koryphäe unter der Konifere“. Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator, Maurice Vetter: Ja auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich bin Maurice Wetter. Ich werde heute durch die Veranstaltung moderieren und ich würde gerne unseren Gast einmal kurz vorstellen. Professor Jens Krzywinski - Sie sind seit 2019 Professor für Technisches Design an der TU Dresden. Sie haben auch an der TU Dresden studiert und promoviert mit der Frage des Transportations Designs. Genau. Sie sind auch Vater von zwei Kindern im Aufsichtsrat für Kreativwirtschaft e.V. und Ihr Arbeitsbereich, oder einer der Arbeitsbereiche, die ich aufgeschnappt habe, ist eben der partizipative Prozess des Co-Designs, also die Wissenschaftskommunikation. Vielleicht gehen wir direkt damit ein. Was ist denn jetzt genau Wissenschaftskommunikation?
Professor Dr.-Ing. Jens Krzywinski: Vielleicht genauso ein Format wie heute hier. Dass wir rausgehen, den Campus verlassen und in der Hoffnung, jetzt auch tatsächlich hinten immer noch zu verstehen zu sein? Ja, sehr gut. Trotz lauter werdendem Wind mal mit Menschen sprechen, die typischerweise nicht in unseren Vorlesungen sitzen oder Seminaren oder nicht angestellt sind bei uns am Campus und darüber zu erzählen, was wir eigentlich machen und andersherum viel zu fragen, was denn eigentlich Themen wären, mit denen sich die Wissenschaft beschäftigen sollte. Möglicherweise. Und ja, das ist mir schon länger ein Anliegen, das zu tun. Und ich glaube, dafür ist das Design natürlich auch ein schönes Feld, in dem man das tun kann. Und insofern bin ich total gerne heute hier.
Vetter: Prima. Ich habe auch gesehen, dass Sie direkt schon was mitgebracht haben. Vielleicht können sie ja dann auch direkt einleiten, was genau technisches Design ist und welche Zukünfte man gemeinsam gestalten kann. Gerne.
Prof. Krzywinski: Also tatsächlich ist technisches Design eine relativ unbekannte Begrifflichkeit dafür, was sonst Industriedesign oder früher mal Produktgestaltung hieß. Und insofern befinden wir uns da in der TU Dresden, inmitten in den technischen Fächern. Und gleichzeitig haben wir ziemlich viel Design als Grundlagen, um beides zusammenzubringen. Da geht es dann um die Fragen: Was machen wir denn mit neuen Robotern? Wie sehen die möglicherweise aus? Wie kann ich darüber überhaupt gemeinsam nachdenken? Und das ist der Punkt, wo es dann partizipativ wird. Weil die wenigsten von uns haben ja in ihrem aktuellen Alltag bisher mit vielen Robotern zu tun. Außer man steht gerade in einer Industrieanlage in der Automobilwirtschaft und da ist meistens ein großer Zaun dazwischen noch immer. Das ist also eine spannende Frage, die uns beschäftigt. Und das, was ich mitgebracht habe, das ist eins der Modelle, wie das typischerweise bei uns losgeht. Das ist also kein 1:1 Modell. Und die Roboter werden nicht alle so klein ausfallen, sondern das kann man sich vorstellen wie einen Traktor. Ich glaube, das ist von vorn relativ gut zu sehen. Aber das, was typisch für den Traktor ist, nämlich die Kabine, die fehlt hier oben, weil das nämlich ein autonomes Fahrzeug sein kann. Und das, was ich dann machen kann, ist, dass ich hier einfach unterschiedliche Werkzeuge einbaue. Das kann so ein Werkzeug sein oder das kann ein anderes sein. Und damit wir das tun können, haben wir im Kinderzimmer früher immer Lego gehabt. Heute hat man dafür einen 3D Drucker und kann dann solche Dinge, das ist hier der Maßstab 1:6, ausdrucken und den Leuten in die Hand drücken, die wissen wollen, wie denn so was funktionieren könnte. Und das ist jetzt ein Projekt aus einem Verbund Projekt. Da haben wir mit sechs Unternehmen aus der Region zusammengearbeitet, mit sechs Forschungseinrichtungen und in diesem Zwölfer Team überlegt, wie den Maschinen für die zukünftige Landwirtschaft funktionieren könnten. Und als wir damit angefangen haben, da war eine der am häufigsten gestellten Fragen, machen wir damit nicht ganz viele Arbeitsplätze kaputt, indem wir die Leute arbeitslos machen, weil wir da keinen Fahrer oder keine Fahrerin mehr brauchen? Inzwischen hat sich das sehr, sehr deutlich gedreht und eigentlich würden viele viel schneller automatisierte Lösungen einsetzen wollen, als sie da sind, weil uns in ganz vielen Branchen die Fachkräfte ausgehen. Insofern ist es tatsächlich gut, wenn Wissenschaft sich manchmal so ein bisschen vortraut und aber in der Rückkopplung mit solchen Formaten wie heute hier dann auch klärt, ob die Fragen, die wir versuchen zu beantworten, auch tatsächlich noch relevant sind. Das ist das, was mein Beruf ausmacht, und das kann dann, hier passend zum Botanischen Garten, im Agrarbereich sein, das kann aber auch in historischen Kontexten sein, wie bei den Schlössern und Gärten. Da geht es nicht um Feld Bestellung, sondern da geht es um eine Pflege von einem großen Garten, zum Beispiel Pillnitz oder konkret Großer Garten. Und auch da geht es um die Entlastung von Menschen und Personal. Und Jan Weber sitzt hier in der ersten Reihe. Das ist einer der Kollegen, mit denen wir das Projekt in Pillnitz gerade vorbereiten. Und letzte Woche waren wir gemeinsam draußen und haben mit unseren jeweiligen Teams, mit Gärtnern, Gärtnerinnen, mit Technikern, zusammen versucht, einen Roboter aufzubauen, anzudenken und auszuprobieren. Und da sind dann ganz praktische Fragen: Wie lange brauche ich? Wie lange reicht mein Wasser? Wie schnell kann der auftanken? Was mache ich in der Phase, wo der Roboter zum Auftanken fährt und ich plötzlich als Mensch nichts zu tun habe? Däumchen drehen ist da nicht so gut angesagt. Also bedeutet es, dass wir mehrere Roboter brauchen. Und da das alles schwierig ist, in Excel Tabellen oder mit Texten sich zu vergegenständlichen, brauchen wir dafür solche Objekte. Und letzte Woche haben wir dafür im Baumarkt eingekauft und aus Holzlatten etwas zusammengeschraubt. Da war zwar ein Wassertank drauf und eine Wasserpumpe, aber die Bedienung erfolgt über eine Klingel, was ganz lustig war für die Gärtnerinnen und Gärtner. Das heißt, die haben einfach kurz geklingelt, wenn der zukünftige Roboter etwas machen sollte. Und dann hat unser Team dafür gesorgt, dass der Roboter, der noch kein Roboter ist, tatsächlich das tut, was sich die Gärtner:innen gewünscht haben. Und in diesem Interaktion Prozess entstehen Geräte, wie wir sie bis jetzt noch nicht haben und vielleicht vor fünf Jahren auch nicht darüber nachgedacht haben, ob man die brauchen könnte. Das ist so ein Teil meiner Arbeit. Und ein vielleicht noch letzter Ball, den ich spielen würde in Richtung Partizipation und Wissenschaftskommunikation. Wir haben gerade in der übernächsten Woche im Kulturpalast dann einen Raum, der jeden Tag derartige Formate wie dieses hier bespielen wird. Sie alle kennen im Kulturpalast die Bibliothek. Sie alle kennen die Philharmonie, einige von ihnen kennen vielleicht noch das ZfBK. Das ist in der unteren rechten Ecke, wenn man davor steht und kümmert sich um Baukultur. Und zukünftig haben Sie in der unteren linken Ecke noch das Wissenschafts Forum. Da werden so Formate wie heute drei Tage die Woche stattfinden und es wird größere Veranstaltungen geben, um noch viel mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Austausch mit ihnen zu bringen. Das ist die Idee dahinter und da sind wir sehr, sehr froh darüber, weil Wissenschaft in Dresden ein wirklich großes Thema ist. Aber die meisten der Institute und auch die Universität selber, die HTW genauso, Schwierigkeiten haben, in den Austausch mit der Bevölkerung zu kommen, außer bei der Langen Nacht der Wissenschaften, wo uns so ein bisschen die Bude eingerannt wird. Aber die anderen 364 Tage im Jahr hoffen wir auf solche Formate wie das hier und da ganz vielen Dank an die Vorbereitung. Das ist immer eine Menge Arbeit und umso schöner, heute hier sein zu dürfen.
Vetter: Vielen Dank für die einleitenden Worte und genau da würde ich jetzt auch anschließen, dass wir hier in einer Dialogveranstaltung sind und dass es eben genau darum geht, den Austausch zwischen Wissenschaft und Bürgerwissen interaktiv zu gestalten. Also gibt es vielleicht direkt schon Fragen an den Herrn Krzywinski aus dem Publikum?
Gast: Maschinelle, autonome Landwirtschaft. Ich habe Bedenken, wenn der Mensch gar nicht mehr vorkommt. Es kommen immerhin Hasen und andere Tiere vor. Und wenn ich dagegen sehe, was in China mit Gesichtserkennung passiert, da habe ich doch das Gefühl - sollte es klappen - ob das uns allen recht wäre? Ob das dafür steht?
Prof. Krzywinski: Vielen Dank für die Frage. Ja, tatsächlich ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Also das, was wir alles betreiben mit Sensorik, Kameraüberwachung und so weiter. Wofür setze ich das denn ein? Was mache ich denn mit diesen Daten? Und wenn die dafür dienen, den Hasen oder das Reh zu erkennen im Feld und die Maschine rechtzeitig zu stoppen, dann werden wir alle sagen, es ist eine tolle Idee. Wenn wir das dafür einsetzen - und da ist China glaube ich kein so schlechtes Beispiel - uns alle in unserer täglichen Umwelt und unserem Leben zu überwachen, dann ist das natürlich schnell sehr gefährlich. Wir sind in dem Projekt und auch in vielen anderen immer auf der Suche nach so wenig Daten wie möglich, so wenig Sensorik wie möglich. Aus einem ganz einfachen Grund, weil all diese Sensorik, all diese Daten müssen ausgewertet und gewartet werden. Also wenn ich eine robuste Lösung suche, dann versuche ich die so schmal wie möglich zu machen. So, das ist jetzt die technische Antwort und die Antwort, die für uns als Benutzer oder auch sogenannte bystander, also Leute die mit dem System eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern nur zufällig dazukommen, relevant ist, ist, dass uns immer klar ist, was passiert denn eigentlich? Was wird denn jetzt hier aufgezeichnet? Wie akzeptabel ist das für mich? Habe ich Möglichkeiten, da einzusteigen? Kann ich mich auch abgrenzen, wie hier genannt wurde, dass die Fotos im Zweifelsfall von hinten passieren? Wenn sie ihre Einwilligung nicht gegeben haben, dann umso mehr. Also wir haben das Thema auf dem Schirm. Es ist allerdings wirklich ein schwieriges Thema, also nicht so leicht zu bearbeiten. Und deswegen wischen wir das nicht weg, sondern fragen dann Kolleginnen, die sich mit Ethik, mit Recht, mit philosophischen Themen auch beschäftigen. Und das ist ein langer Prozess. Aber wir nehmen den durchaus ernst. Ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen helfen.
Vetter: Hat das Ihre Frage beantwortet oder haben Sie da noch eine weitere Frage zu? Ich komme zu Ihnen.
Gast: Ja, ich meinte das auch nicht nur technisch und allgemein, sondern im Besonderen was uns als Mensch ausmacht und ob das unsere Zukunft sein soll? Unsere Gefühle werden ja immer, immer weiter zurückgedrängt dadurch. Also man kann eigentlich, wie soll ich sagen…Entwickeln wir uns als Mensch weiter? Oder ist das zu bestimmend? Wie die Gefahr ja vielleicht besteht?
Prof. Krzywinski: Danke. Jetzt wird die Frage sogar noch ein bisschen größer. Also ich glaube tatsächlich, für Leute, die in der Landwirtschaft groß geworden sind, kann man sagen, dass die extrem wenig Zeit haben, um sich um sich selbst zu kümmern. Landwirtschaft war immer ein Betrieb, der spätestens früh um sechs, bei einigen eher, begann und 22 Uhr eigentlich noch nicht zu Ende war. Da sind die Menschen eigentlich zu kurz gekommen. Viel der maschinellen Unterstützung, die wir jetzt geben können, schafft zumindest so ein bisschen Platz. Viele der Menschen, deren Eltern in der Landwirtschaft sind, sagen für sich selber und das ist für mich genau kein Lebensmodell. Ich will mich als Mensch noch weiterentwickeln und will nicht in einem Rahmen eingepfercht sein, der früh 6 Uhr beginnt und 22 Uhr endet. Ob wir diese Zeit für uns selber tatsächlich nutzen oder im Zweifelsfall dann uns selber wieder mit ganz viel Dingen konfrontieren, Social Media und Co, die uns wieder ablenken, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es zumindest ein Potenzial gibt, das in die Zusammenarbeit von Mensch und Technik, so sie denn gut gemacht ist, uns mehr Raum gibt, um uns selbst zu kümmern. Wie gesagt, das muss man dann tatsächlich selbst in die Hand nehmen. Einige von uns werden das tun, für andere ist es definitiv auch eine Gefahr. Das im System zu vermeiden, wird aber für uns glaube ich schwierig. Das muss man auf einer anderen Ebene, denke ich, bespielen.
Vetter: Danke für die Antwort.
Prof. Krzywinski: Sehr gern.
Vetter: Da hinten war noch eine weitere Frage.
Gast: Ja, mich würde mal interessieren, wenn das Projekt dann in Pillnitz soweit läuft, man hat so einen super Gieß-Roboter, der macht doch erst mal das was er soll und dann merkt man aber später, wenn das Projekt schon zu Ende ist, na ja, der Laufweg ist nicht so optimal oder irgendwas anderes. Gibt es Ideen, wie man dann nach so einem Projekt weitermacht? Also wie stellt man sicher, dass es nicht hinterher eine Feststellung gibt, na gut, ist nicht so optimal, ist jetzt eine Industrie Ruine, steht jetzt da. War eine tolle Idee. Im Extremfall. Gibt es da Konzepte, wie man solche tollen Ideen dann auch weiterführt, optimiert, auch nach Projektende?
Prof. Krzywinski: Also danke, supergute Frage. Das ist glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte an Wissenschaft, wie sie in den letzten Jahrzehnten vielleicht gemacht wurde, dass wir immer genau bis zu diesem Punkt kommen, dass es einmal funktioniert. Dann ist das Projekt zu Ende und dann sind die Nutzerinnen oder Nutzer mehr oder minder alleine gelassen, weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich um das nächste Projekt kümmern. Und das ist auch einerseits super verständlich, weil die Projektorganisation ist halt so angelegt. Dieser Wettbewerb, das Wissenschaftsrad, dreht sich weiter. Aber tatsächlich ist es inzwischen so, dass dieser Transfergedanke und die Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen. Das heißt nicht, dass wir morgen alles besser machen können. Aber in dem Fall mit Pillnitz kann man sagen, dass im Prinzip schon in der ersten Projekt Besprechung die Idee da war, dass das doch, wenn es denn funktioniert, eigentlich was ist, was quasi jeder große Garten in Deutschland brauchen könnte und nicht nur in Deutschland. Und dass es sich lohnen würde, mit diesem Know how vielleicht eine Unternehmensgründung zu machen oder das Know how an ein Partnerunternehmen weiterzureichen. Also diese Ideen gehören jetzt eigentlich fast immer zum Potpourri dazu, würde ich sagen. Wir haben selber bei uns am Lehrstuhl mehrere Ausgründungen. Wir begleiten mehrere Ausgründungen in Dresden mit unseren Kompetenzen. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe 2003 einen Preis gewonnen, noch als Studierender für ein pneumatisches Rettungszelt. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr lang überlegt, ob ich das nicht irgendjemandem verkaufen oder übergeben oder ein Startup machen kann. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe inzwischen echt Studierende, die diese Entscheidung sich viel, viel schwerer machen und rausgehen und gucken. Ich will das erst mal umsetzen. Ich will erst mal schauen, ob diese Idee so tragfähig ist, bevor ich die nächste Idee erforsche. Und das ist total schön. Das, was ich Ihnen noch mitgebracht habe, auch wenn ich jetzt mein Mikro fast verliere. Aber das geht. Das hängt hier hinter der Kollegin. Das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Das ist ein sogenanntes Exoskelett. Die Firma können Sie auch gleich lesen, wenn es hier wieder ordentlich ausgeklappt ist. Und das ist genau das Beispiel für das, was Sie gefragt haben. Eine Diplomarbeit, die sich damit beschäftigt, wie Exoskelette Schultern unterstützen können. Und das ist jetzt ein Serienprodukt. Das heißt, das kann ich jetzt anziehen oder es kann hinterher auch jemand von Ihnen probieren und das hilft Ihnen dabei tatsächlich, die Arme hoch zu halten. Jeder von uns kennt es vom Hecken schneiden oder jeder von uns kennt das, wenn er eine Decke streichen möchte. Das kann ich fünf, zehn Minuten machen, aber nicht viel länger. Und das ist jetzt eine ziemlich einfach zu bedienende Geschichte. Tragen Sie wie einen ganz normalen Rucksack. Und dann kommt der Clou. Sie können Ihren Arm einfach hier einlegen. Machen hier zu. Und dann ist der Arm so einfach oben. Ich kann ihn jetzt mehr oder minder den ganzen Tag entspannt bewegen. Meine Schulter ist entlastet, es verkrampft nicht und ich kann mich darauf konzentrieren, die Decke zu streichen. Oder ich kann den Feder Mechanismus auch so einstellen, dass auch meine Heckenschere entspannt mit hochkommt und ich die Hecke auch einfach anderthalb Stunden schneiden kann, statt fünf, zehn Minuten. Und das dauert. Und das ist außerhalb des klassischen Wissenschaftsbetriebs. Sorgt aber dafür, dass tatsächlich von den guten Ideen, die wir haben, auch ein paar an der Realität ankommen. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen unsere Aufgabe ist, weil am Ende werden wir alle von öffentlichem Geld finanziert und dann wollen wir auch ein bisschen was zurückgeben. Wer das also später gerne ausprobieren möchte, das ist ziemlich erhellend. Können wir gerne machen. Ja, die Exoskelette sind tatsächlich gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch. Die wenigsten von uns haben das inzwischen schon angehabt. Aber es gibt da draußen immer mehr Handwerker, die das jeden Tag benutzen. Das hat jetzt auch diverse Staatspreise hier in Sachsen bekommen, weil es schon ganz schön ist. Das ist das meistverkaufte in Deutschland, das hier aus Dresden von der Idee kommt und mit einem Team von Otto Bock, die die notwendige technische Expertise haben, entwickelt wurde.
Vetter: Dazu weitere Fragen gerne.
Gast: Ich habe das vorige Wochen in „Einfach genial“ gesehen. Dieses Gerät. Stimmt das?
Prof. Krzywinski: Das kann durchaus sein. Ich habe selber es nicht gesehen, aber das würde passen. Das kann ich mir vorstellen. Und hatten Sie da einen guten Eindruck, wäre die Frage?
Gast: Ich habe es ja als Zuschauer nur gesehen am Bildschirm.
Prof. Krzywinski: Dann ist heute die Gelegenheit es selbst auszuprobieren. Am Ende, wenn Sie denn Lust haben.
Gast: Als ich diese Unterstützung gerade gesehen habe, ist mir was in den Kopf gekommen, nämlich, dass damals Steve Jobs für seinen Apple Schriftarten vorgeschlagen hatte, seinen Ingenieuren, seinen Technikern. Und die meinten: wozu zum Teufel braucht man Schriftarten? Das braucht keiner. Deshalb würde mich interessieren, wenn Sie so was machen, zusammen mit Technikern. Wie schafft man das zusammen mit den technischen Experten und den Designern, diesen, ich nenne es mal Konflikt… vielleicht… vielleicht ist er nur in meiner Wahrnehmung, vielleicht gibt es den gar nicht mehr… wie schafft man so was zu moderieren, zu gestalten, dass halt am Ende auch ein Produkt rauskommt, was jeder gerne nutzen möchte, was nicht nur technisch funktioniert, sondern was man zum Beispiel was ich jetzt gesehen habe, auch leicht anlegen kann? Also solche Sachen zum Beispiel?
Prof. Krzywinski: Also tatsächlich nehmen, das glaub ich noch immer, viele als Konflikt war. Wir brauchen diesen Konflikt aber, weil es einfach keine Produktentwicklung mehr gibt und auch eigentlich kein Forschungsprojekt, was eine Person alleine stemmen kann. Und dann überschreite ich immer Grenzen. Das können disziplinäre sein zwischen dem Techniker, der Ingenieurin und dem Designer oder der Designerin. Aber eigentlich brauchen wir dann noch ganz andere Menschen dazu. Da brauche ich nämlich noch einen Arbeitswissenschaftler, der einfach guckt, wie arbeiten denn die Leute? Dann brauche ich hier ganz schnell jemanden, der sich mit der Ergonomie auskennt, um zu gucken, was die Kraft, die ich jetzt hier zwar aufnehme, die ist ja nicht plötzlich weg. Ich leite das, was sie sonst mit meiner Schulter gemacht habe, jetzt in meinen Beckenboden ein. So kann man machen, das ist völlig okay. Aber das wäre auch gut, wenn das jemand prüft. So, und insofern geht es eher darum, diesen Konflikt, wenn er denn auftritt, zu sehen und zu moderieren. Genau wie Sie die Frage gestellt haben. Und da kommt dann ganz viel von dem wieder zum Tragen, was wir im Design eigentlich schon seit 100 Jahren machen. Nämlich, dass man ein gutes gemeinsames Modell erarbeitet. Worüber sprechen wir jetzt? Was ist deine Perspektive? Was ist meine Perspektive? Und es ist gut, wenn man sich verständigt, für wen machen wir das? Das vergessen wir oft. Also das ist etwas, was im Design ziemlich stark in der Ausbildung drinsteckt. Sich zu fragen, bin ich jetzt hier eigentlich jemand, der für mich gestaltet? Das fällt den meisten von uns leicht. Aber das kann ich in meiner Wohnung machen, meine persönliche Einrichtung, meine Wandfarbe. Sonst habe ich immer eine Dienstleisterrolle. Ich mache etwas für andere Menschen, die können älter sein als ich, die können jünger sein als ich, die können einen ganz anderen Hintergrund haben als ich. Und dann kommt es auch irgendwann zu dem Thema Schriftart. Was will ich denn vermitteln mit meinem Produkt? Und zwar nicht bei all dem, was wir alle nicht sehen und was technisch funktioniert, sondern dem, was wir alle sehen und wahrnehmen können. Und dann ist es manchmal sehr gut, wenn ich mich über eine Schriftart differenziere, wenn die Schriftart sehr gut lesbar ist, wenn die Schriftart vielleicht sogar freundlich ist. All diese Dinge kann man auch über Design klären. Nur dann muss man erst mal jemandem sagen, wofür man das macht. Und das ist dann eigentlich immer der Punkt, wo man die Leute auch wieder herholt und die nur sagen Ja, ich mag halt gelb. Das ist halt schwer für jemanden anzunehmen, der eigentlich persönlich eine Vorliebe für Blau hat. Man muss sich davon trennen, dass das eine persönliche Geschichte ist, sondern es gibt eine Argumentation und die Argumentation kann im Fall von Pillnitz halt zum Beispiel lauten, dass wir etwas machen, was möglichst unauffällig ist, weil ich mich in einem Park bewege, wo die Leute für den Park hingehen und nicht dafür, um sich Maschinen anzugucken. Und das andere Extrem ist, was in den letzten 15 Jahren in der Landmaschinen Produktion gemacht wurde, dass ich versuche, die Performance der Maschine auch tatsächlich in das Design zu übertragen und die Maschinen immer größer und aggressiver geworden sind, weil die Leute auch für ihr Geld etwas haben wollen, einen Gegenwert. So, und jetzt habe ich zwei völlig verschiedene Betrachtungsweisen und muss jetzt schauen, für welchen Markt mache ich das jetzt? Und dann bin ich als Designer, als Designerin gefragt, dafür eine gute Lösung zu finden. Das muss man viel ausprobieren. Wir haben im Studio mehrere Projekte, die ich im Team mache. Wir haben mehrere Projekte, die ich mit interdisziplinären Teams mache. Dann lerne ich genau das kennen. Und zwar auch, dass es mir was bringt, den anderen zuzuhören und die andere Perspektive wenigstens mal für einen Moment einzunehmen. Und wenn ich das übe und dabei die Erfolge auch sehe, dann ist das glaube ich auch was, was wir dann später alle im Berufsleben durchaus abrufen können, auch wenn ich das dann weiter pflegen muss. Ich hoffe das beantwortet so ein bisschen die Frage.
Vetter: Weitere Fragen gerne dazu.
Gast: Sind Landmaschinen auch hier ein Thema?
Prof. Krzywinski: Ja, gern, so Sie wollen.
Gast: Warum werden die Landmaschinen so schwer gemacht, dass so eine Bodenverdichtung da ist, die man über Jahrhunderte nicht mehr wieder rauskriegt?
Prof. Krzywinski: Das ist leider tatsächlich das Ergebnis von einem klassischen Wettbewerb: Höher, schneller, breiter. Und wenn ich halt eine Maschine nur über die Performance und nicht über die Gesamtbetrachtung verkaufe, dann hat das auch seine Berechtigung. Es hat halt die Vorgabe, dass meine Landmaschinen in Deutschland klassisch sich im Straßenverkehr bewegt. Das heißt, ich kann sie nicht viel breiter machen, womit ich die ganze Masse, die ich da hinbringe, um höhere Motorleistung überhaupt umzusetzen, dass ich die wieder wegkriegen würde. Insofern habe ich eine immer größere Verdichtung. Selbe Aufstandsfläche, größere Masse, höhere Bodenverdichtung. Und das kann ich natürlich am Ende des Tages nicht gewinnen. Deswegen müssen wir die Landwirtschaft insgesamt auch umstellen, weil jetzt habe ich halt einen verdichteten Boden. Das ist noch okay, wenn ich da Getreide anbaue, weil da nehme ich immer dieselben Fahrspuren. Aber wenn ich da was anderes anbauen möchte oder sogar wechseln möchte, dann muss ich immer tiefer graben, um den Boden aufzulockern. Oder die Schäden im Wald. Da brauchen wir nur rausgehen. Die sehen wir jedes Mal. Mit den Schneisen, auf denen das Holz da raus transportiert wird. Dass ich da eine Bodenzerstörungen hervorgerufen habe, die ich in den nächsten 50 Jahren im Zweifelsfall nicht wieder in Ordnung bringen kann. (...) Aber das ist ein langer Prozess. Ich habe tatsächlich, das ist ja die Frage von dem Vorredner auch schon, ich muss halt viele Leute mitnehmen. Der Agrarwirt, der damit Geld verdienen muss, die Gemeinde, die das Feld irgendwie bestellt und jetzt mehr Heterogenität statt immer nur homogener Flächen haben will. Wir als Verbraucher, die wir bereit sein müssen, dafür dann noch mehr Geld zu bezahlen. Und so weiter und so fort. Diese Kette ist schier unendlich. Und das immer so kompakt zusammenzubringen an einem gemeinsamen Gegenstand, das ist auch ein Thema, weshalb ich heute hier sitze. Weil dafür brauchen wir oft eine Nische, ein kleines Beispiel, an dem man sagen kann, dass es überhaupt funktioniert. Und wenn die Leute gesehen haben, dass es funktioniert, dann müssen die rausgehen und sagen Okay, lasst es uns anfangen. Solange man da sehr abstrakt und über große Dinge spricht, kommen wir da selten so richtig gut voran. Also die Vision kann man zwar denken, aber oft nur in kleinen Schritten umsetzen. Und dafür braucht es dann eine ganze Menge Durchhaltevermögen.
Vetter: (...) Genau, jetzt die Frage nach den Biobauern, die dann auf diesen Flächen nicht mehr produzieren können.
Prof. Krzywinski: Also tatsächlich haben wir im Gegensatz zu dem Projekt, was ja noch immer relativ technisch ist, also das wäre eine Maschine, die nur noch 6 Meter breit ist statt bisher Arbeitsbreiten von zwölf oder 18 Metern. Dafür brauche ich viele Maschinen. Damit verteilt sich die Bodenbelastung aber. Ein ganz anderes Beispiel völlig am anderen Ende, aber mit Biobauern hier zum Beispiel Podemus aus der Region entwickelt: Das ist gar keine technische Bodenbearbeitung wie das, sondern - jetzt lachen sie nicht - Bodenbearbeitung mit Hühnern. Ich habe also einen Laufkäfig, den ich über die Ackerfläche bewege. Und während die Hühner die Reste des Getreides picken, scharren die den Boden auf. Das reicht durchaus dafür, um den Boden so zu lockern, dass er eigentlich wieder in seinen Vegetationsrhythmus kommt. Nur jetzt erklären Sie mal jemandem, der bisher diese Maschine gefahren ist, dass er das jetzt alles zur Seite legen kann und jetzt bitte dafür 100 Hühner auf seinem Acker laufen lässt. Da ist eine riesige Diskrepanz. Und dann haben wir jetzt noch ganz viele Menschen, die sich inzwischen vegan ernähren. Oder es werden immer mehr, sagen wir mal, vielleicht noch nicht ganz viele. Das heißt, möglicherweise brauchen wir gar nicht mehr so viele Hühner und auch nicht so viele Eier. Aber so ein Projekt, das haben wir jetzt in dem Status, dass wir es mit Podemus umsetzen können. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr wird. Das bedeutet dann tatsächlich, dass wir dieses ganze Thema Bodenaufbereitung an einem ganz anderen Punkt noch mal anfassen können zu.
Vetter: Ja, danke für die Frage. Gerne - eine weitere Frage.
Gast: Ich bin ja absoluter Laie auf dem Gebiet, aber ich gebe zu bedenken: könnte es sein, dass der Boden, die Erde, auf der wir leben und der Boden ein lebendiges System ist? Und dass man das zu wenig berücksichtigt?
Prof. Krzywinski: Oh, da bin ich jetzt natürlich nicht der Fachmann, aber da sind vermutlich ein paar Fachleute hier im Auditorium. Also ich glaube, dass wir an vielen Stellen die Lebendigkeit und Komplexität dieser Systeme neu erlernen. Wir haben es halt ganz lange nicht gesehen. Ob das jetzt immer ein lebendes System ist, wie der Boden oder ein komplexes System wie der Verkehr in einer Stadt. Wir haben halt ziemlich lange Zeit versucht, es zu vereinfachen, damit wir das möglichst schön lösen können, möglichst effizient. Dabei sind uns oft viele Parameter hinten runtergefallen, weil es zu komplex war, die zu beachten. Ob wir damit immer allen Dingen jetzt schon gerecht werden? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir jetzt verstanden haben, dass die Dinge komplizierter oder auch manchmal echt komplexer sind, als wir uns das eingestehen mögen. Und dass wir da ziemlich gut daran tun, das zu verstehen und dann besser da zu starten. Das ist vielleicht zumindest eine vorsichtige Antwort. Wie gesagt, ob wir uns das immer richtig ausmalen oder jetzt schon ausmalen können, das weiß ich nicht.
Vetter: Hat das Ihre Frage soweit beantwortet? Okay. Danke. Dann weitere Fragen aus dem Publikum?
Gast: Ja, die Bodenfrage hat mich etwas inspiriert. Man könnte ja immer rausgehen ins Feld und Feldversuche machen. Man hat eine Idee und geht direkt raus in die Realität und probiert es aus. Und der andere Gedanke wäre, ich versuche in Zeiten, wo man heute Hochleistungsrechner hat, das Ganze zu simulieren. Und ich hätte gerne mal ihre Meinung dazu. Vielleicht haben sie auch Erfahrungen schon dazu gesammelt, wie sich diese beiden Welten zueinander verhalten? Ob sie vielleicht sagen, na ja, die Simulation ist gerade in den Kinderschuhen oder die wird die Realität nie abbilden, oder… ja. Einfach mal ihre Sichtweise auf diese zwei Welten - Realität und gegebenenfalls Simulation. Sie haben ja auch das ganze Gerät 3D gedruckt. Erst mal man hätte es ja auch als CAD Simulation irgendwo im Rechner haben können.
Prof. Krzywinski: Ja vielen Dank für die Steilvorlage. Da ist es uns tatsächlich ein Anliegen, das auszuprobieren. Und jetzt auch wieder nicht lachen. Aber Sie können diese Maschine aktuell in einem der beliebtesten Computerspiele, dem Landwirtschaftssimulator, spielen, obwohl es die noch nicht gibt. Das war ein Prozess von über fünf Jahren. Dahin zu kommen, dass man ein kommerzielles Spiel mit einer Maschine ausrüstet, die es möglicherweise auch nie in Serie geben wird. Weil normalerweise, das ist tatsächlich ein super beliebtes Spiel, in dem ich im Prinzip nahezu jede Agrarmaschine weltweit spielen kann. Also da ist Klaas dabei, da ist Fendt dabei, ohne zu viel Werbung zu machen und all die anderen Großen. Und bisher läuft das Spiel so, dass ich, entweder als Laie, oder es spielen auch ziemlich viele Agrarwirte selbst, mir meinen Maschinenpark zusammenstelle. Und da kann ich Dinge spielen, die ich auf meinem Feld bisher nicht machen kann. Oder ich kann in einer Landschaft spielen -das passt zu hier- dann bin ich halt in Mecklenburg Vorpommern, aber spiele eigentlich in meiner Ranch in Montana, ganz andere Vegetationszone. Das geht da alles. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass ich den bisherigen Maschinen tatsächlich einen neuen Maschinen Typ gegenüberstellen kann. So, und das ist ganz weit weg von der klassischen wissenschaftlichen Simulation, die wir bisher betrieben haben, weil das lässt wieder ganz viele Parameter außen vor, aber dafür kostet dieser Simulator auch nur 29,95 € und nicht mehrere 10.000 €, die ich sonst in den Großrechner investiere oder in die Software, um die überhaupt erst mal zu programmieren. Und ich habe nicht nur ganz wenige Nutzer wie typischerweise im Wissenschaftsbetrieb, sondern eine große Community, an die ich das eigentlich rausgeben kann. Das ist sozusagen die eine Hälfte der Frage und die andere Hälfte der Frage, das kommt jetzt vielleicht wieder zu dem vorher genannten Thema, dass wir nicht nur über Maschinen, sondern auch über Boden sprechen. Wir haben mit Berliner Kollegen aus dem ZALF, die betreiben Landforschung für die ganze Agrarlandschaft, also auf einem anderen Level als das, was ich gerade beschrieben habe. Und die haben das gemacht, was Sie jetzt beleuchtet haben, nämlich ein Versuchsfeld. Das ist das sogenannte Patch Crop. Da hat man ein sehr großes Feld in kleine Felder geteilt, so wie eine Patchwork Decke können Sie sich das vorstellen, sieht es dann aus. So, dass ich ziemlich gemischte Landschaften erreiche, die aber wahnsinnig schwer zu bearbeiten sind. Also in keiner Weise effizient, um damit Geld zu verdienen. Weil unsere Maschinen sind dafür viel zu groß. Und ich kann auch nicht mal los fahren, wenn ich schon wieder anhalten muss, und eigentlich die nächste Frucht da drauf bringe. Trotzdem muss man das mal machen, um überhaupt zu sehen, was passiert denn da. Passieren die Effekte, die wir uns alle ausmalen? Denn auf solchen Feldern ist es der richtige Punkt. Es gibt noch ganz andere Ansätze, sogenanntes spot farming. Da sind das nicht mal mehr Quadrate wie auf meiner Patchwork Decke, sondern das sind nur noch Kreise. Und ich kann jetzt diese Kreise total eng verzahnen. Da steht dann Mais und da steht irgendwas anderes daneben und dann kommt wieder Mais. Und so weiter und so fort. Da treiben wir die Leute, die über solche Maschinen nachdenken, noch mehr in den Wahnsinn. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist, denselben Simulator dafür zu verwenden, diese Landschaft jetzt noch mal in großem Maßstab zu bespielen. Das heißt, wir können jetzt viel, viel mehr Felder im Simulator anlegen. Wir können die viel schneller durch ein ganzes Jahr laufen lassen und das ist für uns sehr spannende Punkt. Wir können jetzt plötzlich Roboterschwärme nehmen und damit diese Felder bestellen. Damit kann ich zum Ersten Mal sagen, dass es möglich wäre, ein so kleinteiliges Feld jetzt tatsächlich so zu bestellen, dass damit Geld zu verdienen wäre. Das ist ja im Endeffekt leider oft der Dreh und Angelpunkt, um den es geht. Und das wäre draußen gar nicht möglich, weil ich erstens an die Vegetationszeiten mich halten muss, zweitens gar nicht so viele Schwärme verfügbar habe, außer ich investiere massiv Geld. Und insofern bewegen sich diese beiden Welten, denke ich, deutlich aufeinander zu. Und wir machen es jetzt da so, dass wir im Prinzip denselben Durchlauf auf beiden, im Realfeld wie im Simulator, haben und dann immer halbjährlich abgleichen. Das ist die Idee. So. Aber das ist, also das ist wirklich ein Feld, da ist super viel Spannung drin, weil wir haben ja in Dresden auch wirklich noch mal und in mehreren Städten Deutschland in so Großrechner investiert und versuchen da mit wirklich wahnsinniger Rechenpower die Simulationen aufzulösen. Aber an anderer Stelle ist diese Rechenpower gar nicht das entscheidende Momentum, sondern die systematische Perspektive. Und dann muss ich vielleicht viel, viel mehr Variationen spielen, die ich bisher in dem Rechner gar nicht so gut abgebildet habe, weil ich noch nicht genau weiß, was eigentlich passiert. Spannendes Feld weit außerhalb des Designs, aber da können wir uns noch auf ziemlich viele Erkenntnisse freuen, glaube ich.
Vetter: Weitere Fragen oder Rückfragen dazu? Gerne..
Gast: Ich würde noch was dazu ergänzen wollen. Mit den Simulationen, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja Forstwissenschaftler und stecke da in Simulation nicht so richtig drin. Aber es ist meine Meinung, dass eine Simulation ja nur so gut sein kann wie die Eingangs Parameter. Und wenn wir jetzt mal vom Boden ausgehen, vom Edaphon, also diese Boden Gesamtheit, wenn wir davon nur 80 % verstehen und in eine Simulation geben, dann kann letztendlich das Optimum der Simulation wahrscheinlich maximal 80 % erreichen. Also ich weiß es nicht, aber das ist jetzt so meine laienhafte Vorstellung. Und meiner Meinung nach krankt es einfach wirklich daran bei vielen Prozessen, dass einfach viel zu wenig bekannt ist und einfach diese Verzahnung zu wenig erforscht ist. Gerade eben was Boden angeht. Wenn wir uns vor Augen führen, dass momentan gerade zu diesem Zeitpunkt über 50 % der weltweiten Agrarflächen devastiert sind. Über 50 % der weltweiten Agrarflächen. Die haben sozusagen ihren Produktivitätskipppunkt schon erreicht. Nur durch diese jahrhundertelange oder jahrhundertelange noch nicht ganz, aber jahrzehntelange im Industriezeitalter, Ausbeutung und eben Bodenverdichtung das Thema, was wir schon hatten und eben Nichtbeachtung dieser biologischen Grundsätze, die da einfach in diesem super komplexen Thema Boden mit drin sind. Und die Produktivität sinkt. Das ist schon was Jens gesagt hat. Jetzt findet es eben langsam Beachtung, aber erst sehr spät, vielleicht zu spät. Fragezeichen. Und das ist so ein Punkt, der bringt mich jetzt noch zu einer anderen Geschichte. Vielleicht auch eine Steilvorlage oder ein schwarzes Loch. Wir werden dann sehen. Aber das hatten Sie ja schon mit angesprochen. Meine Meinung ist, Wissen kann sich nur vermehren, wenn man es teilt. Und da hattest du gerade was gesagt Jens, deine Überlegung marktwirtschaftlich im kleinen Bereich zugänglich machen, dann eben dem Kapital opfern, sage ich jetzt mal provokant, oder eben breit streuen und dann sozusagen Forschung zulassen, wie zum Beispiel eben so eine Laien Forschung im Simulator. Also gibt es da von dir einen Standpunkt mit dieser Open Data Geschichte?
Prof. Krzywinski: Ja. Also, diese marktwirtschaftliche Perspektive ist zunächst, du hast es schön zugespitzt, für mich kein Opfer. Also in der Nachhaltigkeits Pyramide gibt es ja trotzdem immer eine ökonomische Perspektive und die ist auch gut die einzuhalten. Auch wenn ich jetzt..das muss ja nicht immer ein klassisch kapitalistisches Modell sein, das kann auch genossenschaftlich sein oder oder oder…. Aber wenn damit niemand am Ende Geld verdient, um die Dinge anzuschaffen, dann werden wir es auch nicht umsetzen. So diese Diskussion um Offenheit, die wird, glaube ich, an vielen Punkten gespielt und wir versuchen auch dafür einfach dem Wissen den Boden zu bereiten. Um im Bild zu bleiben, dass mehr Offenheit tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt, dass ich nicht klassischerweise meine Erkenntnisse für mich behalten muss, um sie dann selbst ausbeuten zu können oder monetarisieren in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Sondern dass ich gut daran tue, viel davon direkt zu teilen mit einer Community oder eine Gemeinschaft, die möglichst dann den nächsten Schritt gehen kann. Aus persönlicher Überzeugung, aus anderen Rahmenbedingungen, aus einer anderen Perspektive heraus. Wichtig ist halt nur, dass dieses Teilen sozusagen zu mir in irgendeiner Form zurückfließt. Also, es reicht halt nicht, die Daten einfach nur irgendwohin zu stellen, sondern ich muss dann Teil der Gemeinde bleiben, die mit diesen Daten arbeitet. Und das ist durchaus wieder aufwendig. Dafür sind wir eigentlich weder in der Wissenschaft noch in der Wirtschaft bis jetzt gut aufgestellt, um das zu tun. Also wir haben hier mit ziemlich vielen Entwicklungsabteilungen zu tun und die sind oft schon überfordert. Ohne denen jetzt nahe treten zu wollen, das Know how in ihrer eigenen Firma tatsächlich im Blick zu haben, weil die so ausdifferenziert sind, dass schon das schwierig ist. Und dann soll ich plötzlich noch meine Erkenntnis nach draußen geben, angeschlossen sein, was dann damit passiert, um dann ein Best of wieder zu mir zurückzuführen. Das ist bis jetzt eigentlich noch nahezu unmöglich, weil wir da organisatorisch noch ganz andere Dinge tun müssten. Also ich glaube, ist ein wirklich spannendes Thema, aber bis jetzt noch eher so schlecht vorbereitet von unserer Seite.
Vetter: Ja gerne. Eine weitere Frage dazu.
Gast: Wären dann aber die Die Antworten dann zur nächsten Frage…
Prof. Krzywinski: So soll es ja sein im Dialog.
Gast: Wenn in Pillnitz dann ein Roboter entwickelt ist, der das Wasser zu den Pflanzen bringt und dann ein Gastronom sagt Ah, ich bräuchte aber auch einen Roboter, der das Wasser zu den Gästetischen bringt. Oder ein Chemiefabrikant sagt: Ich brauche einen Roboter, der mir das Lösemittel zur Extrudiermaschine bringt. Also der Kern der Frage ist, wie schafft man es, die Lösung, die man einmal entwickelt hat, für eine Umgebung, auf eine abstrakte Ebene zu heben und zu sagen, ich kann diese Lösung eigentlich auch woanders noch mal in abgewandelter Form natürlich verwenden? A. Und B: passiert das auch?
Prof. Krzywinski: Also meine spontane Antwort wäre wie gerade eben der Wunsch ist überall da. Allerdings haben wir auch dafür eher schlecht vorbereitete Strukturen. Also wäre ja klassisch eine Aufgabe von Wissenschaft aus einem sehr konkreten Anwendungskontext jetzt eine abstraktere, möglichst adaptierbare, eine flexible, modulare, wie auch immer man das nennen mag, Lösung wieder abzuleiten und die dann wieder zu verteilen. Vielleicht ist das eine der Ideen, die wir im Wissenschaftsforum im Kulturpalast haben, dass man da sagt, wir zeigen tatsächlich den Roboter aus Pillnitz und dann kann jemand anders hingehen und sagen: Ja, das ist doch eigentlich auch was, was bei mir helfen könnte. Wir haben gleichzeitig ein Projekt mit Riesa, mit der Handwerkskammer und den Restauratoren in Riesa im Rittergut. Die machen im Prinzip das gleiche wie Ihr in Pillnitz. Die probieren aus, wie in der klassischen Sanierung und Restauration Roboter überhaupt eingesetzt werden könnten. Weil ich da besonders kleine Teams habe, weil wir eigentlich viel mehr Sanierung tun müssten als Neubau, aber Sanierung aufwendig, teuer und oft sehr individuell ist. Aber die sind…hilflos, ist übertrieben. Aber für die ist diese Roboterwelt bisher auch eine hochgradig automatisierte und eine mit so sieben Siegeln verschlossene. Da erst mal ein paar Dinge jetzt viel näher zu bringen, ist unsere Aufgabe. Was man dafür bräuchte, wäre, glaube ich, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, eine andere Form des organisierten Austausches. Und ein Interesse an diesen, sagen wir mal mittelabstrakten Beispielen. Also ich brauche ein Beispiel, was mir sagt so könnte das gehen, dem muss ich ausreichend vertrauen, damit ich sage, das funktioniert schon, das Risiko ist nicht mehr so hoch. Dann brauche ich jemanden, der mir hilft, es auf meine Branche zu transferieren. Und dann kann ich selber eigentlich wieder den letzten Schritt gehen. Nämlich das Ausdetaillieren in meiner Branche, das können die meisten Unternehmen und die meisten Wissenschaftlerinnen könnten das auch. Aber für diese Brücke in der Mitte haben wir eigentlich wenig Leute und wenig Strukturen, die das machen. Es gab bisher in sehr wenigen Strukturen Anreize dafür, das zu machen. Also weder kann man damit publikationsmäßig im Wissenschaftsbetrieb gewinnen, also eine Neuheit in einem Gebiet auf ein anderes zu übertragen. Das geht nur, wenn ich tatsächlich in dem anderen Gebiet wieder Expertise habe, weil die Publikation kann ich nur in dem neuen Wissenschaftsgebiet machen. Das heißt, das ist schon ein ziemlich großer Schritt, den ich da machen muss. Deswegen bleibt da auch viel liegen. Und in der Industrie ist das auch ähnlich. Dass ich jetzt tatsächlich systematisch rausgehe und in anderen Branchen die Innovationen darauf prüfe, ob sie bei mir anwendbar wären. Das haben wir bei super wenigen Partnern erlebt. Das ist tatsächlich eine ziemlich komplexe Fragestellung, und das müsste ich pflegen und systematisch machen. Und mittelfristig und das sind wir wieder bei diesen kapitalistischen Modellen, das widerstrebt halt noch immer vielen Unternehmen. Wenn ich halt sage, okay, da muss ich jetzt was aufbauen, das wird in den nächsten zwei Jahren vielleicht nicht direkt einen Umsatz, Gewinn abwerfen, sondern es ist die Pflege und den Aufbau in den Invest und danach kann ich daraus schöpfen. Das ist für viele leider schon zu langfristig und das ist schade. Aber das ist momentan noch an vielen Stellen der Status.
Gast: Also ein Gedanke kommt mir dazu. Ich hoffe es wird kein Dialog, sondern dass die anderen auch noch mal gerne eine Frage stellen dürfen. Im Softwarebereich fällt mir das auf, dass es da unglaublich viele Leute gibt, die Dinge entwickeln und frei zur Verfügung stellen. Und ich frage mich immer was ist dort anders? Es wird unglaublich viel öffentlich zur Verfügung gestellt und trotzdem ist die Softwarebranche eine Branche, wo momentan sehr viel Geld verdient wird, wo unglaublich viele Arbeitskräfte gesucht werden, wo gerade das nicht gemacht wird, wo man sich eben nicht abgrenzt, sondern wo man für die Community entwickelt. Haben Sie eine Idee, warum das im Softwarebereich so ist und in anderen Bereichen nicht so?
P3: Also das wären tatsächlich jetzt ziemlich spontane Prognosen, ohne dass ich die wirklich untersetzt hätte. Trotzdem möchte ich sagen, dass es gerade ein Projekt gibt, was versucht, Open Source Software Gedanken für Open Source Hardware mal zu transferieren. Das ist ein Konsortium hier aus Dresden, die sind gerade erst gestartet. Ich bin neugierig, was da passiert. Meine persönliche Lesart wäre, dass die Hardware Investitionen oft höher sind als die Software Investitionen. Das schränkt dieses Tauschen oder Offenlegen meines Erachtens nach ein. Und dass die Community, aus der heraus Open Source betrieben wird, tatsächlich einfach keine Geschichte im Hardware Bereich hat. Also das ist tatsächlich ein anderes Verständnis. Man hat, wenn man sich mit Software beschäftigt, glaube ich von Kindesbeinen an einen Kontakt zu Open Source gehabt und hat gesehen, dass das coole Leute sind, die cooles Zeug teilen. Und es gibt ja auch da, sagen wir mal ein Modell, dass das tatsächlich für mich erstrebenswert ist, so was zu machen. Das kann ich bei Hardware überhaupt nicht sehen. Also außer vielleicht in der Selbsthilfe Werkstatt für Fahrräder gibt es total wenig, wo man Hardware für alle öffentlich zur Verfügung stellt oder es erstrebenswert wäre, das zu tun. Also man kann das glaube ich gerade sehr schwer lernen. Und also das vielleicht zugespitzte Beispiel, ohne dass man immer zu Elon Musk gucken muss. Aber, dass die NASA ihren sehr beschränkten Hardware Bereich geöffnet hat, lag ja nur daran, dass sie plötzlich verstanden oder nach vielen Jahren verstanden haben, dass ihr Weg halt jetzt nicht mehr weitergeht. Und hätte es kein Desaster gegeben um das Raumfahrtprogramm, dann hätten wir das wahrscheinlich 50 Jahre später immer noch nicht geöffnet. Und dieser geöffnete Markt im Hardware Bereich ist jetzt wieder nur bedingt geöffnet. Es war ein kurzes Zeitfenster, dass der Markt mal plötzlich offen war für Raumfahrt und man da was anbieten konnte. Jetzt haben wir eigentlich wieder geschlossen und es sind wieder nur Monopole. Und es ist ja nicht so, dass das Open Source geteilt wird. Man kann jetzt maximal Ladung zu einem günstigeren Preis kaufen als früher bei der NASA. Aber das heißt nicht, dass man jetzt selber irgendwo hinfliegen könnte. So. Also ich würde mir das wünschen. Dafür bräuchten wir aber im Hardware Bereich eine andere Betrachtung von Schnittstellen. Das ist vielleicht der letzte Punkt. Das ist im Softwarebereich gang und gäbe, dass ich weiß, dort endet meine Software und ich brauche irgendein Übersetzungsprogramm, um dann damit weiter zu machen. Auch das ist ja am Hardware Bereich - also ich will nicht sagen völlig absurd - aber wir alle gucken zurück auf die USB-Stecker an den Telefonen. Wir haben es jetzt seit über 25 Jahren zum ersten Mal geschafft, dass alle Telefone, zumindest neuere Generationen, über USB C zu laden sind. Dafür haben wir 25 Jahre gebraucht, obwohl das eigentlich überhaupt keine kritische Infrastruktur für das Handy ist. Es geht nur darum hat es Saft oder nicht? So.
Vetter: Aus dem Bereich vielleicht noch eine Frage?
Prof. Krzywinski: Oder gern wieder zurück. Wir haben ja nun einen ziemlich weiten Bogen von Boden zu Handys gespannt.
Vetter: Vielleicht habe ich noch eine Frage. Wir sind auch im Wissenschaftsjahr 2022 und ich habe da auch noch eine Frage aus dem Internet. Da gibt es verschiedene Fragen, die es zu verschiedenen Themen gibt. Da ist auch eine Frage: wie können Menschen, die der Wissenschaft skeptisch gegenüberstehen, erreicht werden? Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel so eine Veranstaltung heute. Aber welche weiteren Möglichkeiten gibt es?
Prof. Krzywinski: Ich glaube, die Hauptaufgabe an uns, wenn ich es sage, uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wäre, sich einigermaßen verständlich auszudrücken. Ich hoffe, das ist mir heute zumindest in weiten Fällen gelungen. Dafür müssen wir halt unsere Fachsprache mal zur Seite legen. Das wäre schon mal das Erste. Ich glaube, und da brauchen wir gemeinsam ein bisschen Übung, es braucht halt wirklich ein Dialogformat. Also das muss genauso mit Zuhören beschäftigt sein wie mit Sprechen. Das versuchen wir heute und es ist für Sie an manchen Stellen wahrscheinlich ähnlich schwierig wie für mich. Und ich glaube, was eine hohe Motivation wäre, ist, wenn klar ist, worum geht es denn jetzt eigentlich? Also was erreichen wir mit diesem Dialog? Kann ich da was in meinem Ort, in meiner Straße für mich als Person erreichen? Solange das immer sehr abstrakt bleibt, ist das, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie die Frage von wie viel Invest muss ich machen, um am Ende mal was zu bekommen? Ich glaube, das ist für uns persönlich auch eine Frage. Und umso klarer das ist, was habe ich davon, mich hier zu beteiligen, umso besser. Gleichzeitig ist das auch ein hohes Gut. Mit diesen Partizipationsformaten, also Beteiligungsformaten dann auch vorsichtig umzugehen. Also wenn ich Leute schon mal dazu bringe sich zu beteiligen, dann muss auch sichergestellt sein, dass ihre Meinung dann auch in irgendeiner Weise relevant für den Prozess ist. Das machen wir leider noch immer oft genug, dann einfach zwischen streuen. Jetzt haben wir mal alle Leute gefragt, aber eigentlich war vorher schon klar, was passieren würde. Dann brauche ich das auch nicht machen.
Vetter: Gibt es denn sonst weitere Fragen dazu? Ja, gerne.
Gast: Ich fand das auch ein sehr, sehr schönes Format. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Als wir angefangen haben, den Garten Roboter für Pillnitz in den Anfängen mit ins Boot zu holen, da gab es im Dezember letzten Jahres eine Bürgerdiskussion. Da weiß ich nicht, ob das jemand gehört hat. Der Kanal war zugegebenermaßen etwas eng. Also das Thema ist jetzt auch nicht so geeignet, da wirklich die breite Schicht zu bespielen. Aber die ich glaube, es waren knapp 50 Leute insgesamt, die mit partizipiert haben. Das war ein sehr angenehmer, fruchtbarer Austausch. Und es ging auch wirklich darum, wie ist die Akzeptanz überhaupt? Wir haben in den Social Media, als wir das Thema verbreitet haben, festgestellt, das ist relativ negativ konnotiert. Da haben wir gesagt, der an Pillnitz soll ein Roboter entwickelt werden, der die Gärtner unterstützt. So die Kommentare unten drunter, das war der Wahnsinn. Also der Mensch muss die Marschinen ersetzen und gibt es ja gar nicht und ganz schlimm und schlecht und und deswegen fand ich das Format total klasse, dass die Bedenken gehört wurden. Wir haben uns ausgetauscht, genau wie du es gesagt hast. Und es gab eben auch Ansätze von Lösungen. Also wo geht die Reise hin, dass man das ganz klar kommuniziert. Und das war eben sehr schön. Und solche Formate, die finde ich total klasse. Eben genau wie heute. Und ich möchte nochmal betonen, dass was wir im Klimawandel Projekt machen, auch gerade die ganze Roboter Geschichte in Pillnitz. Die kommunizieren wir ganz transparent und offen auf dem Wissens Portal vom Schlösser Land. Also jeder Schritt der durchgeführt wird, wenn es denn so Meilenstein mal wieder geschafft hat, der wird da kommuniziert und bebildert. Und wie du schon sagst, es möglichst niederschwellig, niedrigschwellig, nicht niederschwellig, ohne sich da irgendwo im Wissenschaftsbereich zu verlieren. Weil das ist genau der Ansatz, wenn man sich wirklich hochfloskelt dann nimmt man niemanden mit.
Vetter: Danke schön.
Prof. Krzywinski: Insofern gerne mal reingucken. Das ist wirklich ja auch nicht nur für unser Projekt. Es gibt da auch noch andere Projekte. Das ist durchaus ein schönes Angebot, eben auch aus einer Interessenslage heraus. Also die klassische Wissenschaft berichtet über das, was sie selber tun, sondern ihr berichtet über Dinge, die eure Arbeit betreffen, mit wissenschaftlicher Unterstützung. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. So. Entschuldige. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Vetter: Kein Problem. Ich wollte nur kurz bevor ich es gleich noch vergesse, hinweisen. Es gibt hinten noch eine Box. Ich hatte gerade schon das Wissenschaftsjahr angesprochen. Das heißt auch weitere Fragen, die noch offen stehen, oder gleich im Anschluss kann man sich auch nochmal auf ein Kärtchen schreiben und in die Box werfen. Genau. Aber wir hätten jetzt noch so für ein, zwei Fragen hätten wir noch Zeit. Also gerne. Was möchten Sie gerne noch an den Dozenten fragen?
Prof. Krzywinski: Was war denn der Punkt, weshalb Sie heute gekommen sind? Vielleicht können wir das einmal kurz reihum geben.
Vetter: Das ist auch eine gute Frage.
Prof. Krzywinski: Sind Sie häufiger Gast hier im Botanischen Garten? Sind Sie wegen des Themas gekommen? Was auch immer… Du kannst ja mal das Mikrofon kreisen lassen.
Gast: (...) Warum ich gekommen bin? Aus Neugier.
Prof. Krzywinski: Sehr schön.
Gast: Auch, weil ich bin 89 Jahre. Weil ich oft in den Botanischen Garten gehe und weil mich auch andere Probleme so umtreiben. Zum Beispiel, dass wir 60 % unserer landwirtschaftlichen Produktion für Tierfutter ausgeben. So was bewegt mich. Und ich finde das Herangehen, was ich hier gehört habe, sehr, sehr interessant und gut und möchte Sie auch anregen, weiterzumachen und… die größeren Probleme…Klimaschutz galoppiert und so weiter nicht aus dem Auge zu lassen.
Prof. Krzywinski: Vielen Dank. Sehr motivierendes Statement.
Vetter: Ja danke. Ich gehe einfach mal so rum.
Gast: Ja, ich bin hier, weil ich eigentlich dieses Wochenende auf einem Nachhaltigkeits-Festival unterwegs war und als ich das Programm gesucht habe, ist irgendwie ein Google Mechanismus angesprungen, der das Wort Nachhaltigkeit auch hier gefunden hat. Und deshalb, heute Morgen haben die Workshops dort geendet und heute ist mein Nachhaltigkeitstag da und deshalb bin ich dann auch hierher. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn mich Leute mal fragen, was ich bin als Beruf, dann sage ich immer Generalist. Also mich interessieren viele Themen und ich denke, wenn wir Probleme lösen wollen, gesamtgesellschaftlich, muss man das von verschiedenen Blickpunkten betrachten. Und deshalb setze ich mich immer gerne auch in Foren hinein, wo ich erst mal glaube, erst mal nicht hin zu gehören, weil ich kein, wie sagt man, Gartenbau-Ingenieur, bin und so was in der Art, aber einfach mal in so eine Welt einzutauchen, das finde ich immer ganz spannend.
Prof. Krzywinski: Und ich hoffe, sie haben es jetzt nicht bereut, hier zu sein, auch wenn sie nicht die ursprüngliche Planung war.
Vetter: Dankeschön.
Gast: Ja, ich bin spontan hierhergekommen und hab halt das gelesen am Eingang und habe gedacht, einfach mal anhören. Es wird immer interessant sein.
Prof. Krzywinski: Super! Das ist doch schön.
Gast: Ich finde auch gut, dass man solche Dialoge auch mal von der Wissenschaft mit dem Bürgertum da vermittelt beziehungsweise anbietet. Weil es immer gut zu wissen, was will der Bürger, was bedrückt. Was hat der Bürger halt auf dem Herzen. Egal ob positiv oder auch Kritik, dass man daraus auch solche Dialoge führt und sich halt nicht nur die positiven Sachen anhört, sondern auch sagt man hört sich mal die Kritik an, dass es Leute gibt, die dagegen sind oder halt ihre Zweifel an der einen oder andere Sache haben und dass man sagt, auch dafür halt mal eine Lösung zu finden, dass man solche Leute halt zufriedenstellen kann.
Prof. Krzywinski: Super, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind.
Gast: Also ich habe einfach die Veranstaltung in irgendeiner Email wahrscheinlich gesehen, von der TU. Dachte ich mir, ich komme einfach mal vorbei. Also ich habe auch keinen Bezug zum Thema Landwirtschaft oder so vorher gehabt und fand das jetzt ziemlich interessant, was alles gerade entwickelt wird.
Prof. Krzywinski: Sehr gut. Insofern: trotz Wind weitererzählen! Ich glaube von der TU Dresden sind zu wenige Leute hier.
Gast: Also, wir sind zusammen hier und wir haben heute einen Ausflug in großen Garten gemacht worden. Wir sind vielseitig interessiert und waren erst im Palais. Die Ausstellung von den Kunststudenten hier war auch sehr interessant. Ja, und dann hatten wir hier, wir gehen auch öfters mal in den Botanischen Garten, das Schild gesehen und dachten, das hören wir mal an. Und wir fanden es auch sehr interessant. Also ich bin Gartenbauingenieurin, aber ich habe weiter keine Fragen. War interessant. So. Fanden wir gut, dass wir teilgenommen haben. Und wir bedanken uns recht herzlich, dass wir neue Information aufnehmen konnten und erstmal in Ruhe alles verarbeiten.
Prof. Krzywinski: Na, vielen Dank. Du bist doch.
Gast: (…) Also hat man schon gesagt, wir sind ja gemeinsam in das Projekt verstrickt, haben da so ein paar Schnittstellen. Und ich freue mich wirklich enorm. Und das ist für mich als Forstwissenschaftler viel, viel neuer Input gewesen. Und ich finde die Sachen, wie man sie angegangen ist total klasse. Und ich freue mich dann wirklich, wenn der Prototyp 2024 auf der Matte steht und unsere Gärtner damit gerne umgehen.
Prof. Krzywinski: Das schaffen wir in jedem Fall. Na, vielen Dank dann an Sie. Das war sehr, sehr schön. Ich kann es tatsächlich anbieten, ohne euch vorgreifen zu wollen, falls jemand noch das Exoskelett ausprobieren will, auch ganz ohne Mikro und Stimmung, dann kann ich das gerne noch anbieten und sage ansonsten von meiner Seite Danke, außer du hast noch einen letzten Punkt?
Vetter: Nein, ich möchte mich auch für eure Aufmerksamkeit bedanken und ganz herzlichen Dank an Sie für das schöne Frage-Antwort-stehen und das Einleiten in die Thematik. Genau. Also von unserer Seite wäre das jetzt die Veranstaltung. Genau das ist ein gutes Angebot, das noch mal anzuprobieren. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen, trockenen Weg nach Hause. Freut mich, dass Sie hier waren. Danke schön.
Prof. Krzywinski: Vielen Dank.
Lebende Arzneimittel - Dr. med. Torsten Tonn
Wenn körpereigene Zellen helfen, Krebs und Autoimmunkrankheiten zu bekämpfen, sind „lebende Arzneimittel“ nicht mehr nur Zukunftsmusik. Herr Prof. Torsten Tonn, Medizinischer Geschäftsführer des DRK Blutspendedienst Nord-Ost und Lehrstuhlinhaber für Transfusionsmedizin, Med. Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden, berichtet über „natürliche Killerzellen“ und deren Einsatz.
Intro: Hallo und Herzlich Willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere"! Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderator, Maurice Vetter: Ich bin Maurice Vetter. Ich werde heute durch die Veranstaltung moderieren. Genau, und ich freue mich, dass ihr heute alle da seid bei dem schönen Wetter, das sich jetzt entwickelt hat. Genau dann schönen guten Tag Herr Tonn! Genau ich möchte ihn gern mal vorstellen. Also sie sind Professor Doktor Torsten Tonn. Sie sind Professor für Transfusionsmedizin an der medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus. Sie sind auch Medizinischer Geschäftsführer des DRK Blutspendedienst Nord-Ost und eben auch ein Experte, eben der Experte in der zellulären Immuntherapie mit Arbeitsgruppen hier in Dresden, die an der Entwicklung moderner Therapieansätze forscht. Und eben auch ganz wichtig heute Repräsentant des Saxocells, ein Verbundnetzwerk, das im Zusammenschluss sächsischer Zellforscher und Ärzte ist, und einer der Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs Cluster for Future-Forschung von Zukunftsthemen. Aber dann möchte ich direkt gleich mit der Einleitungsfrage anfangen: Was sind denn jetzt lebende Arzneimittel?
Professor Doktor Torsten Tonn: Ja, vielen Dank, Herr Vetter zunächst für die nette Einleitung und Vorstellung. Lebende Arzneimittel, wir wissen ja alle was Arzneimittel sind. Das sind zunächst einmal Stoffe oder Substanzen, die entweder unverändert oder verändert eingesetzt werden, beim Menschen oder bei Tieren, um heilen oder zu lindern, also Beschwerden oder Krankheiten zu lindern. Und wenn wir von lebenden Arzneimittel sprechen, dann ist das halt in Abgrenzung zu chemischen Stoffen, die man kennt. Aspirin zum Beispiel ist eine chemische Substanz oder eine Chemotherapie besteht aus toxischen chemischen Substanzen. Bei lebenden Arzneimitteln würde man klassisch verstehen, dass es Organismen sind, wie zum Beispiel Bakterien oder es können auch Bandwürmer oder Ähnliches sein, Blutegel. Das sind also auch lebende Arzneimittel im engeren Sinne. Und wir verstehen aber jetzt in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch darunter biologische, zelluläre Bestandteile unter unseres Körpers eben Zellen oder Gewebe, die wir einsetzen, um heilen, zu lindern und zu bessern.
Vetter: Was würden Sie dann sagen, was sind die bekanntesten lebenden Arzneimittel?
Prof. Dr. Tonn: Ich glaube und da bin ich ja ein bisschen jetzt auch voreingenommen als Leiter einer Blutspendeeinrichtung. Tatsächlich sind Erythrocyten ja lebende Organismen, auch wenn sie sich selber nicht mehr verteilen können. Aber sie atmen und Bestandteile des Blutes, die in einer klassischen Blutspende sind, sind, denke ich, die ältesten lebenden Arzneimittel, die. Ohne die die Hochleistungsmedizin heute ebensowenig möglich wäre wie viele andere Sachen. Eine Transplantation ist nicht möglich, ohne dass die Patienten zusätzlich die klassischen Blutprodukte bekommen, sodass ich denke, dass die klassischen Bestandteile des Blutes die bekanntesten lebenden Arzneimittel sind. Und ich habe tatsächlich auch welche mitgebracht. Wir wissen ja, dass wir im Blut verschiedene zelluläre Bestandteile haben. Unser Blut wird gebildet im Knochenmark. Knochenmark kennen Sie vom Kochen das Rote, wo man dann für die Markklößchen, das aus dem Röhrenknochen verwendet. Das ist beim Menschen so aufgebaut, dass wir in den Knochen zum Beispiel im Beckenkamm oder in den langen Röhrenknochen. Da ist der Knochen nicht von innen hohl, sondern der ist ausgefüllt. Sieht aus wie so Trabekel, da eingelassen sind Zellen die das wie Samt auskleiden und da drin sind Mutterzellen. Und diese Mutterzellen teilen sich. Und dann kommen daraus eben die zellulären Bestandteile das können einmal sein, die roten Blutkörperchen, die kennen wir alle als die Erythrocyten. Dann bilden sich dort aber auch die Blutplättchen. Die Blutplättchen brauchen wir für die Gerinnung. Und dann werden dort auch gebildet die weißen Blutzellen, die Leukozyten, die heißen altgriechisch weiß- Leuk, Leukozyten, das sind zelluläre Bestandteile des Blutes, die Abwehrzellen vor allem. Darunter zählt man wieder die T-Killerzellen. Man zählt darunter auch sogenannte B-Lymphozyten, die Antikörper machen können. Und man zählt dazu auch die Granulozyten, die sind in der Lage Bakterien zu fressen. Und so sehen wir, dass die weißen Zellen, die in unserem Körper entstehen, im Knochenmark, vorrangig für die Abwehr als Abwehrzellen, quasi fungieren. Ich habe Ihnen mitgebracht, dann darf ich mal Lotte und Hendrik nach vorne bitten und damit sie auch ein bisschen was mal so mitbekommen, was das ist. Hier für alle ein Erythrocytenkonzentrat, das sind rote Blutkörperchen aus einer Blutspende. Lotte, das kannst du mal nach vorne gehen. Und der Hendrik kommt jetzt mit Thrombozyten. Sie können die Thrombozyten gegen das Licht halten. Und dann sehen sie ein typisches Swirling-Phänomen alles Gelbe, was Sie hier sehen, sind Blutplättchen, und wenn man sie gegen das Licht hält, weil die sind natürlich ganz klein, kann man das so ein bisschen sehen.
Prof. Dr. Tonn: Und es wäre nett, wenn sie die Präparate so durchgehen. Hendrik und Lotte ich habe noch etwas, was ihr durchgeben könnt. Was man natürlich in der klassischen Blutspende nicht verwendet bisher, wir entsorgen das immer, das wird herausfiltriert. Das sind die weißen Blutzellen, die Abwehrzellen, von denen ich eben erzählt habe. Die werden bei der Blutspende rausgefiltert. Wir machen aus jeder Blutspende bis zu drei Präparate, also die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen. Und dann wird auch der flüssige Bestandteil, dass das Plasma, wird ebenfalls für die Blutspende verwendet. Und kann zu Patienten gehen, aber die weißen Blutzellen nicht. Und das, wo wir uns heute mit befassen möchten, sind die weißen Blutkörperchen. Und das sind weiße Blutkörperchen wieder mit verschiedenen Subgruppen, die es dort gibt. Und ich habe das einmal aus dem Labor mitgebracht. Das sind die natürlichen Killerzellen. Und wenn sie das gegen das Licht halten, sehen Sie dort einen kleinen Schlier. Das sind also Millionen und Abermillionen Killerzellen hier bei uns aus der Zellkultur und auch das können Sie gerne mal rumgehen lassen. Jetzt ist es ja so, dass wir verschiedene Immunzellen haben in unserem Körper, die alle die Aufgaben haben. Was haben wir für eine Aufgabe? Die haben vor allem eine Aufgabe, Eindringlinge von draußen abzuwehren. Das Eindringlinge von draußen lieber nicht haben möchten, das können zum einen sein. Viren, das wissen wir ja jetzt alle. Corona ist in aller Munde, also die Virusinfektion führt dazu, das dann sofort das Immunsystem aktiviert wird. Und wir haben dann T-Zellen, T-Killerzellen, die das sofort erkennen und dann ausschalten werden. Und die erste Welle, unserer körperlichen Abwehr sind die natürlichen Killerzellen. Natürliche Killerzellen, und das haben wir ja auch als Titel von unserer heutigen Veranstaltung, wir sagen immer die haben die Lizenz zum Töten. Natürliche Killerzellen brauchen, anders als T-Killerzellen die es auch noch gibt, nicht erst ausgebildet zu werden auf bestimmte Antigene, sondern die sind von vornherein in der Lage, bösartig veränderte Zellen, virusinfizierte Zellen zu erkennen und diese dann auszuschalten. Ich hatte ihnen ja die kleine Flasche darum gegeben, die, wo Killerzellen sind, weil wir ja hier nicht so gut präsentieren können. Wir haben keine Powerpoint-Präsentation, ich kann keine Filme zeigen, aber wir haben ein Stofftier mitgebracht, was eine Killerzelle letztlich mal darstellen soll. Und wenn die gleiche rumgeht und sie würden hier unten tasten, dann tasten sie da so eine Art Granulat. Und das ist das, womit Killerzellen killen. Wenn eine Killerzelle andockt, an eine virusinfizierte Zelle über die Rezeptoren die sie überall hat, dann schüttet sie unten diese Granula aus. Und damit wird die Zellmembran der Zielzelle verdaut, angedaut, eröffnet und die Granula, die dann ausgeschüttet werden, sind in der Lage, in der Zielzelle einen sogenannten programmierten Zelltod auszulösen. Das nennt man Apoptose. Das wäre eine Version oder aber die wird direkt durch diese sogenannten zerstörerischen Enzyme, also lytischen Enzyme, verdaut und zerstört. Und das ist das, was unsere Immunabwehr ganz spezifisch täglich macht. Und damit ist die in der Lage, bei dem Gesunden, und das funktioniert bei allen die wir gesund sind. Täglich entstehen möglicherweise Krebszellen bei uns die entarten. Die schwirren dann irgendwo durchs Blut rum oder die sind in einem Gewebe, werden die präsentiert. Und unsere Immunzellen, wie die natürlichen Killerzellen, die schwimmen immer durch unser Blut. Die überwachen das gesamte Gewebe und tasten alle Zellen ab. Und wenn die eine Zelle haben, wo sie merken, da stimmt irgendetwas nicht, dann docken die an. Und dann wird im Austausch von verschiedenen Signalen die Krebszelle getötet. Und wir können bei uns davon ausgehen, die wir gesund sind. Dass das eigentlich in aller Regel alles so funktioniert und täglich virusinfizierte Zellen und aber auch bösartig entartete Zellen ausgeschaltet werden. Vielleicht können wir das auch noch rumgehen lassen. Da kann jeder mal ein bisschen tasten hier unten. Da kommen schon Hendrik und Lotte also auch mal durchgehen lassen. Dann haben wir das ein bisschen, was so eine Killerzelle ausmacht.
Vetter: Sehr schön, wenn jetzt jeder so ein tolles Immunsystem hat. Passend dazu ist quasi auch die Frage des Wissenschaftsjahr 2022 warum entsteht dann Krebs?
Prof. Dr. Tonn: Ja Krebs entsteht und da gibt es ja verschiedene Ursachen, weshalb Krebs entstehen könnte. Das sind also entweder äußere Einflüsse, also zum Beispiel toxische Substanzen wie das Rauchen oder Alkohol ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Strahlen und Strahlenquellen, die dann auch DNA-Schäden an Zellen machen. Wir wissen das vom Hautkrebs. Und dann haben wir aber auch mit dem Älterwerden, die Reparaturmechanismen. Also die DNA in unserem Körper und in den Zellen spielt eine wichtige Rolle, und die Zellen verdoppeln sich. Und da wird immer die DNA abgelesen. Und wir haben selber in unserem Körper, in unserem Körper ganz tolle Reparaturmechanismen, die also dann immer gucken, ob die Erbsubstanz auch richtig abgelesen ist, et cetera. Und wenn diese Mechanismen nicht mehr so funktionieren, was ja auch im Alter der Fall sein kann, dann kann es sein, dass solche Mutationen sich etablieren. Und wenn diese Mutation dazu führt, dass die Zelle sich dann teilen kann und gar nicht mehr begrenzt ist. Eine normale Zelle, wenn die sich teilt, dann kann die sich nur ungefähr 25 Mal teilen, und danach würde diese ganze Linie absterben. Und bei Krebszellen ist dieses Wachstumshemmung nicht mehr gegeben aufgrund von Veränderungen in der Erbsubstanz, die wiederum unterschiedliche Ursachen haben können. Und so entstehen Krebszellen. Jetzt hatten sie zurecht gefragt warum kann sich denn dann Krebs bei Patienten etablieren? Also es entsteht ja bei jedem auch bei gesunden immer mal wieder. Aber bei einigen etabliert es sich. Und da wissen wir heute, dass dann die Krebszellen auch in der Lage sind, der körpereigenen Immunabwehr zu entkommen, weil in der Interaktion von den Krebszellen und von den Immunzellen, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Es hat quasi unsere Immunzelle mehrere Handbremsen. Die brauchen wir, weil unser Immunsystem soll uns ja nicht selber angreifen. Also wir wissen ja Autoimmunität. Das sind Erkrankungen, wo das Immunsystem den Körper selber angreift und dann Probleme macht wie rheumatoide Arthritis oder Ähnliches. Wenn wir jetzt aber mit Krebszellen und anderen, da wollen wir immer sicherstellen, dass wirklich auch nur die virusinfizierte Zelle oder die bösartig entartete Zelle zerstört wird und nicht das gesunde Gewebe. Und da gibt es Handbremsen, nennen wir die, das heißt eine Immunzelle wie eine T-Killerzellen oder auch eine natürliche Killerzellen.
Vetter: Genau die Frage dazu welche im Immunzellen gibt es alle?
Prof. Dr. Tonn: Also es gibt ganz viele Immunzellen, und wir unterscheiden zunächst einmal die des angeborenen Immunsystems, die evolutionstechnisch schon viel länger existieren, auch in niederen Tieren existieren und die, wie ich das eben gesagt habe, gar nicht erst ausgebildet werden können. Das ist die natürliche Killerzellen, dazu gehören aber auch Macrophagen, Fresszellen, die Zellen erkennen können und dann auffressen oder auch Erreger auffressen, auch Bakterien auffressen können. es gibt die Granulozyten. Die gehören alle zu dem angeborenen Immunsystems, die Fresszellen, die natürlichen Killerzellen. Und dann haben wir das sogenannte adaptive Immunsystem. Das kann sich anpassen, das lernt, sowie wir das haben nach einer Impfung. Sie wissen alle jetzt bei Corona, da wird immer gesagt die reine Ausbildung des Antikörpers reicht nicht für einen langen Schutz. Sondern wir brauchen auch die T-Lymphocyten, die Erinnerungszellen und diese Zellen, die werden erst geprägt und lernen das und sind dann ganz spezifisch. Und die bleiben lebenslang erhalten.
Vetter: Jetzt ist auch sehr interessant zu fragen, in welchem Bereich das denn heut schon im Einsatz ist.
Prof. Dr. Tonn: Also ich müsste jetzt zunächst einmal ja sagen noch, dass wir bei den Patienten, bei denen Krebs entsteht, das körpereigene Immunsystem offenbar versagt hat. Und das körpereigene Immunsystem könnte versagen, wenn entweder das Immunsystem geschwächt ist. Es gibt Patienten, die sind immunsupprimiert. Entweder durch Medikamente, die sie bekommen, zum Beispiel nach einer Transplantation, weil da soll das transplantierte Organ nicht abgestoßen werden. Es gibt Patienten, die haben angeborene oder erworbene Immundefizienzen, zum Beispiel AIDS, also die Krankheit der HIV-Infektion. Wenn die Krankheit ausbricht, dann nennt man das AIDS. Das ist das erworbene Immundefizienz Syndrom übersetzt. Das heißt die Patienten haben dann kein Immunsystem. Und eine schwere Komplikation ist dann, dass bei diesen Patienten ganz viele typische Krebserkrankung, dann auch passieren. Das zeigt eigentlich, wie wichtig das Immunsystem zur Überwachung unseres Körpers ist, um solche bösartigen Zellen in Schach zu halten. Ich habe von den Handbremsen erzählt, und diese Handbremsen sind so ausgerichtet, dass eine Killerzelle, und die geht ja im Moment noch rum. Die hat also verschiedene Rezeptoren auf der Oberfläche, und die bildet mit einer Tumorzelle eine immunologische Synapse. Das heißt die, die, die bilden letztlich eine Verbindung. Und diese Verbindung, die geht über eine gewisse Strecke, die ist gar nicht so klein. Und da gibt es ganz viele Signale, mit denen sich jetzt die Killerzelle und die Krebszelle oder eine andere gesunde Zelle unterhalten. Und damit eine Killerzelle killt müssen mehrere Signale zusammenkommen. Und dann gibt es auch noch die sogenannte Handbremse, und diese Handbremse ist ein Stoppsignal. Wenn also eine gesunde Zelle dieses zeigt, was wir jetzt mal als Handbremse bezeichnen, dann würde die Killerzelle nicht killen. Und der englische Fachbegriff dafür sind die Checkpoint Inhibitoren. Das sind also wie Checkpoint Charlie, wo die Killerzelle noch einmal erfährt darf ich jetzt killen? Oder soll ich besser nicht killen? Und Tumore, die entstehen, die können solche Liganden, die eigentlich dazu dienen zu sagen: "Halt, ich bin hier gesundes Gewebe kill mich bitte nicht." die können die auf der Oberfläche ausprägen. Und und dann sagt die Killerzelle kill ich dich erst mal nicht, und dann wandert die weiter. Und das ist ja, wenn ich das jetzt mal; hat mit der Zelltherapie nichts zu tun. Aber das ist trotzdem einer der ganz großen Durchbrüche der letzten knapp zehn Jahre in der Krebstherapie, dass man Substanzen entwickelt hat, Antikörper, die wiederum diese Handbremsen blockieren, sodass dieser Mechanismus bei den Krebszellen dann nicht funktioniert und das damit dann tatsächlich auch behandelt werden kann. Und vielleicht haben sie es mitbekommen, einer der ersten Patienten, der diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren bei Lungenkrebs bekommen hat und Lungenkrebs spricht ganz besonders an auf diese Form der Therapien. War der Präsident, frühere Präsident Carter aus den USA. Der ist also damit behandelt worden. Und was aber jetzt für uns wichtig ist, die Immunzellen, die bekommen also verschiedene Signale. Und wenn die Signale nicht alle gegeben sind, dann würden die unseren Tumor nicht kennen. Und da kam, und da hatten sie mich ja gerade nach gefragt Herr Vetter. Das ist jetzt der Durchbruch in der Krebsimmuntherapie mit Zellen. Und er ist heute zehn Jahre her. Vor zehn Jahren sind zwei Patienten in Pennsylvania in den USA behandelt worden, bei denen man die körpereigenen Immunzellen, die T-Killerzellen, entnommen hat. Und hat diese T-Killerzellen genetisch so verändert im Labor, dass die jetzt auf der Oberfläche einen Antikörper hatten. Und diese Antikörper erkennt ganz spezifisch etwas auf den Krebszellen. Und wenn der jetzt dort gebunden hat und das war das Besondere, dann haben die im Inneren. Also hier ist die Zellmembran, da ist der Antikörper, der erkennt jetzt irgendetwas. Und wenn der bindet, dann gehen aber auch die Signale in der, in der Zelle selbst gleich los. Und dann kriegt die den Auftrag zu Killen. Und das war ein, schon ein ganz großer Durchbruch. Die, die Story dahinter war eigentlich, dass das ein junges, war ein kleines Mädchen mit knapp zwölf Jahre alt glaube ich, hatte Blutkrebs, eine Form des Blutkrebses bei Kindern, der schwer zu therapieren ist, um nicht zu sagen gar nicht zu therapieren ist. Und dieses Kind war eigentlich austherapiert. Die Ärzte hatten den Eltern schon mitgeteilt, dass da keine Hoffnung auf Heilung besteht. Lebenserwartung lag bei unter sechs Monaten, das Kind ist dann, hätte eigentlich dann nach Hause entlassen werden sollen. Aber in Pennsylvania in der Arbeitsgruppe von Carl June. Ich sage das so weil der darüber berühmt geworden ist. Wir erwarten eigentlich auch noch den Nobelpreis für ihn. Mal gucken, ob der in den nächsten Jahren kommt. Er hat dann diesem Kind die eigenen T-Lymphocyten entnommen, aus dem Blut. Diese T-Lymphocyten wurden genetisch so verändert, wie ich das eben gesagt habe. Dass die dann jetzt alle auf der Oberfläche so einen Antikörper gemacht haben, mit der daranhängenden Signaltransduktionskette nennen wir das. Und wurden dem Kind zurückgegeben. Und bei dem Kind, und zwar ganz wenig, also weniger als das, was ich hier gerade in dem kleinen Glas habe rumgehen lassen. Also stecknadelkopfgroß. So viel Zellen sind im Kinder nur zurückgegeben worden. Aber die Zellen haben sich in diesem Kind dann total ausgebreitet, vermehrt. Das Kind hatte dann auch fieberhafte, ganz schwere Komplikationen war auf Intensiv. Aber nach wenigen Tagen ist das Fieber dann auch zurückgegangen, und das Kind hat überlebt. Und innerhalb von drei Wochen waren eben bei diesem Kind alle Tumorzellen verschwunden. Durch die T-Killerzellen, die sich so vermehrt haben in dem Kind, das sie da so durch starke Abwehrreaktion gemacht haben. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Als man das damals macht hat, wusste man ja nicht: Wie sieht das aus? Kommen die Krebszellen danach wieder? Das ist ja was, was man bei Chemotherapie sieht. Wird eine Chemotherapie gemacht, Krebszellen gehen zurück, Chemotherapie stoppt, Krebszellen kommen wieder hoch. Und in dem Fall ist es aber so, dass man heute, zehn Jahre nachher, diese beiden Fälle sind immer noch gesund, und es sind nie wieder Tumorzellen aufgetreten. Aber im Blut finden sich immer noch diese T-Killerzellen, die genau darauf ausgerichtet waren. Und das ist jetzt der Durchbruch in dieser Form der Krebsimmuntherapie.
Vetter: Ja, daran anschließend direkt. Wenn wir jetzt von Blutkrebs reden, dann ist es ja nicht sehr häufig. Also statistisch gesehen sind ein von 10.000 pro Jahr, von 100.000 pro Jahr. Das würde hier in Dresden bei einer Bevölkerung von ungefähr 600.000 jeder sechste Dresdener in einem Jahr betreffen.
Prof. Dr. Tonn: Nein sechs Fälle im Jahr in Dresden.
Vetter: Ja genau sechs, sechs Jahre, sechs Fälle im Jahr in Dresden aber nicht jeder Sechste entschuldigen sind. Könnte man das denn nun auch auf häufige Krebsarten anwenden, wie zum Beispiel Brustkrebs, Lungenkrebs oder eben Darmkrebs.
Prof. Dr. Tonn: Das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil diese Behandlung von dem Kind und da sind ja auch weitere Patienten gefolgt. Und das ist hoch aufwendig. Weil es müssen dem Patienten erst seine Zellen entnommen werden. Dann werden die Zellen genetisch verändert. Das dauert zwei bis drei Monate, die werden dann eingefroren. Und dann bekommt der Patient die Zellen zurück, und das ist heute klinischer Alltag. Das heißt gewisse Form von Blutkrebs, einige Formen von Blutkrebs gerade bei Kindern, kann man ja auch mit ganz klassischen Methoden sehr gut behandeln. Dann gibt es aber einige wenige, besonders Bösartige. Für die kommt dann als Therapieoption zum Beispiel so eine Stammzelltransplantation infrage. Das kennen sie alles von den Aufrufen "Stäbchen rein, Spender sein" wo man den genetischen Zwilling sucht, dessen Knochenmark dann transplantiert werden kann. Und bei Patienten, bei denen das auch nicht wirkt, da würde man dann heute in Erwägung ziehen, so eine Behandlung mit CAR-T-Zellen. CAR-T-Zellen ist der Fachbegriff für das, was ich eben so umschrieben habe. Und diese Therapieform, die vor zehn Jahren erste Patienten bekommen haben, ist in Windeseile zugelassen worden. Ist zugelassen in Europa, zugelassen in Deutschland und ist klinischer Alltag für die Gruppe von Patienten, die mit anderen Methoden nicht zu heilen sind. Und wenn sie heute mit so einer Art von Blutkrebs ins Krankenhaus gehen, der Schwerpunkt der, der Maximalversorgung, dann würde Ihnen, wenn Sie das Stadium erreichen und keine andere Therapieoptionen bestehen, dies angeboten werden. Und wie das im Moment läuft, ist das die Zellen werden gewonnen von den Patienten, häufig übrigens durch Blutspendeeinrichtungen, die dann auch diese Verfahren der Zellsammlung aus dem Blut etabliert haben. Und dann werden die Zellen zum Teil nach Amerika geschickt, und in Amerika werden die Zellen dann genetisch verändert und kommen dann als gefrorenes Präparat von dort wieder zurück. Und der Patient kann das bekommen. Das ist eigentlich unfair, dass das alles nach Amerika ist, weil die Entwicklung ist eine komplett europäische Entwicklung und die allererste Entwicklung der Verwendung von diesen CAR-T-Zellen also, wo man einen Antikörper in so einer Killerzelle reinbringen, sodass das oben experimentiert wird, das nennt man halt Chimären-Antigen-Rezeptor, deswegen kommt das Wort CAR. Das stammt ursprünglich aus einer Arbeitsgruppe in Israel und in Europa war man weltweit führend. Aber man war nicht, wir waren nicht die ersten die es Patienten gegeben haben und die ersten die es Patienten gegeben haben, war Carl June. Und der hatte dann diese therapeutischen Nutzen. Der hat auch noch zwei, drei Sachen anders gemacht, die zu dem Erfolg geführt haben. Jetzt war Ihre Frage aber ja zu Recht kann man das auch auf Tumore oder Krebsarten mit häufigeren Indikationen ausdehnen? Und da denke ich setzt Saxo Cell ein. Das ist dieser Verbund, den sie in der Einführung auch schon erwähnt haben. Weil tatsächlich ist es so, dass das kaum denkbar ist, dass man das mit dem Aufwand, was man für diese Patientengruppe macht, die relativ selten sind, erstens von den Kosten, dann auch von dem Aufwand her und von der Infrastruktur, die man da braucht, in der Form abbilden kann. Und das war ja unter anderem die Konzeptidee auch von diesem Cluster for Future. Das ist eine bundesweite Ausschreibung gewesen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und da hatten sich knapp 150 universitäre Gruppen zusammengetan und beworben mit ihren Zukunftsideen. Die gingen querfeldein, das kann sein automatisiertes Fahren, irgendwie Solarenergie oder Sterne abschießen. Also ganz einfach weit gedacht in die Zukunft. Und wir haben hier in Sachsen gemeinsam mit der Universität Leipzig, Universität Dresden haben wir uns zusammengetan in einer großen Gruppe, die wir alle uns schon ganz viele Jahre in diesem Feld der Zelltherapie und der genetischen Veränderungen von Zellen beschäftigen. Und wir wollen in diesem Cluster versuchen, und wir sind gefördert worden als eines von insgesamt sieben Projekten, die ausgewählt wurden. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Erfolg auch für Sachsen. Und wir haben uns jetzt über die nächsten Jahre zum Ziel gesetzt, diese Therapieformen die Verfahren zu vereinfachen, sodass es günstiger wird, dass es mehr Patienten erreicht. Und wir wollen uns auch damit beschäftigen, wie wir vielleicht es auch schaffen, dass es gar nicht mehr immer von den Patienten selbst die Zellen sein müssten, sondern es könnten auch Zellen sein, die schon vorliegen. Weil es kann ja auch sein, dass ein Patient gar nicht die Zeit hat, drei bis vier Monate zu warten, bis seine Zellen verändert sind und dann zurückgegeben werden können. Also das ist ein großes Ziel von unserem Konsortium SaxoCell, dass wir in den verschiedenen Arbeitsgruppen, in ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen versuchen, die Zell- und Gentherapie ökonomischer zu gestalten und dass wir den Sprung schaffen auch weg von dem, wo schon der Standard jetzt eigentlich ist, der klinische Standard Blutkrebs. Wir wollen es erweitern auf Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen. Wir wollen es erweitern, auch auf solide Tumor. Und wir wollen auch andere Immunzellen in dem SaxoCell-Konzern,-Gruppe dort mit einbringen.
Vetter: Prima und Sie, Herr Tonn sind ja weltweit ausgewiesener Experte in natürlichen Killerzellen. Wo kann man die denn einsetzen?
Prof. Dr. Tonn: Also die natürliche Killerzellen? Das ist ja die erste Welle der körpereigenen Immunabwehr, anders als die T-Killerzellen, um das noch einmal in Erinnerung zu führen. Das sind die, die wir alle schon im Körper haben. Und der Vorteil der natürlichen Killerzellen ist zunächst einmal, dass wir die auch von einem Spender einsetzen können. Weil die T-Killerzellen, die NK-Zellen die machen keine Abstoßungsreaktion. Die können zwar selber erkannt werden vom Patienten-Immunsystem, wenn das noch intakt ist. Und er könnte die auch ausschalten. Aber die natürliche Killerzelle, die wir ja hier als grünes Stofftier haben, die würde nicht im Patienten denken: "Ich bin hier im falschen Körper" und fängt an den Patienten von innen abzustoßen. Das machen aber T-Killerzellen. Und deswegen geht die Therapieform, die ich eben dargestellt habe, nur autolog. Also das mit dem bei Blutkrebs das Kind, das sind die eigenen Zellen. Oder aber man hätte einen genetischen Zwilling, dann kann man auch dessen Zellen nehmen und verändern. Und das ist bei den natürlichen Killerzellen nicht. Die erkennen veränderte Zellen. Und wir können diese Zellen ebenso ausstatten mit diesen Antikörpern an der Oberfläche, das sie dann in der Lage sind, Krebs zu erkennen. Es gibt verschiedene Quellen für diese natürlichen Killerzellen, einmal im Blut der Spender, also von Gesunden und dann auch im Nabelschnurblut. Nabelschnurblut, was ja als Plazentarestblut nach einer Geburt gewonnen und in den Beutel letztlich sich abbildet und vorhanden ist. Das ist ungefähr immer so ein Glas voll, also 200 Milliliter. Und da drin sind auch natürliche Killerzellen, die man da, und auch Vorläuferzellen für natürliche Killerzellen, und die kann man verwenden.
Vetter: Und woran konkret forschen die sie jetzt hier in Dresden?
Prof. Dr. Tonn: Also wir in Dresden haben ihr, wie ich das eben dargestellt habe, in dem SaxoCell Konsortium verschiedene Gruppen. Die sich mit auf der einen Seite der Veränderung der T-Killerzellen beschäftigen, die ich eben dargestellt habe, und versuchen diese T-Killerzellen für verschiedene Erkrankungen einzusetzen. Einmal für immunologische Erkrankungen, auch wie Abstoßungsreaktion nach einer Stammzelltransplantation, das ist eine Gruppe. Andere versuchen das auch günstiger und effizienter zu gestalten, damit wir das mehr Patienten zugute kommen lassen können, auch in Richtung solide Tumor. Und dann haben wir eine große Gruppe, die aus vielen Arbeitsgruppen besteht, die sich mit den natürliche Killerzellen beschäftigt. Das sind ja die mit der Lizenz zum Töten, wie wir heute gelernt haben, und versucht, diese zu verändern und einzusetzen. Für auf der einen Seite Tumore, unterschiedliche Tumor, auch solide Tumor und dann das was wir neu aufgenommen haben hier und erstmals uns hier angucken werden eben der Versuch, auch bei schweren Autoimmunerkrankungen genau die Zellen gezielt auszuschalten, die für die Autoimmunerkrankung und die Ausprägung der Autoimmunerkrankung verantwortlich sind.
Vetter: Welche Bedeutung hat dann ihre Forschung für Patienten jetzt in Dresden zum Beispiel?
Prof. Dr. Tonn: Also ich denke, dass das eine sehr große Bedeutung hat. Weil zunächst einmal ist es so nur in einem akademischen Umfeld, wo wir forschende Ärzte haben, wo wir die Infrastruktur haben und wo wir selber lernen und uns in der Entwicklung auch mit solchen Themen befassen. Kann man dann nachher für die Patienten auch diese Schwerpunkttherapien anbieten. Dresden ist auch eines der ersten Zentren gewesen und Leipzig ebenso, wo diese dann inzwischen in Amerika und in Europa zugelassenen Entwicklungen, da muss man natürlich sagen diese Entwicklung sind später in den USA von dem Arzt der es im Krankenhaus angewandt hat, was ich eben erzählt habe. Carl June ist da das Stichwort. Das ist natürlich dann sofort von großen Pharmakonzernen übernommen worden, und in dem Fall war es die Firma Novartis, eine Schweizer Firma, die über 100 Millionen Dollar in die weitere Entwicklung reingesteckt haben. Und so sind die natürlich dann nur mit dem Geld in der Lage, die große klinischen Studien durchzuführen, die man für eine Zulassung braucht. Und das Umfeld, was in Dresden hier mit dem, und in Leipzig. In beiden Einrichtungen in Leipzig ist ja das Fraunhofer-Institut und verschiedene Leibniz-Institute im ans Uniklinikum auch im Umfeld mit angegliedert. In Dresden haben wir hier ein, in Deutschland einzigartiges, Netzwerk von Grundlagenforschung bis hin zu einer klinischen Anwendung. Und so sind wir dann, die wir alle auch ein bisschen was davon verstehen, für die Firmen wie Novartis dann auch der natürliche Ansprechpartner, wenn es darum geht, dort erst klinische Studien in der Anwendung durchzuführen und das danach auch den Patienten anzubieten. Und so ist es tatsächlich so, dass wir diese Therapieform bei Leukämie, die zugelassen sind, in Deutschland alle in den Krankenhäusern, der Schwer- der, der Hochleistungsmedizin, müsste man sie oder der Maximalversorgung in Sachsen auch angeboten werden. Und da spielt dann immer Dresden und Leipzig die führende Rolle, wo die Patienten kommen können. Können das Blut spenden also über Apherese-Verfahren, damit daraus dann die T-Killerzellen verändert werden können, die sie dann später zurückbekommen. Das ist das eine. Und dann ist es so, dass wir in dem, was wir hier entwickeln und was wir in dem SaxoCell entwickeln möchten, eine ganz klare Ausrichtung haben, hin in eine klinische Anwendung, also das SaxoCell Konsortium, und das was wir uns vorgenommen haben, ist sehr kliniknah. Wenn man sich das anguckt, dann ist das eine Vernetzung von zwar Grundlagen-Instituten auch und von sehr guten Forschern, oftmals Biologen. Aber es sind ganz viele Ärzte auch dabei. Und die, die Forschung, die wir dort betreiben, ist eine angewandte Forschung. Und wir haben in allen Projekten ein sehr enges Zeitfenster, wo wir bis in eine klinische Anwendung kommen möchten. Eigentlich nach der ersten Förderperiode oftmals, das sind die ersten drei Jahre.
Vetter: Welche, an welchen Projekten wird jetzt aktuell genau in diesem SaxoCell-Verbund geforscht?
Prof. Dr. Tonn: Also ich hatte ja eben schon einige erzählt. Wir haben, wenn man es von den Immunzellen so mal ein bisschen danach gliedern, dann haben wir auf der einen Seite die T-Killerzellen. Und da haben wir mit drei, vier Gruppen, die sich nur mit den T-Killerzellen beschäftigen und die Veränderungen dieser Zellen, sodass die dann diese spezifische Antikörper auf der Oberfläche exprimieren und bei Krebs oder bei schweren Immunreaktion nach Transplantationen eingesetzt werden können. Dann haben wir die andere Gruppe gebildet. Das sind Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich mit dem, was ich eben erzählt habe, die natürlichen Killerzellen. Die dann auch mit diesen genetischen Methoden der Expression von Chimären-Antigen-Rezeptoren. Also Antikörper oder Rezeptoren auf der Oberfläche, die verändert werden für Erkrankungen, auch wieder Krebs und oder auch Autoimmunerkrankungen schwere. Und dann haben wir noch eine andere Gruppe, die ganz andere Zellen auch beinhaltet. Wir haben eine Gruppe, die ein sehr weit fortgeschrittenes Projekt schon macht, was eigentlich im Sinne einer Gentherapie einer Bluterkrankung ist, wo es zu Störungen kommt. Sichelzellanämie ist vielleicht einigen bekannt, wo es im Hämoglobin zu schweren Schäden kommt, die angeboren sind. Und durch Sachen wie die Gen-Schere, wo man versucht dann das defekte Gen herauszuschneiden, durch ein gesundes Gen in Blutstammzellen zu ersetzen, ist es denkbar, dass man damit dann Patienten heilt, die diese Erkrankungen haben. Und dann haben wir noch tatsächlich Gruppen, die sich mit den sogenannten Fresszellen beschäftigen, die Makrophagen und jetzt auch verbinden wollen, dass man Makrophagen mit solchen Technologien der Antikörper koppelt. Der Gedanke dahinter ist eigentlich immer der, dass der Erfolg der Therapie, der gelungen ist, bei wenigen Arten des Blutkrebses mit dieser Technologie. Das der bei den soliden Tumoren, also Lungenkrebs, Brustkrebs, Dickdarmkrebs nicht so einfach sein wird und dass wir da möglicherweise das gesamte Arsenal unserer Immunzellen benötigen werden.
Vetter: Können Sie vielleicht den Prozess beschreiben, der bei so einer Therapie eines Krebskranken ausschaut? Also gehe ich jetzt mit einem Rezept zur Apotheke, oder wie schaut das aus?
Prof. Dr. Tonn: Also, und das ist ja schon so was ja jetzt das ganze Neue ist, also im Prinzip ist, hat man auch gesetzlich ganz lange gestritten, ob das jetzt ein Arzneimittel ist. Oder ist das eine Behandlungsform? Es gab also eine breite Lobby auch von niedergelassenen Ärzten, die das auch alle gerne gemacht hätten, ohne das sie vielleicht die Vorkenntnis gehabt hätten. Also ist das eine Behandlungsform? Ich nehme etwas von einem Patienten, sein Blut. Und dann irgendwie mache ich da was mit, und da gebe ich ihm das nachher wieder. Und diese Entscheidung ist eigentlich ganz klar gefallen. Es gibt heute Gesetze, die über Gesamteuropa und USA und weite Teile der Welt gelten, dass das Arzneimittel sind, die hergestellt werden und die dann auch unter den Sicherheitsstandards letztlich in eine Anwendung kommen sollen.
Vetter: Vielleicht hinsichtlich der Corona-Impfung. Das hatten sie schon gesagt. In welche könnte, dass die Therapie der mRNA verändern?
Prof. Dr. Tonn: Ja, ich glaube, die Frage, die ist sehr gut, die dahintersteht. Steht so eine Zelltherapie alleine und wenn wir jetzt, da haben wir heute noch nicht so viel darüber gesprochen, wie bekomme ich denn ein Gen in so eine Killerzelle rein oder in eine Blutstammzellen oder in irgendeine andere Zelle? Und damit versuchen wir heute immer Methoden zu verwenden, die sehr aufwendig sind. Und wir wissen ja, dass ein Virus in der Lage ist, an eine Zelle anzudocken. Und ein Virus hat selber nicht viel, der hat nur eine Hülle, und er hat Erbsubstanz und er spritzt seine Erbsubstanz in eine Zelle rein. Und dann sagt er der Zelle, du kriegst jetzt hier einen neuen Bauplan. Und dann fängt die Zelle an, ob sie will oder nicht, diesen Bauplan abzulesen und macht ganz viele Viren. Und irgendwann geht die Zelle kaputt, und die ganzen Viren werden freigesetzt. Und das hat man sich zur Hilfe gemacht bei den Gentherapieansätzen. Das man den Bauplan von Viren geändert hat, hat dort nur noch das Gen eingebaut, was man gerne als therapeutisches Gen hätte. Und so nimmt man sich so eine, nimmt man eine andere Hülle. Und so kann dann so ein Pseudovirus, nennen wir das. Das dockt an eine Zelle an, spritzt seine Erbsubstanz rein. Und dann wird nur das eine Gen, was für uns relevant ist, irgendwo in der Zelle im Genom eingebaut und danach nicht wieder vermehrt oder ähnliches wird dann aber abgelesen. Und aus dem Gen wird ja dann ein Eiweiß, und das wird vielleicht ein Rezeptor, oder in unserem Fall wird es ein Antikörper. Das sind also aufwendige Methoden, um eine Zelle genetisch zu verändern. Und was war jetzt das Besondere, bei der von Biontech entwickeltem Corona-Impfstoff? Die haben letztlich nur noch die mRNA genommen, also die haben nur noch das Transkript genommen der Erbsubstanz, aus dem dann ein Eiweiß direkt abgelesen wird, ohne dass das in den Zellkern rein muss. Das ist auch ganz instabil, äh, wir haben mRNA, und diese Art der RNA ist überall allgegenwärtig und wird innerhalb von äh, Sekunden überall abgebaut, also ist komplett instabil. Und die besondere Errungenschafft von Biontech war, dass die es geschafft haben, das Ganze so zu verkapseln, das es stabil bleibt. Und dass man es, wenn man es spritzt in die Muskelzellen reinspritzen kann. Wo es dann die, dieses Transkript, was abgelesen wird, freigesetzt wird. Und dann wird ein paarmal das abgelesen, und da wird ein paarmal eine Substanz gemacht von dem Coronavirus, gegen das dann sich eine Immunantwort ausbildet. Und das Besondere ist jetzt ich wollt gar nichts über Corona erzählen. Aber wir haben durch den Druck mit Corona und der Möglichkeit, ganz schnell über mRNA die klinischen Anwendung hinzubekommen. Haben wir jetzt heute auf einmal eine neue Technologie an Millionen von Menschen erfolgreich erprobt und umgesetzt, mit der man eine Information in eine Zelle bringen kann. Und natürlich ist das einer der großen Meilensteine in der Medizin, weil man könnte sich ja jetzt vorstellen zukünftig, wenn man jetzt mal in die Zukunft gucken. Das wir diese Immuntherapien von Krebs gar nicht so machen müssen, dass wir von den Patienten erst das Blut abnehmen. Daraus isolieren wir Immunzellen. Dann haben wir vorher schon Viren gezüchtet, irgendwo im Labor, die wir auf Sicherheit untersuchen müssen. Dann wird das irgendwie zusammen gegeben, dann infiziert. Virus muss dann jede einzelne Zelle infizieren, muss dann sehen, dass die Erbs-, der Bauplan in dem Genom eingebaut wird. Brauchen wir alles gar nicht mehr. Man könnte eigentlich diese kleinen Schnipsel mRNA, die nur das Transkript sind für die Informationen, in vivo im Patienten auch quasi direkt ins Blut so geben, das die von den Immunzellen aufgenommen werden. Und dann würden die Immunzellen den Antikörper, von dem wir heute die ganze Zeit erzählt haben. Ich sage mal das ist hier der Arm an unserer natürlichen Killerzelle. Den würden die dann von selber produzieren in vivo. Und dann wäre das eine ganz einfache Therapieform.
Vetter: Und wenn wir schon bei Zukunftsideen sind, Stichwort personalisierte Medizin. Welche Therapien sind da in der Zukunft möglich?
Prof. Dr. Tonn: Also, die, die Zelltherapie ist ja im Prinzip eine personalisierte Medizin. Weil wir ja immer einen Antikörper reinbringen, jetzt von einem Ansatz her den ich heute geschildert habe mit den Chimären Antigen Rezeptoren, der ein Tumorantigene erkennt. Und jetzt hat aber in normalerweise gar nicht mal jeder Patient sein ganz individuelles Antigen. Gottseidank. Das heißt, wir müssen nicht für jeden Patienten ein Antikörper erst vorher machen oder entdecken oder beschreiben. Sondern wir können heute die Patienten in Gruppen einteilen. Und bei vielen Tumoren gibt es besondere Antigene nennen wir das. Also Oberflächenstrukturen, die in der Lage sind, eine Immunantwort auszulösen, die dann diese Patienten beschreiben, um es mal zu erklären, zum Beispiel beim Mammakarzinomen oder bei Gebärmutterhalskrebs. Da ist ein ganz häufiges Antigen, das nennt sich HER2/neu. Das ist ein Rezeptor, der dann bei einem Drittel aller Patientinnen auf der Oberfläche des Tumors ist. Und diese Patienten werden ja heute auch schon mit dem Antikörper behandelt. Der Antikörper heißt Herceptin. Gibt es noch eine neuere Version, dann heißt es Trastuzumab und diese beiden Antikörper werden als lösliche Antikörper infundiert. Und die sind dann eine personalisierte Medizin. Aber die treffen für die ganze Gruppe zu, die dieses Antigen ungefähr haben. Und und so sieht dann auch die Krebsimmuntherapie mit den Zellen aus, dass wir versuchen werden, für verschiedene Krebserkrankungen und Gruppen dort die passenden Antikörper auf der Oberfläche dann zu exprimmieren. Sodass wir Studien durchführen können, wo wir dann, das ist ganz interessant. Diese Studien nennen wir heute, das nennt man Basket-Studie, kommt natürlich alles leider aus den Anglizismen. Also Basket ist ein Korb, und man macht dann keine Studie mehr, wo man sagt ich behandele nur Patienten, die müssen haben ein Karzinom des Rachens als Beispiel und dann nehme ich ganz viele Patienten, die haben alle ein Karzinom des Rachens. Aber die unterscheiden sich alle. Der eine hat diesen Rezeptor, der andere hat den nicht. Und bei den zielgerichteten Therapien da sagt man deswegen im übertragenen Sinne so eine Körbchen-Studie, ich nehme alle Patienten, egal was sie für einen Krebs haben, solange die diese Zielstruktur haben. Und dann kann es sein, dass jemand der ein Rachenkarzinom hat oder irgendjemand hat einen Brustkrebs und et cetera. Und die haben alle dieses, was ich eben dargestellt habe, dieses HER2/neu Antigen auf der Oberfläche. Dann kommen die alle in dieses Körbchen rein und sind dann Bestandteil der klinischen Studie.
Vetter: Gibt es denn aus dem Publikum auch noch Fragen an den Herr Torsten Tonn? Also wir haben jetzt versucht, in das Thema einzuleiten und von allen Seiten zu beleuchten. Gibt es denn seitens des Publikums, um auch noch direkt in den Dialog zu kommen?
Gast: Diese Therapien sind ja auch sehr teuer. Das heißt also diese Herstellung dieser CAR-T-Zellen, das ist ja glaube, ich denke da fast im Bereich von einer Millionen Euro, was das gekostet hat. Ist denn die Zukunft jetzt so, dass wir sagen können das bekommen wir hin, dass das nicht mehr so teuer ist und auch schneller geht? Also haben wir mal die Nescafe -Maschine die es dann ermöglicht es etwas schneller herzustellen?
Prof. Dr. Tonn: Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich ist es ja so, dass diese Therapien sehr teuer sind. Sind vielleicht in Einzelfällen das reine Zellpräparat das kostet circa 350.000 Euro. Das wird von den Krankenkassen in Deutschland übernommen, da wo die Zulassung besteht für die Indikation. Aber und das hat man ja letztlich auch versucht, schon darzustellen. Wenn wir jetzt auf häufigere Erkrankungen kommen und viel mehr Patientengruppen, dann ist es notwendig, dass diese Therapieformen günstiger werden. Und die müssen eigentlich in einem Bereich kommen, wo ein so eine Therapie und ein so eine Infusion nicht viel mehr kostet als zehn bis 20.000 Euro. Und wir denken auch in dem Konsortium SaxoCell ist das ja einer mit der Hauptpunkte, die wir dort adressieren, dass wir die die Herstellung ökonomischer machen wollen. Wir wollen gucken, ob wir dort Zellplattformen einsetzen können, wo man, als Beispiel wenn man aus Nabelschnurblut natürliche Killerzellen gewinnt, dann reicht ein Nabelschnurblut aus, um bis zu 100 Patienten zu behandeln. Das ist das, was wir heute schon von den Daten wissen. Und wenn man so was dann macht und man kann jetzt die Kosten der Herstellung teilen auf viele Patienten. Dann ist es pro Patient wird die Behandlung dann natürlich deutlich günstiger, also ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was wir hoffen, auch durch die Entwicklung von neuen Methoden, auch Methoden, die den Gentransfer vereinfachen und die Qualitätskontrolle und die Sicherheit. Das würde alles dazu führen, dass es günstiger wird.
Vetter: Ja gerne.
Gast: Ja, das war etwas sehr Wichtiges, was Torsten angesprochen hat, Herceptin und Herceptin, wenn wir das Wort anschauen, da steckt das Wort Herz. Das heißt es ist nicht alles so wunderschön sicher, wenn wir diese Antikörper verwenden. Weil genau diese Rezeptoren, auch im Herzen drinstecken. Und zwar es gibt Ventrikel, das sind solche Löcher, und da gibt es myocharde Zellen und genau diese Rezeptoren, die belegen die Zellmembranen von diesen Zellen im Herzen. Das heißt, die Rezeptoren sind ausgeprägt auf der Zellmembran der Krebszellen aber, und das ist genau eine gewisse Tragödie, dass sie auch im Herzen vorhanden und wenn wir sie im, in der Krebszelle unterdrücken, dann geschieht das genau dasselbe im Herzen und von Anfang an. Und das Wort wurde er von einem deutschen Forscher, Arzt eingeführt. Von dem, aus Deutschland stammt dieses Wort Herceptin, dass ist auch sagen wir etwas. Das die ganze Welt diese Rezeptoren erfuhr durch Deutschland und von Anfang an als diese Rezeptoren unterdrückt, es waren kollosall tragische Fälle bis zum Tode. Das heißt, man sollte immer kontrollieren, was mit dem Herzzellen geschieht. Und das ist genau das Problem, immer wieder die Kontrolle was im Hezen, das heißt in dem Ultraschallmuster und ein Ähnliches
Vetter: Haben sie dann direkt eine Frage? Danke.
Prof. Dr. Tonn: Also das ist ein ganz wichtiger Kommentar und stimmt alles natürlich. Herceptin ist jetzt kein exklusives Tumorantigen. Dass man ein exklusives Tumorantigene hat, was nur vom Tumor exprimiert wird, das ist wäre ja ideal. Das gibt es. Das gibt es vor allem, wenn ein Tumor entstanden ist, aus einer Virusinfektion. Dann könnte man Epitome des Virus, die dann auch in den Zellen sind, als eine Zielstruktur nehmen. Aber viele andere, wie zum Beispiel Herceptin, was aus der Klasse kommt, der EGF-Rezeptoren also -ist egal. Aber es ist eine eine Gruppe, die eigentlich in sehr frühen embryonalen Zellen exprimiert wird. Die wird dann in vielen Geweben des Erwachsenen wieder herunterreguliert und kann aber in einzelnen Geweben, in einer unterschiedlichen Stärke, auch noch aufkommen, unter anderem auch am Herzen. Und inzwischen gibt es aber mehrere Antikörper. Die einen haben eine spezifischere Bindung, die die hoch exprimierten Tumor etwas besser erkennen, machen weniger Nebenwirkungen. Aber es ist so, wenn man natürlich, und das haben wir heute nicht so beleuchtet, weil wir natürlich vor allem klären wollten was solche neuen Technologien sind, wenn wir jetzt aber daraus die Frage ableiten, welche Nebenwirkungen können denn solche Therapien auch haben? Und dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, der aus der Frage und dem Kommentar hervorgeht, dass man ja immer abwägen muss bei solchen neuen Therapieformen, wo sind die Nebenwirkungen? Und bei der Einführung von solchen neuen Therapien geht es immer darum, dass man Wirkung, also den Benefit den man hat, gegen die Nebenwirkung abwägt. Und deswegen ist es, und das ist übrigens auch ein ganz großer Unterschied zu klinischen Studien bei Tumoren. Die Studie werden durchgeführt bei Patienten und in der Regel bei Patienten, bei denen alle anderen klassischen Therapieformen nicht zum Erfolg geführt haben. Während man bei chemischen Substanzen, also Aspirin ist ja alles eingeführt werden, bevor es klinische Studien gab et cetera. Aber da würde man ja bei Substanzen immer erst einmal Gesunde nehmen, ist ein ganz anderer Ansatz. Man nimmt erst einmal eine Gruppe von gesunden Freiwilligen, die kleinste Substanz also kleinste Mengen immer dann steigernd nehmen. Man guckt dann erstmal, ob es verträglich ist, bevor man dann guckt, ob es als Medikament in einer nicht so bösartigen Erkrankungen eine Linderung verschafft. Und bei diesen Entwicklungen, die wir jetzt hier haben, wo es um Krebs geht, ist auch die Phase eins der Untersuchung auf Verträglichkeit, wo man reingeht und versucht mit kleinsten Mengen das langsam zu steigern und guckt und wägt dann erst einmal ab, wo ist es noch verträglich? Und wo habe ich eine dosislimitierende Toxizität also Nebenwirkungen und die Hauptnebenwirkungen der CAR-T-Lymphozyten, über die wir heute die ganze Zeit gesprochen haben, ist eigentlich bei den beiden T-, CAR-T-Killerzellen, dass die Zytokine freisetzen . Und diese Zytokine die machen einen, wir nennen das Zytokinsturm, und da gibt es ganz hohes Fieber, Freisetzung eben dieser Zytokine. Das kann dann dazu führen das es zu einem, leider alles Anglizismen, Leakage-Syndrom kommt. Die Gefäße, die die werden offen. Und dann geht die ganze Flüssigkeit aus den Gefäßen raus. Also gibt es schwere Nebenwirkungen, die diese CAR-T-Zelltherapien haben. Und deswegen ist das ja auch eingesetzt worden zunächst mal bei Patienten mit ganz schweren Erkrankungen. Und wenn wir das ausweiten wollen, diese Technologie, auf Erkrankungen die ein geringeres Risikoprofil haben wie Autoimmunerkrankungen. Die Autoimmunerkrankung kann man ja heute auch in Schach halten. Man kann damit sehr alt werden, und natürlich muss ich, wenn ich diese Therapieform bringe, in eine neue Indikation, die nicht so bösartig ist mit der Lebenserwartung von sechs Monaten, viel höhere Ansprüche an die Sicherheit stellen. Und da ist der Punkt vollkommen richtig.
Vetter: Wir hatten noch Zeit für eine letzte Frage aus dem Publikum.
Gast: Ja, ich hätte die Frage, wie so eine Behandlung überhaupt aussieht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen?
Prof. Dr. Tonn: Es ist eine sehr gute Frage. Und im Prinzip wenn ein Arzt entscheidet, dass die Indikation gegeben ist für so eine Therapie, weil andere Therapieform nicht ausreichend waren, dann ist der, das Prozedere zunächst einmal das von dem Patienten Zellen gewonnen werden, und diese Zellen werden gewonnen wie in einer Blutspende. Aber man kann die Blutspende auch machen an einer sogenannten Apherese-Maschine, das heißt, man bekommt eine Nadel, unglücklicherweise muss es sein, also eine Nadel in die Armvene. Und dann bekommt man noch eine zweite Vene, wo das Blut wieder zurückgeführt ist und dann sieht das so ein bisschen aus wie in einer Dialyse. Und dann kann in dem Gerät durch Zentrifugation, die weißen Blutzellen können dort angereichert werden. Und das dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Und dann kann der Patient erst mal wieder, wenn es ihm gut genug geht, nach Hause gehen. Und diese Zellen, die werden nach dem heutigen Stand derzeit noch verschickt und gehen in vielen Fällen über Holland nach USA. Werden dort manipuliert, durch Gentransfer und kommen dann als gefrorenes Röhrchen wieder zurück. Und dann werden die auf der Station in flüssigem Stickstoff vorgehalten eingefroren. Und der Patient muss auch vorbehandelt werden mit gewissen Medikamenten. Und er bekommt dann einen Termin, und zu dem Termin geht er dann auf die Station und bekommt dort dann die Zellen über eine Infusion in die Armvene infundiert. Es dauert dann nicht lange, und und das ist dann die Therapieform eigentlich. Würden wir jetzt sagen, dass wir andere Therapien, die wir ja entwickeln wollen, im SaxoCell, wo es nicht mehr zwingend die patienteneigenen Zellen sein müssten, sondern es könnten auch Zellen von Spendern sein. Dann ist denkbar, dass ein gesunder Spender diese Zellen spendet über das identische Verfahren oder dass wir andere Quellen nehmen, wie zum Beispiel Nabelschnurblut, versuchen diese Zellen in vitro herzustellen. Und dann hätten wir eine kleine Bank von schon voruntersuchten veränderten Zellen. Und wenn dann ein Patient kommt, das wäre dann der Vorteil, dann sind solche Zellen direkt verfügbar und dann idealerweise auch zu einem anderen Preis. Also günstiger.
Vetter: Ja Dankeschön! Dankeschön Dr. Professor Torsten Tonn! Wir sind jetzt am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte mich auch recht Herzlich beim Publikum bedanken, dass sie so aufmerksam zugehört haben. Genau und damit wäre jetzt diese Dialogveranstaltung zu Ende.
Prof. Dr. Tonn: Ich danke auch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntagnachmittag und danke Ihnen für die nette Moderation Herr Vetter!
Alte Bäume als Lebensräume - Dr. Sebastian Dittrich
Mit zu den schönsten, beeindruckendsten Naturschöpfungen zählen große und alte Bäume. Sie bieten einer Vielzahl von im Verborgenen lebenden Arten Lebensräume. Sebastian Dittrich vom Institut für Ökologie und Umweltschutz der TU Dresden berichtet über seine Forschung zur Bedeutung alter Bäume für die biologische Vielfalt und die ökologischen Auswirkungen gebietsfremder Pflanzenarten.
Einleitung: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere", jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderatorin, Lilith Diringer: Dann noch einmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Lilith Diringer, studiere selbst noch an der Technischen Universität in Dresden und freue mich, auch jetzt in diesem Jahr zur zweiten Veranstaltung dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Ja, es wurde ja schon einiges dazu gesagt. Ganz kurz zum Ablauf. Zunächst werden wir unseren Gast ein bisschen vorstellen und in das Thema einsteigen. Wir haben auch im Vorhinein schon ein paar Fragen vorbereitet, sodass sie auch ein bisschen einen Einblick bekommen, in was die Expertise denn so mitbringt von der Seite unseres Gastes. Und daraufhin können sie sehr gerne jederzeit Fragen stellen. Ich werde auch immer wieder dazu aufrufen,und werd dann zu ihnen kommen. Genau jetzt wollen wir aber gar nicht mehr so viel Organisatorisches regeln, sondern gleich einsteigen. Wie schon angekündigt haben wir hier Dr. Sebastian Dittrich von der Professur für Biodiversität und Naturschutz. Sie selbst haben an der Albrecht von Haller -am Albrecht von Haller Institut für Pflanzenwissenschaften in Göttingen promoviert und sind seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden, eben in der Professur für Biodiversität und Naturschutz. Die Forschungsschwerpunkte bei ihnen sind Dynamik von Wäldern, Flechten und Moosen sowie die Ökologie gebietsfremder Gehölzarten. Und ich kann so ein bisschen vorwegnehmen, wir werden gerade auch auf diese Gebietsfremde oder Gebietsfremdheit -auf diese Exoten -auch noch ein bisschen tiefer eingehen heute. Ich möchte aber erst einmal mit einer Fakten Frage einsteigen. Und zwar wie viele Bäume gibt es denn auf der ganzen Welt?
Dr. Sebastian Dittrich: Oh also, da musste ich tatsächlich noch einmal selber nachschauen. Ich wusste es nämlich wirklich auch selber nicht. Also es gibt eine Studie, die muss, also zumindest eine ganz neue Studie -ich glaube vom letzten Jahr-die geht davon aus, dass es mindestens 40.000 Baumarten auf der Welt gibt. Da sind eben auch ganz viele tropische Arten mit bei, da ist die Artenvielfalt noch mal ein bisschen höher und weltweit geht man von so einer Spanne von 40.000 bis 350.000 einzelnen Baumarten aus. Ja, genau, das ist erstmal die Zahl.
Diringer: Auf jeden Fall eine sehr große Vielfalt, die ich, so glaube ich, niemals irgendwie unterscheiden könnte. Jetzt haben wir tatsächlich eben eingebettet in dieses Wissenschaftsjahr auch eine passende Fragenkarte bekommen zu dem Thema heute, und zwar wurde hier gefragt wie alt kann ein Baum werden, und da möchte ich auch von ableiten warum werden Bäume denn allgemein so alt, und wodurch wird überhaupt das Alter begrenzt? Warum werden sie vielleicht nicht noch älter?
Dr. Dittrich: Ja, ja gut, warum wird ein Baum, na warum wird ein Baum alt? Das ist ja fast eine philosophische Frage. Aber so ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es in der Natur oder bei den einzelnen Tier- und Pflanzenarten so zwei Lebensstrategien gibt. Die eigene Strategie ist im Prinzip, das nennt man die R-Strategie also das kommt von Reproduktion. Das heißt, dass Arten die sehr kurzlebig sind und sich aber enorm vermehren können. Also das heißt ganz viele Nachkommen. Aber die meisten sterben dann eben. Und das, was sie schnell etabliert, wächst auch schnell, vermehrt sich schnell und wird sehr schnell wieder verdrängt. Also das wird zum Beispiel bei den Tieren, wäre es die Mücke oder bei Pflanzen, da wäre es vielleicht so eine Sommerblume, die in einer Woche keimt, ihre Samen abwirft und dann ganz schnell weg ist und dann oft auch keine Resistenz gegenüber Insektenbefall oder Krankheiten hat. Dafür sind sie einfach nicht eingerichtet. Und die andere Strategie das nennt man die K-Strategie. Das sind also, Lebewesen, die sehr langlebig sind. Sehr wenige Nachkommen haben aber dafür möglicherweise große Nachkommen, die also sehr kräftig sind und starke Anpassung haben und entsprechend viele Krankheiten und so Schadwirkung abwehren können. Das wird zum Beispiel bei den Tieren wär das der Elefant na also, bis so ein Elefant geschlechtsreif ist, dauert es ja ziemlich lange. Und ein Elefantenbaby wiegt ja irgendwie auch schon eine halbe Tonne, wenn es auf die Welt kommt und ist dann sehr selbständig. Und es ist bei Bäumen ganz ähnlich. Es gibt also Bäume mit sehr großen Früchten, zum Beispiel das also der Nachkomme gleich so ein Startpaket hat. Die auch ganz viele Möglichkeiten haben, Insektenfraß abzuwehren oder ihr Holz zu imprägnieren, also chemische Abwehrstoffe zu bilden. Und da wär so bei unserer Flora, wär so die Eiche in ganz wichtiges Beispiel also die Eichen werden ja sehr lang, werden ja sehr alt also, so 800 Jahre, tausend Jahre durchaus. Aber haben im Vergleich zu anderen Pflanzenarten eigentlich sehr wenig Nachkommen. Und es ist auch so, dass die auch gar nicht jedes Jahr Samen bilden. Also die hatten 2018, ein so ein sogenanntes Mastjahr, dass also die Eichen alle ganz viele Früchte hatten und die letzten Jahre war es eigentlich so fast nichts. Aber wenn die Eiche dann eben sich vermehrt, dann ist es so, dass die im ersten Jahr schon eine ganz lange Wurzel bilden kann und eigentlich eine große Resistenz hat gegen Trockenheit, gegen Insektenbefall- das sieht man bei Eichen gar nicht. Also die können das irgendwie ganz gut wegstecken. Und auch das Holz ist ja sehr beständig bei der Eiche also so Pilzbefall, das ist gar nicht so ein großes Problem bei Verletzung oder so was. Und es gibt jetzt andere Baumarten, die sehr jung sterben, sagen wir mal. Das wäre zum Beispiel die Birke. Birken wachsen extrem schnell, haben aber ganz kleine Samen, wie Staubkörner fast. Wo dann aber die allermeisten auch irgendwo hinfliegen und gar nicht aufkeimen. Und wenn dann mal so eine Birke keimt das geht dann ziemlich schnell. Aber ja die wird dann eben nicht alt, hat sag ich mal wenig Resistenzen, wird schnell mal so ausgedunkelt, wenn so die Konkurrenz da ist, dann ist das Licht weg, dann stirbt die auch ganz schnell. Oder wenn ein Pilz an der Birke ist, da kann man sagen: Oje, dann geht es schon schnell vorbei. Nun, das sind so die Unterschiede, würde ich sagen. Also, dass die alten, die alt werdenden Baumarten generell immer etwas resistenter sind gegenüber Umwelteinflüssen oder Schadwirkung.
Diringer: Jetzt hatten Sie auch schon angesprochen: Pilz, zu wenig Licht - was gibt es denn so für Faktoren, die jetzt zu einem Sterben von einem Baum, vielleicht auch von einem großen, schon recht alten, resistenten Baum beitragen?
Dr. Dittrich: Ja, das eine ist tatsächlich so eine Art Vergreisungseffekt. Also es ist so ähnlich wie beim Menschen wo die Durchblutung im Alter ja auch nicht mehr so gut funktioniert mitunter. Das ist bei Bäumen sehr ähnlich, ein Baum hat ja Wasserleitungen also er muss ja seine ganze Biomasse irgendwie ernähren. Man muss das Wasser irgendwie hinbringen, in große Höhen, und das funktioniert im Alter nicht mehr ganz so gut. Also, dass die Bäume dann schon versuchen, sich auch so ein bisschen zurück zu bauen, dass also Äste trocken werden. Das ist also durchaus auch eine Reaktion, dass man eben sagt: Ich schaffe es nicht mehr so gut mit dem Wasser. Also baue ich- werde ich kleiner und werfe Sachen ab. Und das andere ist tatsächlich auch eine nachlassende Lebenskraft, so würde ich es mal sagen. Also das Verletzungen nicht mehr so gut verheilen, wenn also mal ein Ast abbricht oder eine kleine Rindenverletzung da ist, dann wird die nicht mehr so gut vernarbt oder überwallt sagt man dann, also Bäume können Wunden ja schließen. Das geht im Alter nicht mehr so gut. Und dann sind in der Regel dann auch, sage ich mal bestimmte andere Organismen beteiligt. Also das können Insekten seien, also der Borkenkäfer ist zum Beispiel ein Sterbehelfer bei alten Fichten. Normalerweise muss man sagen also wenn die Fichte nicht mehr ganz so gut drauf ist und nicht mehr so viel Harz bildet, dann kommt der Borkenkäfer und bringt sie quasi um. Oder stößt sie über die Kante, so möchte man das nennen. Und das ist bei anderen Baumarten auch, sodass dann ganz oft eben Pilze beteiligt sind. Wobei der Pilz eigentlich gar nicht so der Killer ist, sondern oft auch ein Schwächeparasit, der dann so einem Baum den Rest gibt. So möchte ich es mal nennen.
Diringer: Also dann aktive Sterbehilfe in der Pflanzenwelt hier und da. Ja auf jeden Fall auch hier eine große Vielfalt, die wir sehen. Aber nochmal so auf die Interaktion zwischen Bäumen und uns Menschen. Wie wichtig sind denn die Bäume für die Biodiversität an sich und dann eben auch für uns als Menschen?
Dr. Dittrich: Ja, sagen wir mal also es gibt so die offensichtlichen. Wenn man -also man spricht ja bei Bäumen auch von Ökosystemleistungen, also von dem, was der Baum uns wirklich an Gutem bringt, das ist alles Mögliche. Das geht also los mit dem Bodenschutz, dass die Wurzeln den Boden festhalten und Erosion verhindern oder eben auch eine große Filterwirkung haben. Es ist eine Klimaregulation, weil Bäume eben viel Wasser trinken, aber auch viel Wasser über ihre Blätter abgeben. Das heißt, es ist auch in der Umgebung von Bäumen viel kühler. Das merkt man heute im Großen Garten. Also die großen Grünflächen, wo viele Bäume stehen, ist es immer ein paar Grad kühler als nebenan auf der Pflasterfläche. Früchte natürlich ganz klar also die ganzen Nutzgüter, Holz, Früchte und andere Nutzroh- oder sagen wir nutzbare Rohstoffe. Und dann eben die Frage sagen wir mal Biodiversität, also wirklich biologische Vielfalt- was hängt an so einem Baum alles dran? Und da kann man erst mal grundsätzlich sagen zum Beispiel in dem Garten ist es einfach wichtig, dass überhaupt ein Baum da ist. Grundsätzlich also, der eben Unterschlupf bieten kann für Vögel, für Insekten und eben auch für pflanzenfressende Insekten. Und bei den alten Bäumen speziell ist es dann eben so, dass die eben noch mehr Lebensraum bieten. Er ist- das ist es einfach ein größeres Haus, na also in dem größeren Haus kann ich mehr Leute unterbringen. Und in den großen Baum passt einfach mehr rein. Dass ist etwa die grundsätzliche Beziehung und dann eben, sagen wir mal gerade so, dass alte Bäume eben bestimmte Eigenschaften haben, die junge Bäume nicht haben. Zum Beispiel eben, dass sie ab und zu mal trockene Äste haben. Dass sie eben bestimmte Verletzung nicht mehr so austeilen, dass sich Höhlen bilden, also auch Höhlen, sind wichtige Lebensräume für viele Tiere. Die Borke reist auf. Das sehen wir bei der Eiche, aber auch bei der Buche, das da sich also Risse und Spalten bilden, Unterschlupf für ganz viele kleine Insekten, für Kleintiere und eben auch, sagen wir mal, so Schlupfwinkel, wo dann vielleicht auch ein Vogel, dann eben seine Nahrung suchen kann. Das sind so ganz wichtige Eigenschaften. Und zu guter Letzt eben große Bäume, große Holzmasse- viel gebundener Kohlenstoff, also man kann eigentlich jeden großen Baum als einen riesigen langlebigen Kohlenstoffspeicher betrachten. Und das Lustige ist, wenn ein alter Baum stirbt, ist es nicht so, dass der dann zu Gas wird, komplett das CO2 alles wieder in die Luft geht. Es ist nämlich so, dass der Baum sich ja ganz allmählich zersetzt und dann lauf- dann gibt es quasi so Abflüsse aus dem Holz, so Zersetzungsprodukte- Huminsäuren. Das sind so Kohlenstoffketten, die sich quasi ganz schlecht aufspalten und das geht direkt in den Boden, bei manchen Bäumen. Es ist also nicht so, dass das CO2 alles aus dem Holz wieder raus kann. Es geht in den Boden, in den Humuskörper hinein, und da kann man schon sagen auch ein alter Wald, wo die Bäume gar nicht mehr so viel wachsen und mit der Photosynthese gar nicht mehr so viel läuft. Auch das ist ein Kohlenstoffspeicher. Also schon wirklich sehr spannend und sagen wir mal zu guter Letzt natürlich, sagen wir mal das ästhetische, was natürlich haben wir jetzt auch in der, sagen wir mal Corona im Lockdown ja auch erlebt. Und das ist auch wissenschaftlich belegt, wenn Leute in der Natur unterwegs sind, ins Grüne schauen, dann tut uns das gut. Also heute nennt man das irgendwie Waldbaden in Anführungsstrichen. Früher hieß das spazieren gehen, aber die Wirkung ist die gleiche ja also, Bäume tun uns grundsätzlich einfach gut.
Diringer: Vielen Dank auch schonmal für diese Einblicke! Sie haben jetzt schon viel darüber geredet, dass eben auch alte Baumbestände gewisse Hohlräume bilden, bestimmte Krankheiten nicht so aushalten und dementsprechend für andere Tierarten und Pflanzenarten dann Lebensräume zur Verfügung stellen. Wie sieht es denn da aus? Wie soll man mit Altbaumbestanden umgehen? Soll man sie stehen lassen? Soll man sie in Anführungszeichen, wenn man das so formulieren kann, von ihrem Leid teilweise erlösen? Wie effizient ist es da dann junge Baumarten anzupflanzen?
Dr. Dittrich: Ja, das ist ein wichtiger Spruch. Ich arbeite ja in der Fachrichtung Forstwissenschaften. Es gibt einen wichtigen Spruch bei uns: "Es kommt drauf an!" Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass junge, schnell wachsende Bäume zum Beispiel sehr viel mehr Kohlenstoff binden. Das ist ein Argument für solche Sachen wie Kurzumtriebsplantagen, wo ich eben sehr schnell, sehr viel Biomasse erzeuge. Aber bei alten Bäumen spielt natürlich andere Sachen eine Rolle also rein ökologisch, wissenschaftlich sag, muss man sagen jeder alte Baum soll stehen bleiben Punkt. Das ist einfach so. Also wenn ich diesen Lebensraum erhalten will, dann muss ich eigentlich gar nicht viel tun, ich muss eigentlich es nur lassen. Und das gilt im Wald ganz genauso, wenn ich zum Beispiel in einen Wald wirklich sagen will: Ich will den biologisch aufwerten. Ich will die Höhlen haben, ich will die Strukturen haben. Dann muss ich eigentlich gar nichts machen. Ich muss es nur zulassen. Im Siedlungsbereich ist es natürlich ein bisschen anders, auch in Parkanlagen. Da gibt es solche Dinge wie Verkehrssicherungspflicht. Das ist dann schon eine rechtliche Frage. Denn natürlich ist es nicht sehr schön, wenn jemandem mal ein toter Ast auf den Kopf fällt. Also Bäume, also gibt auch diesen Rechtsbegriff der Gefahrenquelle. Das ist schon sehr wichtig. Also, wenn ich bei mir, sagen wir mal wenn ich als Gartenbesitzer oder als botanischer Garten sehe da ist ein Baum, der stirbt jetzt ab. Und da ist ein Ast, der hängt irgendwie so auf halb acht und jetzt beim nächsten Sturm oh je, dann muss ich tätig werden. Aber es gibt eben immer noch eine ganze Menge Stufen, bevor ein Baum abgesägt wird. Und das können wir in Dresden übrigens auch sehr schön sehen, dass hier sehr konservativ gepflegt wird. Also das kann ich durchaus so sagen, weil ich auch einige Kollegen kenne, die solche Gutachten machen. Dass man eben schon sagen kann, auch der alte Baum, der vielleicht zur Hälfte vertrocknet ist, den kann man so ein bisschen einkürzen. Dann ist er etwas stabiler. Und dann kann er vielleicht noch ein bisschen länger stehen und dann ist aber vielleicht die Höhle, die am Stamm ist, die bleibt dann noch erhalten. Also das ist durchaus möglich, wenn man einfach ein bisschen sorgfältig hinguckt und eben wirklich eine gute Einschätzung machen kann- wie lange hält der Baum noch? Das kann man recht gut heute, mit verschiedenen Methoden und im Wald kann man grundsätzlich sagen, abseits der Wege kein Problem. Da kann man jeden Baum sterben lassen, den man sterben lassen will. Also zumindest kann es ja immer im Bestand Bäume geben, die eben schon alt sind, die man auch gar nicht mehr nutzen möchte oder vielleicht auch gar nicht mehr nutzen kann, weil da einfach kein gutes Holz mehr dran ist. Und dann kann man eben die alte Eiche einfach in Ruhe lassen, und sie wird dann irgendwann von alleine zusammenbrechen. Aber das wird eben ein Prozess sein. Über viele Jahrzehnte.
Diringer: Nehmen wir an, es soll jetzt ein Gebiet tatsächlich neu besiedelt werden, mit Pflanzen, mit Bäumen. Wie sieht es da aus? Das Klima verändert sich, die Umwelt verändert sich. Was ist denn überhaupt heutzutage noch ein Exot? Und was für Auswirkungen hat das, wenn man diesen dann anpflanzen würde?
Dr. Dittrich: Hm, das ist natürlich eine gute Frage. Weil wir natürlich als Mitteleuropa, sind wir einfach ein Durchgangsland und einfach ja, ich möchte mal sagen unsere Flora ist eine Einwanderungsgesellschaft immer schon gewesen. Das ging also los, mit den, sagen wir mal, seit der letzten Eiszeit sind natürlich sehr viele Baumarten auch von alleine gekommen, im Laufe der Zeit. Aber spätestens, seit der Mensch wirklich Einfluss auf die auf seine Umwelt nimmt und Ackerbau betreibt. Ab dem Zeitpunkt hat man einfach ganz viele eingeschleppte Arten. Das ging also schon mit Ackerwildkräutern los, die also irgendwelche Bauern aus dem Nahen Osten aus dem fruchtbaren Halbmond einfach aus Versehen mitgebracht haben. Und das geht ja eben weiter mit ausgebrochenen Gartenpflanzen und solchen Dingen. Ja, dann ist schon die Frage was ist jetzt überhaupt noch Natur heute? Und grundsätzlich kann man erstmal sagen alles, was irgendwie da ist, was etabliert ist, damit muss man jetzt irgendwie auch umgehen und zurechtkommen. Und man muss natürlich sagen, es gibt ganz viele Exoten, die nimmt man gar nicht wahr. Also, da läuft, da tritt man mit dem Fuß drauf und merkt gar nicht, dass das irgendwie vielleicht so ein eingeschlepptes Unkraut aus Nordamerika ist. Und bei Gehölzen ist es auch so, dass es ganz viele Arten gibt, die stehen in unseren Parkanlagen rum, die machen eigentlich gar nix. Der steht da halt so. Und es gibt ein paar Arten, die sich eben sehr stark ausbreiten. Und vor diesen Arten, die also eine Ausbreitungsfähigkeit haben, die sich eingebürgert haben, davon ist ein sehr kleiner Bruchteil. Also man sagt immer eine von zehn Arten ist wirklich problematisch und hat also ungünstige Auswirkungen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass eine Baumart, den Standort sehr stark verändert. Also das macht, das machen alle Baumarten einfach durch Schattenwurf, durch Falllaub oder so. Aber wenn wir jetzt mal die Robinie nehmen als Beispiel, gibt es ja in Dresden auch ganz viel. Das ist eine Baumart aus Nordamerika, die zum Beispiel den Boden aufdüngt, also die kann Luftstickstoff binden, über bestimmte Bakterien in ihren Wurzeln. Und dann macht sie aus so einem Sand-Standort, der eigentlich sehr mager ist, wo man schöne bunte Blumen haben könnte. Da macht sie eben einen aufgedüngten Standort, wo bestimmte Pflanzen dann einfach nicht mehr wachsen. Also man hat unter Robinien ganz oft Brennnesseln, und das sind dann eben nicht irgendwelche Hunde, die dahin pinkeln. Das ist wirklich der Dünger von der Robinie. Also daran kann man das sehen. Und das kann man auch nicht rückgängig machen. Das wäre also Beispiel für eine Art, die man eben als invasiv bezeichnet, also eine Art, die eben gebietsfremd ist, eben nicht einheimisch und also negative Auswirkungen auf unsere biologische Vielfalt hat. Aber das ist wirklich eine Minderheit. Na, also wir reden sehr viel über Problemarten, wir reden aber nicht über viele Arten, die eigentlich sich sehr gut einfügen.
Diringer: Das heißt Exoten sind eventuell gar nicht so kompliziert zu handhaben, wie jetzt im Allgemeinen in der Gesellschaft so beäugt wird?
Dr. Dittrich: Das kann man durchaus so sagen. Also wenn man jetzt so an Gehölzarten denkt, wenn man wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlegen wollte, welche Baumarten die eingebürgert sind, sind wirklich problematisch. Da gibt es gar nicht so viele. Robinie wäre ein Beispiel. Anderes Beispiel wäre die Späte Traubenkirsche, die also in den Kiefernforsten teilweise sehr um sich greift, die man auch kaum bekämpfen kann. Roteiche ist auch durchaus ein Thema, weil die Streu sich sehr schlecht zersetzt. Also die Blätter sind einfach sehr hart und können von unseren einheimischen Bodentieren nicht so gut verwertet werden. Und da wächst einfach nichts drunter. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass eigentlich fast- Oder genau! Nicht zu vergessen gerade auch in Dresden oder in Leipzig ist es der Götterbaum. Der Götterbaum ist eine sogenannte hochinvasive Art und ist eine der wenigen Arten, wo es sogar eine EU-Richtlinie gibt, die zum Beispiel den Handel mit diesen Arten verbietet. Also es gibt eine EU-Richtlinie über über, sagen wir mal eine sogenannte Unionsliste, also für EU-weit invasive Arten. Und da sind die Mitgliedstaaten verpflichtet Prävention zu machen und diese Sachen wirklich auch aktiv zu bekämpfen. Mit Ausnahmen für national etablierte Arten, also das was schon ganz viel da ist, das kann man dann auch lassen. Der Waschbär ist zum Beispiel auch drauf. Das hat jetzt nicht mehr so viel Sinn. Und beim Götterbaum führt das eben dazu, dass der in Dresden nicht gepflanzt wird. Er muss nicht vernichtet werden. Aber wenn ich hier mal einer abstirbt in der Stadt, dann wird er auch ausgerodet. Das wäre zum Beispiel eine Art, die in jeder Pflasterritze auch hoch wächst. Und das kann unter Umständen schon problematisch werden, weil unter dem Götterbaum wächst nix. Die Blätter sind also extrem Schatten gebend- schwierig. So jetzt aber noch mal zum Positiven- genau. Und da kam, ist es, also war es jetzt für mich auch eine ganz interessante Erkenntnis, so die letzten Jahre, als wir uns eben mit verschiedenen Baumarten beschäftigt haben, von der Professur in Projekten. Wir haben uns einmal mit der Rot-Esche beschäftigt, also eine nordamerikanische Baumart, also eine Esche, die eine schöne Herbstfärbung hat, die auch nicht so krankheitsanfällig ist. Und die sehr trockenheitsresistent ist, die wir in Dresden inzwischen auch öfter mal haben. Das ist zum Beispiel ein Baum, der einen ganz interessanten Bewuchs hat mit Flechten und Moosen, also zumindest nicht schlechter als bei einheimischen Eschen, die auch Höhlen bildet. Also oder beziehungsweise Spechte machen da Höhlen rein, also die können was damit anfangen offensichtlich. Es gibt auch in Rot-Eschen, Wespen- und Hornissennester. Das kann man auch feststellen. Das wäre zum Beispiel ein Baum, der durchaus positive Eigenschaften hat, gerade in der Stadt. Oder sagen wir mal so ganz allgemein das ist etwas, was wir gerade machen im Erzgebirge also auch ein schönes Forschungsprojekt bis Ende des Jahres. Wo wir alte Bäume erfassen und zu den alten Bäumen, können ja auch Exoten gehören. Also auch eine Roteiche, die in einer Parkanlage steht, kann ja auch mal 200 Jahre alt sein. Und da sieht man schon bei solchen Bäumen. Da ist auch was los. Die haben nämlich auch Insektenlöcher, und die haben auch Rindenstrukturen und die haben auch mal Höhlen. Und die haben auch mal Hackspuren vom Specht und wenn da nix in dem Baum drin wäre, dann wird der Specht da auch nicht rangehen. Und das war schon die interessante Erkenntnis, dass man eben sagt, also ja, es gibt exotische Baumarten. Manche sind, haben ungünstige Eigenschaften aber ganz viele sind zumindest auch im Alter, als Habitat sehr gut geeignet. Und das war jetzt wirklich das ist so das erste Ergebnis, was wir auch gesehen haben, wo wir mal geguckt haben. Was sind so die Bäume, die so die meisten Habitatsstrukturen haben? Wo habe ich die meisten Höhlen dran und Risse? Da war auf dem ersten Platz war eine Buche. Eine alte Buche muss man sagen. Auf dem zweiten Platz war aber schon eine Esskastanie, und die Esskastanie ist nicht heimisch. Und auf Platz drei und vier. Was war da? Kulturäpfel -und Apfelbäume sind auch nicht einheimisch.
Diringer: Das heißt, kurz gefasst, Exoten nicht gleich abstempeln als Gefahr oder Negatives, sondern analysieren, schauen, was sie mit sich bringen und wie man sie positiv auch einsetzen kann in den einheimischen Gebieten, die es aktuell dann noch gibt. Man hört aber auch immer wieder davon, dass das Ganze nicht nur Auswirkungen auf die Pflanzenwelt hat, sondern eben auch Tierwelt. Ein bisschen, das ist schon angeklungen. Ein Stichwort ist hier auch das Insektensterben. Vielleicht können Sie noch sagen, wie in Anführungszeichen, gefährlich vielleicht auch solche Exoten für die Insektenwelt ist?
Dr. Dittrich: Ja also dazu gibt es auch ein paar Forschungsergebnisse, und solche Invasivitätsbewertungen haben zum Teil auch was mit Insekten zu tun. Also wenn man zum Beispiel die amerikanische Roteiche vergleicht mit unseren einheimischen Eichenarten, also Traubeneiche oder Stieleiche, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Weil eben auf den einheimischen Eichen viel mehr Insektenarten drauf sind. Die können eben mit der Roteiche nicht so viel anfangen. Also das ist ganz klar. Oder jetzt ein anderes Beispiel wäre die Douglasie, also eine amerikanische Nadelbaumart, die auch viel weniger Insekten hat als beispielsweise die Fichte. Also das kann man nicht, kann man nicht, von der Hand weisen, dass das so ist. Und es gibt inzwischen auch neue Untersuchung, wo man sich Straßenbaum Arten angeschaut hat. Das haben Kollegen aus Bayern gemacht. Da hat man zum Beispiel südosteuropäische Baumarten verglichen mit heimischen, zum Beispiel die Silberlinde und die Winterlinde oder auch die Blumenesche und die Gewöhnliche Esche. Und da sieht man durchaus auch, dass auf diesen nicht-heimischen Arten weniger Spezialisten sind, also mehr so Allesfresser würde ich mal sagen, Allesverwerter. Das ist in der Stadt aber eigentlich ganz normal, also wir haben hier keine naturnahe Umgebung. Man kann sich eigentlich freuen über jedes Insekt, was hier überhaupt noch ist. Und bei Eiche muss man eben sagen das ist einfach so, dass alte Eichen Spezialisten haben, bestimmte Käferarten, die findet man auf Roteiche beispielsweise nicht. Ich würde es ein bisschen relativieren, man muss ja immer gucken. In den Städten ist es ja einfach jetzt schon sehr heiß und sehr extrem auch trocken. Das erleben wir jetzt die Tage ganz massiv. Und da müsste man schon eher drauf acht, dass man sagt ich will überhaupt Bäume haben, die dauerhaft noch stehenbleiben und überhaupt Lebensräume bieten, als wenn ich hier jetzt mich mit einheimischen Arten beschäftige, denen es möglicherweise immer schlechter geht. Die ich alle paar Jahre ersetzen müsste, weil sie jetzt wieder vertrocknet sind oder krank geworden sind. Das bringt der heimischen Fauna auch nichts. Und im Wald kann man es doch ein bisschen anders lösen. Nämlich dann, wenn man mischt. Also es wird ja im Wald so sein, dass auch die Rotbuche immer noch ihren Platz behält. Sie wird aber möglicherweise seltener. Wir haben mehr Löcher, sie wird ja, wir haben ja massive Trockenheitserscheinungen jetzt bei Buche. Da macht das aber eigentlich nichts, wenn man mal so gruppenweise was exotisches mit reinstellt, weil die meisten Insekten sind ja doch mobil. Und wenn dann der große Heldbock seine Eiche jetzt gerade mal 50 Meter weiter nicht findet, dann wird er vielleicht sich auch noch mal 50 Meter weiter bewegen, dass sehe ich gar nicht mal so dramatisch. Also schwierig sind Monokulturen, sagen wir mal so bei der Fichte löste sich ja hoffentlich jetzt mal ein bisschen auf. Und da sollte man jetzt nicht den Fehler machen, sage ich mal die Fichte jetzt zu 100 Prozent durch Douglasie zu ersetzen, das wäre total verkehrt. Das muss man sagen. Aber auch bei einheimischen Baumarten gibt es große Unterschiede in der Wertigkeit. Also die Eiche steht ganz oben mit ich glaube 5000 verschiedenen Insektenarten, die nachgewiesen sind, die meisten sieht man gar nicht. Und es gibt auch Baumarten, die sehr wenig Insekten habe, also Ahorne sind nicht so interessant, würde ich sagen. Fichten eigentlich auch nicht. Aber so die, die so die wichtigen Laubbäume, so Eiche, Linde, die Obstarten das sind die wertvollen, aber viele heimische auch nicht.
Diringer: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die einzelnen Zuhörer*innen eingehen, was kann man denn in seinen Garten pflanzen ohne schlechtes Gewissen oder um etwas besonders Tolles für die Natur beizutragen?
Dr. Dittrich: Ja, also. Grundsätzlich kann man natürlich immer sagen einheimische Arten sind grundsätzlich immer gut oder zumindest jetzt bei, wenn man jetzt über Blumen redet, natürlich so Wildformen und nicht so züchterisch veränderte Sachen. Und bei Gehölzen tja, das ist die Frage. Man möchte wenn man natürlich Sachen haben will, die vielleicht noch eine höhere Überlebenschance haben, die man wenn man jetzt heute pflanzt. Tja, dann wäre man natürlich immer noch mit Obst sehr gut beraten. Also Apfelbäume sind nach wie vor zu empfehlen. Es gibt auch inzwischen Zierapfelsorten, die sehr trockenheitsresistent sind, die also von den Vögeln gut angenommen werden die Früchte und die Blüten sind auch bei Bienen sehr beliebt. Das geht nach wie vor. Es gibt auch ein paar einheimische Bäume, die gar nicht mal schlecht sind, also zum Beispiel der Feldahorn, der auch sehr viel Wärme und Trockenheit aushalten kann. Oder der Burgen-Ahorn, das ist eine ganz seltene einheimische Baumart. Der hat so drei spitzige Blätter, ist so ein hübsches kleines Bäumchen, der enorm trockenheitsresistent ist, aber trotzdem auch die Winterhärte noch hat. Es ist eine tolle Bienenweide. Und die Früchte werden eben immer auch von Vögeln durchaus genommen. Also das, also man kann durchaus auch noch einheimische Baumarten finden, die geeignet sind. Und bei den Exoten ja, was gibt es da, also ich würde sagen die Blumenesche geht sehr gut. Die kommt aus Südosteuropa also ist nicht so ganz so weit weg von uns. Oder auch für große Gärten, man könnte sich auch durchaus beschäftigen mit der Baumhasel, die Baumhasel kommt aus Kleinasien. Und auch diese Nüsse von der Baumhasel werden von Tieren genommen und Menschen können die auch essen. Also ein schöner kleiner Baum von so 20 Metern. Na gut, für manche Gärten dann auch schon zu groß, aber bei 20 Metern hochinteressant. Also, es ist nur wichtig, sich so bisschen damit zu beschäftigen und nicht alles, was man zu kaufen bekommt, ist gleich gut. Also grundsätzlich der Vorzug für einheimische Baumarten. Und da gibt es eben so ein paar trockenheitsresistente und man kann auch immer schauen, wo was, was hat sich vielleicht auch an Exoten bewährt. Also dazu haben wir im Moment doch schon ganz gute Erkenntnisse für viele Baumarten.
Diringer: Also schon eine kleine Kaufempfehlung vielleicht hier und da. Oder zumindest eben auch der Aufruf, nicht nur das zu kaufen, was vielleicht ganz hübsch aussieht, sondern etwas zu finden, was hübsch aussieht und gleichzeitig noch einem positiven Effekt hat. Jetzt, bevor wir in die Fragerunde auch ans Publikum weitergeben, noch ein letzter Aspekt. Und zwar hatten sie vorher auch schon erwähnt, dass es unter anderem EU-Richtlinien gibt, was auch Exoten betrifft et cetera. Wie sieht denn da so die politische Situation aus? Und gibt es da auch noch Wünsche ihrerseits, wie diese politische Ausrichtung sich entwickeln soll?
Dr. Dittrich: Ja, ähm. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass so die EU-Richtlinien sind, relativ restriktiv was gebietsfremde Arten angeht. Es gibt eben diese Unionsliste für die gebietsfremden Arten auf EU Ebene. Die wird alle paar Jahre auch aktualisiert. Es werden, die Liste wird quasi auch immer länger, weil immer mehr eingeschleppt wird. Ja, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Also wenn man, das Prinzip Prävention finde ich sehr wichtig und wenn aber Sachen dann auch etabliert sind, muss man damit irgendwie pragmatisch umgehen. Und man muss wirklich auch in vielen Bereichen sagen, man kann eigentlich nichts mehr machen. In vielen Bereichen ist es eine massive Geldverschwendung, die eigentlich nichts mehr bringt. Aber es ist ebenso, es gibt ja auch die die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) also, die eben festlegt, wie europaweit bedeutsame Lebensraumtypen zu schützen sind. Und da ist zum Beispiel geregelt für bestimmte Waldlebensräume, davon gibt es in Deutschland auch ein paar zum Beispiel unsere Buchenwälder, sind auch FFH-Lebensraumtypen von europaweiter Bedeutung. Und wenn man dort einen gebietsfremden Baum hat, der so 20 Prozent Anteil hat, dann bekomme ich Schwierigkeiten. Das heißt dann nämlich erstmal möglicherweise fällt so ein Bestand aus der Bewertung heraus. Dann ist, dann habe ich einen Verlust, weil das dann nämlich Exoten-Forst ist nach EU-Recht. Und wenn ich geringere Anteile habe, bekomme ich eine schlechte Bewertung. Und die FFH-Richtlinie legt fest, dass es ein Verschlechterungsverbot gibt. Das heißt dem Moment, wo ich den Buchenwald eine Douglasie pflanze, ist das eine Verschlechterung. Das ist eigentlich verboten oder führt zumindest Vertragsstrafen nach sich, wenn sowas großflächig passiert. Das Problem ist nur, dass die, dass die FFH-Richtlinie eben nicht unterscheidet zwischen invasiven Arten und gebietsfremden, die vielleicht sich integrieren. Man will, man will einfach die Diskussion nicht haben, sonst würde man sofort sagen die eine Douglasie tut doch nichts. Und lass uns doch mal das versuchen. Das ist dann irgendwo politisch. Aber das Schwierige ist das, und dass diese FFH-Richtlinie zum Beispiel sehr stark auf einen konservierenden Naturschutz setzt und nicht auf Veränderung. Und wir sehen ja, dass sich eben die Buchenwälder verändern, weil wir Klimawandel haben, weil es Trockenstress gibt. Und zwangsläufig werden dort andere Baumarten von alleine auch zunehmen. Und da, da wird es massive Diskussionen geben die nächsten Jahre. Also die Naturdynamik ist da sozusagen in Gesetzesform nicht drin. Das ist ein sehr großes Problem aus meiner Sicht. Aber ich wüsste auch nicht, was man da kurzfristig dran ändern sollte. Und man muss immer sagen FFH ist eine der besten Naturschutzgesetzgebungen, die es auf der Welt gibt. Und man sollte das Paket nicht mutwillig aufschnüren, weil dann ist es möglicherweise nicht mehr zu retten.
Diringer: Auf jeden Fall viel, was sich dort verändert und auch, was sich lohnt, weiterhin zu beobachten, jetzt aber auch erstmal an das Publikum hier, gibt es Fragen die aufgetaucht sind?
Gast: Naturschutzfachlich wird ja argumentiert, vor allen erlebe ich das bei Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzen in der Landschaftsplanung, pflanzt doch bitte die heimische Ware - Buche, Eiche, Ahorn, Linde- das was wir kennen, die werden sich schon irgendwie anpassen. So. Klimatisch befinden wir uns in einer Situation, wo ich sage wir finden uns im Klimawandel. Eigentlich muss schnell reagiert werden und ihre Meinung dazu- schaffen das die heimischen Gehölze das noch hinzubekommen, also sich anzupassen, Anpassungsstrategien zu entwickeln? Oder ist es so, dass man sagen müsste ähm, nein, wir müssten relativ schnell umrüsten. Und das; was eigentlich im Tertiär oder wenn man so in die Erdgeschichte guckt, was ja eigentlich schon mal auch hier war, also wir bewegen uns ja eigentlich so hitzehistorisch wieder auf dieses, auf diese Punkte einige Jahrhunderte zurück; das aufzupflanzen, was eigentlich jetzt als Exoten uns als Palette dient, was man pflanzen könnte, die hitzeresistenter sind?
Dr. Dittrich: Ja die Diskussion kenne ich. Also ich bin tatsächlich selber an so einem kleinen Naturschutzprojekt beteiligt, wo wir genau solche kritischen Anfragen hatten. Wir haben also selber wirklich auch Exoten gepflanzt. Und dann sagen wir mal, sagt die Untere Naturschutzbehörde schonmal oder fragt mal nach: muss das wirklich sein? Also grundsätzlich kann man auch bei einheimischen Baumarten sagen, die Jüngeren, das was heute gepflanzt ist, hat eine Chance sich zu adaptieren. Also je jünger die Bäume sind, desto eher können Sie sich auch einstellen, weil die alten Bäume können das weniger gut. Das ist die Erfahrung, die wir seit 2018 eigentlich haben. Also man kann ja immer sagen auch die alte Eiche hat auch mal im Hochmittelalter einen Extremsommer erlebt, so zwölftes Jahrhundert war es ja in Deutschland auch ein bisschen wärmer, aber im hohen Alter ist das schwierig. Das ist einfach so. Und man kann immer grundsätzlich sagen auch in den Buchenwäldern sieht man das schon. Die jungen Bäume, die unten drunter stehen, die überleben das eher. Also solange ich, wenn ich die Sachen pflanze und sie dann wirklich anwachsen, besteht schon eine gewisse Chance auf Adaption. Also, ich würde sagen also, man muss nicht darauf verzichten einheimisch zu pflanzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man schon mit bedenken sollte auf einheimische Sachen zu gehen, die etwas trockenheitsresistenter erwiesenermaßen sind. Oder wirklich auf Exoten, die vielleicht aus einer benachbarten Region kommen, also vielleicht nicht die Nordamerikaner, aber vielleicht Sachen aus Südosteuropa, die mit unsern Tier- und Pflanzenarten vielleicht ein bisschen Kontakt schon mal hatten. Also ich sag mal so Balkan, Rumänien ist nicht so weit weg. Und da gibt es ja auch Buchen. Was allerdings sehr wichtig ist, auch gerade bei Pflanzaktionen, ist natürlich die Frage des Saatguts oder die Herkunft des Pflanzgutes. Und leider ist es ja dann doch so, die Baumarktware, die irgendwie aus Holland kommt und gehätschelt ist, die wird möglicherweise doch eher zugrunde gehen in Sachsen, würde ich mal sagen unter bestimmten Bedingungen. Also man müsste schon gucken habe ich regionale Herkünfte, also das, was vielleicht im Wald jetzt noch überlebt. Das wird vielleicht auch dann bei einer Pflanzung besser angehen. Oder auch beim Saatgut genauso. Da muss, also im forstlichen Bereich ist das ja sehr wichtig, diese Herkunftsgeschichten, was zum Beispiel im Garten-Landschaftsbau überhaupt keine Rolle spielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen man kann natürlich immer noch argumentieren: Ja, Vorzug für einheimische Sachen mit einem, mit nem Adaptionspotenzial, das ist sicherlich da. Ähm sorgfältig auswählen plus sagen wir mal so Sachen aus anderen pflanzengeografischen Regionen, von denen man weiß, dass sie verträglich sind. Oh da gibt es eine ganze Menge. Aber ich, es ist richtig, also man muss da schon gut argumentieren. Wenn man eben sagt, wir wollen doch mal die Esskastanie pflanzen, mediterrane Baumart, nicht heimisch aber mit einem super ökologischen Wert. Oder der Speierling wäre so ein Beispiel, oder die schwedische Mehlbeere, wo man ja auch sagen würde, die ist ja auch nicht heimisch eigentlich. Ja, also grundsätzlich würde ich da sehr pragmatisch mit umgehen. Aber ich sag mal, man kann die Einheimischen, man soll sie nicht ganz aufgeben. Und das Junge kann durchaus überleben, könnte aber möglicherweise nicht so alt werden. Also die 200-jährige Buche, vielleicht gibt es die nicht mehr irgendwann.
Diringer: Erlauben Sie mir eine kurze Anschlussfrage, bevor wir wieder zum Publikum übergehen. Sie meinten, dass gerade zum Beispiel Arten jetzt von der Balkanregion dann auch in Anführungszeichen her wandern oder sich dann zu unserem neuen Klima besser geeignet sind. Wie ist es denn andersrum mit den einheimischen Pflanzen aus Deutschland: finden die vielleicht neue Heimaten, für die sie jetzt im Klima besser passen?
Dr. Dittrich: Ähm, ja, das ist ganz spannend. Also bei Bäumen sind natürlich Wanderungen wirklich sehr langsam, muss man sagen. Aber was man, also so richtige Wanderungsbewegungen vom Balkan kennen wir nicht, also das ist bis jetzt alles mit menschlicher Hilfe. Also die Rosskastanie ging es los im 19ten Jahrhundert. Und jetzt eben solche Sachen wie Baumhasel. Aber wir sehen das bei Gehölzen auch, zum Beispiel bei der Stechpalme. Also Ilex ist in Nordwestdeutschland ja sehr verbreitet, also dieser, so ein schönes, immergrünes Gehölz mit roten Beeren. Und das blieb im Moment, also blieb, blieb als Wildbaum immer so in Mitteldeutschland stecken. Ungefähr da, wo es im Januar noch null Grad kalt ist. Also das ist diese Null-Grad-Isotherme in der Meteorologie. Und man merkt jetzt durch den Klimawandel, dass die Ostgrenze sich immer weiter verschiebt, also die Stechpalme, wandert nach Osten weil es im Winter wärmer wird. Das merkt man also wirklich. Also, dass wir da auch innerhalb von Deutschland sogar einen Florenwandel haben. Und auch, ich glaube auch durchaus, dass manche exotischen Arten sich einfach dadurch besser vermehren, weil es wärmer wird. Und andersrum ist es auch so, es gibt auch europäische Arten, die in Nordamerika eingeschleppt werden und da zur Plage werden. Weil sie eben dort eben auch ihre Schädlinge nicht haben und eben dort auch nicht kontrollierbar sind. Zum Beispiel gilt der Spitzahorn in Nordamerika als invasive Art. Also die hatten da mal etwas wiederbekommen von uns. Also, das gibt es durchaus auch. Oder dass bestimmte Baumarten nach Norden wandern, also zum Beispiel bei der Buche ist es mittlerweile auch schon feststellbar. Dass die Rotbuche weiter nach Norwegen und Schweden wandert, wo sie eigentlich nur im äußersten Süden war. Und jetzt eben, wo die Winter nicht mehr so kalt sind, da geht es so schrittweise nach Norden. Das kann man wirklich sehen, aber eben in Trippelschritten ja.
Diringer: Also auch langjährige Entwicklungen in die Zukunft. Gibt es?- Ja es gibt eine Frage sehr schön.
Gast: Weil sie, Zwecke von dieser Robinie sagen wir mal so, klar ist das eine invasiv Art. Aber das könnte ja jetzt auch eine Chance sein, für unsere Insekten zum Beispiel, die auch von Insekten ja sehr sehr gut angenommen wird, als Bienenweide grad beim Bienensterben und alles. Dann ist es auch als Holz sehr wertvoll eigentlich, weil es ja Tropenholz ersetzen kann mit seinen wertvollen Holzeigenschaften. Das sozusagen als Holzschutzmittel und vielleicht dass der Regenwald weniger abgeholzt wird, wenn man dann auf Robinienholz setzt. Was dann robuster ist, auch ohne Holzschutzmittel. Und könnte man ja als Chance so sehen, dann ist es ja robuster gegen Trockenheit alles. Man muss ja auch sagen, gerade die Fichte ist ja auch kein einheimischer Baum im Flachland, das ist ja Gebirgsbaumart. Wir hatten vor kurzem einen Förster da, der eben gesagt hat, Robinien gehören jetzt nicht mal, zum Beispiel Douglasien, gehören nicht mehr in den Wald rein. Die werden nicht mehr aufgepflanzt und dürfen sozusagen verschwinden mit der Zeit jetzt langsam. Aber die Douglasie oder so, ist ja auch ein Baum, der viel mehr Trockenheit aushält als so eine Fichte, die doch gestresst ist und alles. Also wir haben große Exemplare, da muss man auch sagen- Was sagen Sie dazu, sagen wir mal so, ist es dann richtig ist das gar nicht mehr zu pflanzen oder? Muss man das als Chance sehen?
Dr. Dittrich: Ja, also es kommt, sage ich mal auf die Situation an würde ich mal sagen. Bei der Robinie ist es ja so, dass man die man, die eigentlich so im Bestand ganz gut kontrolliert bekommt. Ist ja eine Lichtbaumart und das heißt in dem Moment, wo ich den Bestand nicht zu stark öffne, kann ich da jetzt so die Ausbreitung auch ein bisschen verhindern, weil die ins Dunkle ja nicht geht. Und ja, unbestritten also die Holzeigenschaften und ich meine, man kann ja dieses Aufdüngen des Standortes kann man ja auch positiv sehen. Zum Beispiel, jetzt aber mal in so Bergbaufolgelandschaften irgendwo in der Lausitz auf diesen Braunkohlehalden, da wächst ja fast nichts. Aber wenn ich Robinien habe, wachsen die Sachen besser. Also das Problem sind wirklich so die Kontaktzonen zum Offenland, also dann wenn die Robinie den Wald verlässt. Und da muss man eine Kontrollmöglichkeit einbauen, dass man eben sagt, ich habe eine Pufferzone. Wenn ich zum Beispiel so eine Binnendüne habe, eine schöne Sandlandschaft, dann muss ich schon gucken, dass die Robinie vielleicht nicht zu dicht an den Wald rankommt, dass sich die irgendwie so ein bisschen kontrollieren kann. Also das ist nicht ganz einfach. Aber das kann man waldbaulich, denke ich, irgendwie schaffen. Was die Douglasie angeht, ist es eigentlich sehr ähnlich, weil die Douglasie, wenn ich die mit Buche mische oder mit Schattenbaumarten, dann passiert auch nicht so furchtbar viel. Na, das kann ich eigentlich ganz gut kontrollieren. Das Schöne bei der Douglasie ist ja, wenn ich sie absäge, dann ist sie weg. Aber da ist ja das Problem mit solchen Blockhalden, also Offenstandorte, wo einheimische Baumarten fast gar nicht wachsen, da geht die Douglasie rein. Und dann sind die halt weg so. Na also, das sieht man im Schwarzwald so, zum Beispiel. Das ist nicht ganz ohne, sage ich mal. Aber ich sage mal, waldbaulich kann man solche Sachen im Griff halten, und ich finde immer Mischung wichtig, dass ich eben sage, keine Reinbestände. Das ist eigentlich grundsätzlich nicht gut, dass wäre bei Fichte auch nicht gut. Also mit so gruppenweise einmischen und vielleicht Pufferzonen zu geschützten Biotopen, die man aber dann auch kontrolliert und dann in so einem Streifen wirklich die Sachen auch weg macht, dann ist da eigentlich wenig einzuwenden. Also ich halte so, dieses Schwarz-Weiss-Denken halte ich auch für falsch an der Stelle. Und im Stadtbereich da ist es mit Robinie schon ein bisschen kritisch, also so auf so so Schutthalden oder so. Und da muss man dann vielleicht die Leute noch ein bisschen mehr schulen, wie man das auch sachgemäß bekämpft. Also ich kann mich jedes Jahr darüber belustigenden, wenn in meiner Nachbarschaft, in so einem geschützten Biotop, die Douglasien abgeschnitten werden, mit dem Astkneifer, und nächstes Jahr habe ich dann vier Stämme von den Dingern. Also irgendwie ist das nicht sehr sinnvoll, muss man einfach mal sagen. Und auch so ein Baum abzusägen, passiert ja dann auch erst mal dann ganz viel Dornengestrüpp und dann ist der auch nicht weg. Aber ne da würde ich auch mitgehen, also die Potenziale sind da und in Mischung geht viel.
Gast: Es wurde ja auch schon mal gesagt das da ja sehr sehr viel, auch hier sowieso schon heimisch war. Durch Tertiär, ist ja dann bloß durch die Eiszeiten ausgestorben, was halt da nicht passiert ist. Warum dann das Zeug nicht zurückholen? Wenn es halt möglich ist…
Dr. Dittrich: Ja zumindest kann man sagen verwandter Arten, also im Tertiär sind die Sachen ja ausgestorben, weil sie eben in den Alpen hängen geblieben sind und nicht wieder hochkamen. Bei Douglasie ist es nicht so richtig nachgewiesen, muss man dazu sagen. Aber grundsätzlich ist das Argument nicht falsch.
Gast: Das sind dann andere Arten dann, viele Eichenarten, Ahornarten…
Dr. Dittrich: Also ja Eichen, Mammutbaum…
Gast: Also sind wir eigentlich artenarm in der Gegend sozusagen?
Dr. Dittrich: Genau, in Amerika gibt es eben zehnmal so viele von jeder Gattung, na das ist ganz klar. Also beim Ahorn sehe ich das, bei der Eiche na klar. Aber sagen wir mal man hat eben die Zeit dazwischen, wo sie dann eben nicht da waren, wo die Anpassung von bestimmten Tierarten noch nicht da ist. Aber es kann natürlich auch sein, zumindest bei südosteuropäischen Arten, dass die Schädlinge da nach wandern.
Gast: das passiert ja auch schon.
Dr. Dittrich: Das passiert schon, bei der Rosskastanie sehen wir das ja, die Miniermotte kommt ja vom Balkan mit Verspätung. Und es wird bei anderen Arten ganz genauso sein. Na also, dass da die Kontrolle dann auch wieder da ist und das fügt sich dann schon auch ein. Und man sieht das auch bei den Vögeln zum Beispiel, bei, bei bestimmten Fruchtbäumen. Die Vögel brauchen schon eine Weile, bis sie das auch annehmen. Aber eigentlich wird sehr viel angenommen. Na auch die Roteichen werden auch angenommen vom Eichelhäher und die Baumhasel da haben die Vögel auch eine Möglichkeit gefunden, die zu knacken, die Esskastanie können die Wildschweine auch aufmachen. Geht alles.
Gast: Da wärs doch eigentlich besser man pflanzt jetzt hier zum Beispiel die amerikanischen Kastanien, die jetzt nicht anfällig sind für die, statt wie die Rosskastanie. Oder ist das nicht-? Eigentlich ist die Rosskastanie ja auch nicht einheimisch, die wurde ja auch erst hergebracht.
Dr. Dittrich: Ja, es kommt darauf an. Na also bei den Rosskastanien ist es so, dass die meisten noch mehr Wasser brauchen. Die sind halt überhaupt nicht trockenheitsresistent. Also da wäre die, die echte schon noch,die können sie gar nicht ersetzen, muss man einfach mal sagen. Also Miniermotte, plus jetzt neuerdings die Rindenkrankheit, die haut die noch massiv kaputt. Also Rosskastanien kann man eigentlich nicht mehr pflanzenguten Gewissens. Ähm ja und bei Eschen haben wir das nächste Problem. Also, da würde ich noch mal darauf eingehen, wir haben ja das Eschentriebsterben in Deutschland, was also alle europäischen Eschen betrifft, die drei, die wir haben oder zwei. Die amerikanischen sind resistent gegen das Eschentriebsterben, zum Beispiel Rot-Esche wäre jetzt der Ersatzbaum für die Gewöhnliche Esche, auch wenn die ganz andere ökologische Eigenschaften hat. Aber jetzt haben wir noch den Käfer der die Eschen auffrisst, aus Asien. Es gibt, es gibt es noch den Smaragdgrünen Eschenbohrer. Und der geht auch an die amerikanischen Eschen. Was bleibt dann übrig? Dann habe ich dann auch asiatische Eschen, und die kennen wir noch gar nicht. Also haben wir wenig Erfahrung mit, also das eine sind sozusagen die natürlichen Schädlinge, die nachwandern, die man ja eigentlich gut finden kann, aber eben auch exotische Sachen, eben bestimmte Käferarten oder auch Krankheitserreger, die auch einheimische und exotische Baumarten betreffen. Und das wird, das kommt durch die Hitze kommt es natürlich noch stärker, jetzt weil die Bäume einfach gestresst sind. Na Schwächeparasiten.
Gast: Nochmal nachgefragt wieviel Sinn macht es jetzt so viel Weißtannen aufzupflanzen? Sagen wir mal so, jetzt wird ja massenweise Weißtanne aufgepflanzt und die Weißtanne, haben wir in unserem Baumpark festgestellt, ist ja spätfrostgefährdet. Was die anderen Tannen, die treiben aus da passiert überhaupt nichts. Und die andere, die genau daneben steht - erfroren, die einheimische.
Dr. Dittrich: *Lachen*
Gast: Macht es soviel Sinn da jetzt im Flachland überall Weißtannen hinzupflanzen, ich meine natürlich kommt sie im Schwarzwald vor. Aber ja jetzt hier, mitten im Flachland in der Trockenheit?
Dr. Dittrich: Also im Flachland finde ich das auch ein wenig schwierig, muss ich sagen. Also, da muss man sich natürlich, sagen wir mal als Wirtschafter, auch ein bisschen Gedanken machen. Was habe ich überhaupt für Standortbedingungen na und Spätfrost kann ja auch im Klimawandel auftreten. Also im Bergland, auf geeigneten Standorten würde ich sagen so viel Weißtanne wie möglich um Gottes willen, ja, also bitte schön. Ähm wir hatten im Erzgebirge ja immer Buchen- Tannen-Mischwälder mit ein bisschen Fichte. Also soll man doch jetzt die Fichte vielleicht abschreiben und jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit Tanne machen, die ja technisch genauso ist vom Holz und ökologisch sich wunderbar einfügt, die tiefe Wurzeln macht, die vielleicht auch im Trockenjahren noch an das Wasser rankommt. Aber im Flachland muss man natürlich schon überlegen ja, ne die Tanne war da nie. Sie ist nicht standortsheimisch und möglicherweise noch nicht mal standortsgerecht bei der Spätfrostgefahr-eher nicht. Das Spannende ist aber, dass es natürlich auch exotische Tannenarten gibt, die ziemlich robust sind. Nur die meisten sind forstlich total uninteressant und ökologisch können wir da noch nicht viel zu sagen. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel Coloradotanne die hat auch im Erzgebirge den ganzen Smog ausgehalten bis in die 90er Jahre. Aber die hat kein gutes Holz. Das ist leider so. Aber die würde zum Beispiel Spätfröste sehr viel besser aushalten. Ja.
Gast: Ich hätte noch mal eine Frage zurück zu den Robinienwäldern und Robinienreinbeständen, gibt es da Untersuchungen, solche Robinien-Monowälder weiterzuentwickeln, weil sie was von weiter…Forst, Forschung in Richtung Waldentwicklung gesprochen haben. Gibt es da so Untersuchungen und und schon Ergebnisse wie solche Wälder auch mit anderen Gehölzen noch zusätzlich gepflanzt werden oder weiterentwickelt werden? Dass die Robinie vielleicht auch nicht mehr dort als Mono- Baum da ist, sondern eben auch mit in Mischbeständen vorkommt?
Dr. Dittrich: Also teilweise passiert es auch von alleine tatsächlich, also die Robinie verbessert ja den Standort, sage ich mal, einfach durch ihre Eigenschaften. Und andere Baumarten kommen dort auch teilweise von ganz alleine rein. Also andere Pionierbaumarten zuerst, die Robinie lässt sehr viel Licht durch, ist jetzt ja nicht so ein Schattenbaum wie die Buche und die Einheimischen folgen eigentlich. Und wenn man sich so in Dresden Robinienbestände anschaut, die kenne ich jetzt am Besten, auf so Brachflächen oder so was, da sind auch immer mal Ahorne dazwischen oder Eschen. Also durchaus einheimische Baum- und Straucharten. Und die werden dann auch irgendwann übernehmen. Und inzwischen stellt man auch in bestimmten Robinienbeständen fest, dass die auch irgendwie von alleine zusammenbrechen. Man weiß nicht genau, warum. Aber gut die, die Lebensdauer der Robinie ist ja ohnehin begrenzt und die Konkurrenzkraft ist relativ schlecht. Also wenn die Einheimischen auch einwandern mit der Zeit, was beim Ahorn ganz gut funktioniert und bei der Esche, die machen dann schon den Schatten. Und dann ist die Robinie auch sehr stark reduziert mit der Zeit. Das kann man schon sagen. Ja, also eben die ist, sag ich mal so was den Unterwuchs angeht, passt da noch viel rein. Oder man kann eben von, ich wüsste nicht ob man jetzt von vorneherein solche Bestände neubegründet, wo man gleich mischt, das wüsste ich nicht. Aber das sagen wir mal in der Dresdner Heide sieht man es immer wieder bei so Kiefern-Reihenpflanzung, da wandert die Robinie von alleine rein. Also hat man dann zwei Lichtbaumarten, die sich gegenseitig wenig tun, würde ich mal sagen, wobei die Kiefer wahrscheinlich dann doch ins Hintertreffen gerät. Aber normalerweise läuft es umgekehrt, dass man eigentlich sagen kann ich habe so Pionierwald-Situationen, ich kann die Robinie vielleicht auch ernten, wenn sie schön gewachsen ist. Und dann wird die nächste Generation deutlich bunter sein. Und dann habe ich die Einheimischen auch drin, wenn der Boden eben auch verbessert ist und so Ahorn mag ja Nährstoffe ganz gerne. Na also, der profitiert dann mit.
Diringer: Wir hatten vorhin auch noch ein Thema so ein bisschen angeschnitten, von internationalen Insekten- und Baum-Interaktionen vielleicht von dort auch nochmal übergegangen auf die internationale Forschung. Bei ihnen war es Dresden, Göttingen. Wie sieht es deutschlandweit aber auch über die Grenzen hinweg aus? Wer kennt sich den gut in diesen Gebieten aus?
Dr. Dittrich: Ja, also ich da, sagen wir mal international bin ich selber nicht so viel unterwegs. Aber was so die akt- was so ganz wichtige Forschungsfelder sind, sind im Moment einfach Biodiversitätseffekte. Also was macht das für einen Unterschied, wenn ich eine Baumart auf der Fläche habe oder vielleicht zehn verschiedene oder wie interagieren Bäume in verschiedenen Mischungen? Also es gibt Baumarten, die sich zum Beispiel gegenseitig fördern und welche die sich gegenseitig sehr stark bedrängen, was dann wiederum auch ein auch Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Insektenvielfalt. Und da gibt es große Forschungsverbünde, also dieses Thema Baumdiversität oder funktionelle Diversität, wie man das nennt. Da gibt es international sehr viel, also unsere Professur ist jetzt an einem Projekt beteiligt in China, wo man im Moment relativ schlecht arbeiten kann, muss man leider sagen. Wo man eben also einfach mal ganz verschiedene Baumarten-Mischungen, wirklich in der Fläche ausgebracht hat oder einfach mal schaut, was passiert denn da, wenn ich ganz verschiedene Baumarten einfach mal zusammenschmeiße? Also das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Und in Deutschland haben wir, aktuell ist ein Thema so der Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die biologische Vielfalt. Also welche Bewirtschaftungsmethoden sind möglicherweise besonders biodiversitätsfördernd? Oder wo habe ich vielleicht eher auch die waldtypischen Arten, was vielleicht viel weniger sind? Das ist ein wichtiges Thema. Und das Thema Strukturvielfalt, wir reden ja sehr viel über Totholz und solche Dinge. Also Totholz ist ja wichtig im Wald gerade für viele Insekten. Und das kommt ja jetzt quasi von alleine durch die Trockenheit, also aber völlig unreguliert und unsystematisch. Und die andere Geschichte ist auch die strukturelle Vielfalt. Also wir wollen ja weg von Monokulturen, wo ich dann so eine Baumschicht habe und die Bäume sind irgendwie alle gleich alt und sehen irgendwie alle gleich aus. Ich will ja eigentlich hin zu so Baumgesellschaften, die etwas mehrschichtiger sind, also wo ich Alt und Jung gemischt habe, also eine größere Alters-Differenzierung, wenn man so will. Aber auch die Frage wie sieht so eine Waldlandschaft aus, wenn ich vielleicht auch mal eine Lichtung mit drinnen habe oder vielleicht mal Totholz auf einen Haufen schmeiße oder irgendwie so im Bestand verteile? Das sind so ganz wichtige Forschungsfragen. Wenn ich jetzt mal so so überlege, sagen wir mal unsere forstlichen Fakultäten gibt es ja im Prinzip. Es gibt ja drei Universitätsstandorte, nein vier, und auch mehrere Fachhochschulen, wo da relativ viel zu gemacht wird. Wir kooperieren aktuell sehr viel mit der Uni Würzburg. Haben jetzt ein Projekt in Unterfranken, in einem Laubmischwald, wo wir also experimentell im Wald Totholz angereichert haben, Lichtungen geschaffen haben, auch teilweise die Bäume ausgerodet haben. Und einfach mal gucken, was da so auf Landschaftsebene passiert, wenn ich so ein so eine Flickenstruktur habe, also so Teppich aus ganz vielen verschiedenen Waldbeständen oder Waldformen würde ich mal sagen. Also, das ist ein Thema, was sehr unterbelichtet ist. Zusätzlich halt die Geschichte jetzt eben, ja was passiert denn, wenn ich ihm Wald Löcher mache mit den Lichtungen? Ist das jetzt bei der Trockenheit überhaupt angesagt? Darf man das überhaupt? Ist das nicht schädlich oder so? Also da gibt es ja auch Buchautoren, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, wo man immer sagen kann so einfach ist es nicht. Und was uns jetzt aus der Praxissicht glaube ich das Wichtige ist, das ist halt die Frage wie mache ich Waldumbau, wie komme ich weg von diesen Fichten-Monokulturen, die uns jetzt alle zusammenbrechen? Wahrscheinlich wird es ja jetzt dieses Jahr auch wiederkommen bei der Trockenheit. Also wie sieht der Wald der Zukunft aus? Was ist ein gutes Maß an Exoten vielleicht? Was kann ich strukturell machen? Vielleicht auch wie stelle ich die Bewirtschaftung um das sie schonender ist und stärker auf die Trockenheit angepasst ist? Dass man im Prinzip heute schon sagen kann - ja Kahlschlag ist ganz schlecht, auch wenn sich manchmal nicht vermeiden lässt, oder? Und trotzdem sieht man im Wald immer noch so Stellen, wo der Boden komplett umgepflügt ist. Wo man denkt, ach ja, Fichte geht ja vielleicht doch noch mal. Es gibt Leute, die so denken, wo man einfach sagen kann das ist ziemlich irre. Das kann man eigentlich sein lassen.
Diringer: Ja jetzt auch, weil wir uns langsam dem Ende der Veranstaltung neigen, die Zeit ist wirklich geflogen noch eine weitere Frage aus dem Publikum.
Gast: Das Stichwort Waldumbau. Da hatte ich eben auch noch einmal die Frage, wie sie das sehen. Sollte man jetzt tatsächlich sagen man greift weiter aktiv ein, und man hat eben Bereiche im Wald, wo man dann auch gezielt diese gebietsfremden Baumarten nach gründlicher Auswahl pflanzt? Oder sollte man sich jetzt gedulden und komplett auf die Naturverjüngung setzen, an manchen Stellen? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr unterschiedlich, wo man sich befindet. Aber es wird ja auch davon ausgegangen, dass naturverjüngte Bäume erst einmal besser an den Standort dann angepasst sind, als welche, die man dann direkt dorthin pflanzt oder?
Dr. Dittrich: Ja, das ist vollkommen klar. Also man kann im, das ist auch glaube ich, Konsens auch in der Forstwirtschaft, dass man sagen kann die Naturverjüngung also das, was die Bäume am Standort selbst aussäen, was von alleine aufwächst, das hat das beste Potenzial, sich zu adaptieren. Und wenn man zum Beispiel, das würde ich jetzt mal am Beispiel der Eiche sagen. Wenn eine Eiche keimt, dann wird sie im ersten Jahr eine Wurzel machen, die mindestens 20 Zentimeter lang ist. Also die kommt schon an ihr Wasser. Und wenn ich jetzt so einen Setzling aus der Baumschule hole, der wird untendrunter abgeschnitten, damit die Wurzeln so ein bisschen kompakter werden, damit ich das Ding verpflanzen kann. Die hat so eine Wurzel halt nicht. Also ist ein ganz, ganz super Argument, dass man sagt Naturverjüngung ist ist das Beste überhaupt. Nun haben wir das Problem, dass man in manchen Waldbeständen die Bäume aber gar nicht hat, die vielleicht zukünftig gut wären. Also ich habe Fichtenbestände, da steht nicht eine Buche drin. Wo soll die Buche denn herkommen? Also, die fliegt halt nicht von außen rein. Also da muss ich dann schon auch nachhelfen. Und bei der Kiefer ist es genauso. Wir haben großflächige Kiefernbestände in der Lausitz, die teilweise auch jetzt braun werden, mit Misteln befallen und mit irgendwelchen Schadinsekten. Und da steht fast kein Laubbaum drin. Was mach ich denn dann? Also die Birke, die fliegt bestimmt von alleine rein, die vertrocknet aber auch. Eichen ist schon ein bisschen komplizierter, da müssten eigentlich Eichen rein, die aber jetzt auch nicht so schnell kommen. Also da müsste man schon auch ein bisschen nachhelfen. Aber natürlich kann man sagen, es gibt auch Schadflächen, wenn man das so nennen möchte, also völlig vertrocknete, zusammengekrachte Waldbestände, wo man auch arbeitsmäßig überhaupt nicht hinterherkommt. Also das sind Kahlflächen über Jahre. Und da muss man eigentlich froh sein, über alles, was von alleine aufwächst. Und das kommt auch. Aber es sind nicht unbedingt die Baumarten, die wir wirtschaftlich nutzen. Also das sind dann oft eben Weiden, die sind sehr schnell da. Birken sind schnell da, die Eberesche im Bergland zum Beispiel. Und da muss man eben sagen, ja gut, wenn man genug Geduld hat, dann dann wird sich dann ein Wald etablieren, der ist eben standortsgerecht. Vor allen Dingen werden es wahrscheinlich einheimische Sachen sein, aber vielleicht jetzt wirtschaftlich nicht ganz so interessant. Also ich würde immer sagen Waldumbau ist grundsätzlich eine gute Sache. Wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, vielleicht auch mit einem kleinen Anteil Exoten das kann, das ist grundsätzlich nie, nie völlig falsch. Aber man muss schon auch aktiv was tun. Und das andere Thema sind ja nicht nur die Bäume, die ich pflanze, es ist ja auch möglicherweise das, was dann eben im Anschluss damit passiert. Das Thema Wild ist sehr wichtig beim Waldumbau. Wenn wir zum Beispiel an die Weißtanne denken, die ist extrem lecker für das Rehwild oder auch für die Hirsche. Und wenn ich jetzt also Weißtanne pflanze und die ist eben auf großer Fläche gar nicht mehr da im Erzgebirge, die muss sich sowieso pflanzen. Die wird immer abgefressen. Und dann muss sich entweder sagen ich muss jetzt Geld ausgeben und muss jetzt wirklich schießen. Na also, das was man jetzt aus Naturschutzsicht auch nicht immer so gerne sieht, sage ich mal, aber was dann vielleicht auch sein muss oder ich muss einen Zaun hinstellen. Aber von ganz alleine wird es in vielen Bereichen leider nicht gehen.
Diringer: Auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort, auch noch einmal zu einer guten Abschlussfrage nämlich wie sollen, können, dürfen, müssen wir eben auch eingreifen? Und ich muss wirklich beim Blick auf die Uhr sagen es ist wahnsinnig schnell vergangen, die etwas mehr als eine Stunde, die wir uns jetzt zu dem Thema ausgetauscht haben. Sie könnten wahrscheinlich noch Stunden, Tage, Wochen, Monate erzählen. Wir haben ja auch gleich mit der Einstiegsfrage gehört, wie viele verschiedene Baumarten es gibt. Also da ist Potenzial da. Und mit dieser Audioaufzeichnung oder auch dieser Veranstaltung hier ist das Ganze nicht beendet. Es gibt weitere Veranstaltungen. Und gerade auch sie, die hier sind, würde ich auch einladen: Falls jetzt noch Fragen offen sind, kommen sie gerne auf uns zu und für alle, die auch zu Hause jetzt vielleicht sitzen oder im Auto oder wo auch immer sie die Audiospur hören. Das Wissenschaftsjahr geht ja weiter. Und auch hier können weitere Fragen eingereicht werden, die dann natürlich beantwortet werden, im Laufe des Jahres. Von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das Publikum, das sie da waren. Auch vielen Dank an ihre spannenden Fragen. Danke auch an unseren Gast. Und genau damit würde ich sagen beenden wir das Ganze erst einmal mit Hinblick auf die Offenheit, jetzt auch noch die Natur an diesem Nachmittag zu genießen. Vielen Dank.
Dr. Dittrich: Oh ja. Dankeschön!
Wie theoretische Physik hilft Mobilität zu verstehen - Dr. Malte Schröder
Vom Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in den botanischen Garten – Mobilität ist ein essentieller Teil unseres täglichen Lebens. Dr. Malte Schröder vom Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed) erklärt, wieso Physiker sich mit Mobilität beschäftigen und wie theoretische Physik helfen kann, neue Formen der Mobilität zu beschreiben, zu verstehen und zu verbessern.
Einleitung: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Veranstaltung "Triff die Koryphäe unter der Konifere". Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen -zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Moderatorin, Lilith Diringer: Ja vielen Dank für die einführenden Worte und auch noch einmal ein Herzlich Willkommen von mir. Ich bin Lillith Diringer und noch selbst Studentin an der TU Dresden. Ich habe mich sehr gefreut, bereits letztes Jahr diese Veranstaltung mit moderieren zu dürfen und bin auch wieder sehr gespannt, was dieses Jahr alles auf uns wartet. Heute mit dem ersten Thema 2022. Jetzt ganz kurz zum Organisatorischen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet für die Einführung, damit Sie auch wissen, wer hier vor Ihnen sitzt und über was wir reden. Dann möchten wir aber sehr schnell auch in den interaktiven Teil übergehen. Das heißt, Sie können jederzeit Fragen stellen.
Wir wollen inhaltlich starten, Dr. Malte Schröder sitzt hier vor mir. Sie haben selbst 2018 in der Physik am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen promoviert und sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Netzwerk Dynamik, des Instituts für Theoretische Physik in Dresden. Seit 2019 leiten Sie dort die Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls im Bereich kollektive Dynamik nachhaltiger Mobilität. Jetzt habe ich schon verraten, Sie sind theoretischer Physiker, und da zwingt sich mir die Frage auf: Mobilität? Ich würde vielleicht erst an die Verkehrswissenschaften denken, die ja in Dresden auch recht groß sind oder vielleicht noch an die Umweltwissenschaften bei nachhaltigen Mobilität. Aber wie kommt es dazu, dass sich Physikerinnen und Physiker auch mit Mobilität auseinandersetzen?
Dr. Malte Schröder: Der Ansatz dahinter ist, dass man in der Physik ganz oft ganz viele komplexe Systeme beschreiben möchte und dass ganz viele von den Methoden, die man dabei verwendet, auf so allgemeinen Prinzipien basieren, dass man sie auf ganz viele Systeme übertragen kann. Die Idee dahinter, vor allen Dingen bei dieser Art von komplexen System, bedeutet in der Physik eine halbwegs spezielle Bedeutung, dass Systeme viele Teilchen haben, ganz viele Teilchen, die miteinander interagieren. Und dass aus diesen Interaktion, von den ganz vielen Teilchen, emergente Phänomene oder kollektive Dynamiken entstehen, die man, wenn man nur ein oder zwei Teilchen anschaut, nicht vorhersagen würde oder nicht vorhersagen kann. Im Bereich der Physik kennt man das aus der Thermodynamik oder der statistischen Physik. Wenn man Gas um uns herum beschreiben möchte. Dann habe ich sehr, sehr viele Gasteilchen, die alle miteinander wechselwirken. Die Wechselwirkungen kenne ich prinzipiell aus der Quantenmechanik, aus der Elektrodynamik. Und trotzdem kann ich das nicht ganz einfach beschreiben, weil es dann einfach zu viele Teilchen sind. Wenn ich aber Druck, Volumen und Temperatur verwende, kann ich mit einer einfacheren Beschreibung verstehen, wie sich das Gas verhält, wie zum Beispiel der Gas-Flüssig-Übergang, Phasenübergänge und andere Phänomene funktionieren.
Im Bereich der Mobilität ist das im Prinzip genauso. Wir haben nicht viele Teilchen, sondern viele Menschen, die sich bewegen, viele Autofahrer oder viele Autos. Und die interagieren alle miteinander auf relativ einfache Weise, wenn Sie Autofahren achten Sie auf das Auto vor ihnen und fahren langsamer wenn das Auto bremst. Oder bisschen schneller, wenn Platz ist. Und daraus entstehen eben auch kollektive Phänomene. Die man mit ähnlichen Methoden beschreiben kann.
Diringer: Auf jeden Fall schon mal eine gute Erklärung, warum wir mit Physik und vielleicht kleinen Teilchen auch so ein bisschen unsere Welt, die wir jeden Tag sehen, auch besser verstehen können. Jetzt zudem, was Sie erforschen und was sicher auch Sie interessiert oder Sie alltäglich mitbekommen. Gerade in Dresden in der Innenstadt kenne ich keinen Tag ohne Stau, auch wenn ich es jetzt als Fahrradfahrerin, vielleicht mit dem vielen Autoverkehr hinbekomme. Haben Sie eine Erklärung: Warum bekommen wir die Innenstädte nicht staufrei?
Dr. Schröder: Genau das ist ein sehr schönes Beispiel für diese sehr schön grundlegenden Mechaniken, die man verstehen kann. Stau kann man im Prinzip als zwei Phänomene sehen: Einmal ist es natürlich zu viel Verkehr, deswegen bin ich zu langsam. Und was da passiert, ist eigentlich relativ einfach zu verstehen: Die Idee ist, dass wenn ganz viele Autos auf der Straße sind, dann sind die Autos näher aneinander. Ich habe also weniger Abstand zum Vordermann, muss langsamer fahren, damit ich entsprechend bremsen kann, falls etwas passiert. Dadurch wird also, ab einer bestimmten Verkehrsdichte, also, wenn zu viele Autos auf der Straße sind, der Verkehr langsamer. Also mehr Leute - langsamerer Verkehr. Und dadurch sind Leute auch länger auf der Straße, brauchen länger, und es wird noch langsamer. Diese Feedback-Effekte sorgen im Prinzip dafür, dass dieser Stau auch eben dableibt und sich nicht von alleine auflöst.
Deses grundlegende Prinzip von mehr Leute im System führt zu langsamerer Abarbeitung. Das, was dem Stau zu Grunde liegt, lässt sich eben auch auf viele andere Systeme übertragen, im Bereich der Mobilität, aber auch in anderen Systemen. Das ist ein Beispiel von einem schönen Mechanismus, den man mit einfachen Modellen, mit abstrakten Betrachtungen aus der theoretischen Physik effektiv verstehen und dann auf viele Beispiele anwenden kann. Aus einer anderen Perspektive ist Stau vielleicht gar nicht so sehr: es ist langsam- sondern nur es sind so viele Autos da. Es ist ganz voll.
Was man da anschauen kann, um nochmal auf diese Idee zurückzukommen von: Ich habe die einzelnen Interaktionen aus der Physik, aus den physikalischen Bereichen im Verkehr oder im sozioökonomischen System, der Interaktion von Menschen, muss ich diese einzelnen Interaktionen natürlich nicht aus der Physik kennen, sondern aus den Verkehrswissenschaften, aus der Psychologie oder aus der Ökonomie, wie Menschen sich miteinander verhalten. Und da gibt es schöne Beispiele aus der der Spieltheorie, die in dem Fall mit einem schönen Zitat zusammengefasst werden können. Das hat der amerikanische, glaube ich, Baseball Coach Yogi Berra gesagt, der für seine Zitate bekannt ist. Es handelt von einem Restaurant: "Nobody goes there anymore, it`s too crowded". Also: Niemand geht mehr hin, es ist zu voll. Das macht jetzt im Prinzip erst einmal keinen Sinn, wenn man sich das überdenkt. Wenn keiner hingeht, ist es ja nicht voll. Aber das ist wie die Veranstaltung hier, effektiv können Sie sich überlegen, wenn alle Leute kommen, dann ist es voll. Sie kriegen vielleicht nichts mit, weil sie zu weit weg sitzen, keinen Sitzplatz mehr bekommen, Sie werden Ihre Frage nicht los - dann gehen sie vielleicht lieber nicht hin. Wenn das alle denken, dann geht keiner hin. Und Sie verpassen hoffentlich schöne Erklärungen zur theoretischen Physik und Mobilität.
Und das ist im Straßenverkehr effektiv genauso. Solange Platz ist, denken Leute, dann kann ich Auto fahren. Dann komme ich ja schnell voran. Wenn man eine Straße mehr baut, also eine Spur mehr auf Autobahnen baut, wie das amerikanische System mit sechsspurigen Autobahn, wundert man sich warum ist immer noch Stau? Dann liegt es einfach daran: Jetzt ist Platz, dann bin ich im Auto schnell und es fahren also mehr Leute Auto. Und durch diese Feedback- oder in dem Fall Rebound-Effekte kann man eben selbst, wenn man Leute vom Auto fahren wegnimmt, dafür sorgen, dass zwar zehn Leute aufhören, aber doch acht wieder anfangen, Auto zu fahren. Dadurch ist es sehr schwer, Leute von der Straße wegzukriegen, ohne diese Push-Faktoren zu haben, also Leute von der Straße wegzudrücken. Aber auch Pull-Faktoren, die eben sagen: Hier sind andere Alternativen. Und es macht Sinn, anderen Wegen zu gehen.
Diringer: Auf jeden Fall auch, wie sie jetzt schon gesagt haben ein interdisziplinäres Thema. Und glaube ich auch wichtig für uns alle und auch unseren Alltag. Und wir hatten uns auch im Voraus schon mal zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, was denn eines der brennenden Aspekte ist und sind da auch auf Ridepooling und selbstfahrende Mobilität, selbst fahrende Robotaxis, gestoßen. Ist das denn die Lösung? Also können wir damit dem Privat-Pkw ersetzen oder zumindest, wie sie gerade schon genannt haben, den Stau vielleicht verhindern, vielleicht weniger Menschen auf die Straße in Privat-Pkws zusenden?
Dr. Schröder: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und im Prinzip dieses Ridepooling, vielleicht noch einmal für alle Leute, die nicht genau wissen, was das sein soll. Die Idee ist im Prinzip bedarfsgesteuerte geteilte Mobilität, also man bucht mit einer App oder per Telefon, mittlerweile mit einer App, eine Fahrt, wird abgeholt wie bei einem Taxi und abgesetzt. Aber unterwegs werden eben andere Leute mitgenommen, deren Fahrt in dieselbe Richtung geht oder entlang derselben Route liegt. Das ist auch eine unserer Hauptforschungen und Aspekte in der Arbeitsgruppe.
Ob das eine ganz allgemeine Lösung ist? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Im Prinzip haben solche Systeme den Vorteil, dass, wenn viele Leute sie nutzen, sie natürlich auch viel besser funktionieren. Also die Idee ist, wenn ich ein System anbiete, erst mal im Kleinen mit vielleicht fünf Fahrzeugen, dann habe ich eine Anfrage, sammele die Person auf und fahre durch die Gegend. Bei der nächsten Anfrage, die kommt, ist vielleicht ein Fahrzeug weit weg oder sie liegt nicht auf der Route. Wenn ich aber 500 Fahrzeuge habe und ganz viele Anfragen, dann kann ich natürlich sehr viel einfacher Fahrzeuge, Routen und Anfragen zusammenlegen. Und ich habe auch viel weniger Umwege für die einzelnen Leute, kann den Service viel billiger anbieten oder er wird auch viel mehr von den Leuten angenommen. In diesem Sinne kann also so ein Angebot durchaus attraktiv und auch ähnlich effizient sein. Individuelle Mobilität hat aber natürlich gleichzeitig den Effekt, dass man damit unter Umständen öffentlichen Nahverkehr wie Straßenbahn oder Busse in dem Sinne kannibalisiert. Weil, wenn die Leute, die diese Systeme nutzen würden, vielleicht dann das genauso billige oder günstige, aber bequemere Verkehrsmittel von der geteilten Mobilität nutzen.
Diringer: Kann ich das auch so verstehen, dass eigentlich dieses Carpooling dann schon effektiv ist, dass man die Autos voller bekommt und nicht immer ein Pkw pro Fahrer. Aber dass auch der Anfang sehr schwer ist es, wenn ich eben sage: Naja, wir machen mal ein Pilotprojekt mit zehn Autos für ganz Dresden. Das es dann eben gar nicht so gut funktionieren könnte?
Dr. Schröder: Genau das ist die Idee von diesem Carpooling: Ich kriege die Autos voller, sie werden benutzt und stehen nicht 23 Stunden am Tag rum. Aber man braucht eine gewisse kritische Masse oder muss eben entsprechend durch Angebote, Subventionierung oder durch entsprechende Organisation von dem Angebot - das man eben die Umwege nicht zu groß werden lässt und das den Kunden garantiert - dafür sorgen, dass das Angebot auch nutzbar bleibt und genutzt wird. Wie man von dem einen Punkt zu dem anderen kommt, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und auch aus der theoretischen Physik her gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist natürlich sehr einfach zu sagen - oder relativ einfach- zu sagen, wir haben gegebene Umstände: so viele Leute würden das System nutzen, so viele Fahrzeuge haben wir, das kommt raus, so lange braucht man im Mittel bis man an seinem Ziel ist, zu so einem Preis kann man das anbieten. Wenn man natürlich das jetzt über die Zeit hinweg verändern möchte, kommen vielmehr Interaktionen rein, wo man sich fragen muss: Wann nutzen denn Menschen das System? Wie lange dauert es, um das aufzubauen? Wie lange dauert es, bis Menschen eben umsteigen, vielleicht von ihrem Auto? Wenn man gerade eines gekauft hat, dann verkauft man es nicht wieder sofort, sondern erst in fünf oder zehn Jahren, vielleicht, wenn es kaputt ist. Und da werden eben diese komplexen Systeme, die Interaktionen und Feedback Loops nicht nur in einem Bereich, sondern über mehrere Bereiche, von der Nutzung für mehrere Verkehrsmittel und so weiter. Und das Ganze wird noch viel komplexer, als es eigentlich eh schon ist.
Diringer: Und diese Systeme bilden sie dann in der theoretischen Physik auch mit ab?
Dr. Schröder: Genau. Ich versuche immer in der theoretischen Physik auch möglichst abstrakte, einfache Beschreibungen von diesem System zu schaffen, damit man Mechanismen verstehen kann. Als ganz einfaches Beispiel kann man sich das wie folgt vorstellen: wir malen Strichmännchen. Sie sehen, das ist ein Mensch. Da ist alles dran, was sie im Prinzip brauchen, um das zu erkennen. Sie können aber nicht erkennen, wer das sein soll. Im Gegensatz dazu stehen Fallstudien der Verkehrswissenschaften, die viel detaillierter sind, die alle Aspekte betrachten. Das können Sie sich als Porträt vorstellen: effektiv, sehr detailliert. Und sie können genau erkennen, wer es sein soll, wie es für die Stadt funktioniert. Aber es ist nicht so einfach zu erkennen, was daran jetzt die wichtigen Aspekte sind, die man zum Beispiel auf andere Städte übertragen kann. Das ist die Idee, dass wir eben diese Art Puzzleteile versuchen zu erstellen, dieses Verständnis, auf dem man aufbauen kann, dann zwischen verschiedenen Städten oder Mobilitätsformen übertragen kann.
Diringer: Also dann auch eine Abstraktion hin zu den Aspekten, die wichtig sind für die Modelle und was sie brauchen?
Dr. Schröder: Genau. Also die Idee ist, wir nehmen eigentlich so viel weg, bis wir irgendetwas kaputtmachen, bis wir irgendetwas nicht mehr haben, was wir als Effekt gerne haben wollen oder was man in der Realität beobachtet. Und dann wissen wir, dass wir zu viel weggenommen haben, dass irgendetwas, also ein spezieller Bestandteil wichtig war für das System, für die kollektive Dynamik vom System. Und dadurch können wir halbwegs gut verstehen, wo die kollektive Dynamik am Ende herkommt, aus welchen einzelnen Interaktionen.
Diringer: Ok vielen Dank für die diese Erläuterung. Ich gucke schon mal in die Runde, gibt es Nachfragen zu den bisher besprochenen Themen oder Dinge, die nicht verstanden wurden oder die besonders interessant für sie sind?
Gast: Mich würde interessieren, ob Sie mit diesen Modellen beziehungsweise Systemen Aussagen darüber treffen können, ab welcher kritischen Masse solche Neuerungen eingeführt beziehungsweise erfolgreich eingeführt werden können.
Dr. Schröder: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Weil natürlich wichtig ist, wie groß müssen solche Pilotprojekt zum Beispiel sein, damit das Sinn macht. Eine grundsätzliche Idee, die wir haben, ist auch dieser Versuch zum Beispiel wieder im Ride-Pooling. Nicht die einzelnen Fahrzeuge im Detail zu beschreiben. Nicht zu fragen, da ist das Fahrzeug genau, sondern wie in der Thermodynamik, wie bei den Gasen zu sagen: Kann ich irgendwelche Größen definieren, wie Druck, wie Volumen, wie das System; ein bisschen großskaliger/grobskaliger beschreiben. Und da kann man zum Beispiel durch Ideen, wie Dimension Analyse also der Vergleich von Zeitskalen, die im System sind. Wie lange braucht eine Person, um ans Ziel gebracht zu werden, wie viel, Zeit vergeht zwischen zwei Anfragen. Und dann kann ich vergleichen wie viel Zeit habe ich im System, wie viel Zeit wird vom System abgefragt, also effektiv kommt dann raus: Wie viele Fahrten muss ich zusammenlegen, um überhaupt alles bedienen zu können oder nicht. Und daraus kann man grob abschätzen, ab welcher Anfragerate oder welcher Fahrzeugzahl das Sinn macht.
Also genau das ist eben noch ein noch ein zweiter Aspekt, der nicht aus dem Verhältnis besteht, sondern aus der Skala insgesamt. Es gibt tatsächlich zwei Arten von diesen geteilten Mobilitätsangeboten: einmal ist es wirklich dieser Versuch, urbane Mobilität zu ersetzen, also die Autos in der Stadt, weil man eben gut Fahrten teilen kann. Der andere Ansatz ist, auf dem Land den Nahverkehr zu ersetzen, weil er natürlich in den meisten Fällen entweder nur einmal oder zweimal pro Tag ein Bus fährt oder die Busse dann tatsächlich auch, einfach leer sind, weil sie nicht benutzt werden.
Es sind also zwei verschiedene Aspekte, wo man unter Umständen eben auch darauf schauen muss: Wann macht geteilte Mobilität mit welcher Angebotsstruktur Sinn? Wann mache ich in der Stadt vielleicht auch lieber Linien und Zubringer zu diesen Linien - ab einer bestimmten Dichte oder Nachfragezahl? Oder auch wann kristallisieren sich solche Linien auch automatisch selbstständig in diesem System heraus? Echte Zahlen kann ich Ihnen aber leider dazu nicht sagen. Das ist im Prinzip doch wieder diese Frage von wir malen das Strichmännchen, wir können eben diesen Vergleich machen und sagen, wenn die Stadt doppelt so groß ist, ist es doppelt so einfach, so ungefähr. Aber es hängt natürlich davon ab, was genau das Ziel ist, wie viele Menschen das auch in der Stadt annehmen.
Diringer: Ja, vielen Dank schon mal für die Nachfrage. Gibt es noch weitere Rückfragen?
Gast: Ich weiß nicht, ob es schon genannt wurde. Welche Theorien finden konkrete Anwendung für die Modellierung? Wenn das nicht zu detailliert ist.
Dr. Schröder: Nein, das ist nicht. Ich hoffe, ich kann das halbwegs erklären. Ich habe es glaube ich am Anfang kurz gesagt. Die Idee ist, dass komplexe Systeme, also Systeme mit vielen Teilchen und Interaktion, die insbesondere aus der aus der statistischen Physik und Thermodynamik- der Beschreibung von Gasen im Prinzip- in der Physik zuerst Anwendung finden und dann eben auf sozioökonomische oder andere Systeme übertragen werden können, wo ich auch viele Teilchen mit vielen Interaktionen habe. In dem Fall muss ich mir aber die Interaktionen aus der Ökonomie, aus der Spieltheorie oder aus der Verkehrswissenschaften suchen, wo ich eben aus Umfragen weiß, wie Menschen, welche Verkehrsmittel nutzen oder wie Menschen miteinander interagieren und Entscheidungen treffen. Also da kommen im Prinzip Aspekte aus der Verkehrswissenschaft, aus der Ökonomie oder Psychologie mit den Methoden von der Physik zusammen, um die Systeme zu verstehen.
Diringer: Also tatsächlich ein sehr interdisziplinäres Feld in jedem Fall.
Dr. Schröder: Ja
Diringer: Gut zur nächsten Frage.
Gast: Vielleicht direkt daran anschließend. Die Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen, also wie macht ihr das? Nehmt ihr deren Daten oder wie wird das gefüttert?
Dr. Schröder: Also ganz viel von den Modellen basiert eben zum Beispiel auf so etwas wie Umfragen, die von Verkehrswissenschaftler durchgeführt werden. Auf die Fragen hin: Wann würde man so ein geteiltes Mobilitätsangebot nutzen? Also wie billig darf das sein, wie teuer darf das sein? Wieviel Umweg darf dabei sein, wie schwierig darf es sein, das zum Beispiel zu buchen? Wir nehmen daraus aber seltener konkrete Zahlen, um echte Vorhersagen zu machen, sondern vielmehr versuchen wir daraus abzulesen, Was sind die wichtigen Aspekte, um unser Modell zu vereinfachen und genau die drin zulassen. Also im Fall von geteilter Mobilität sind es zum Beispiel die Fragen: Wie teuer ist das Angebot? Was ist der Umweg, den man in Kauf nimmt? Und wie bequem ist es, wenn ich zum Beispiel ganz lange mit anderen Menschen in einem Auto sitze, wenn das voll ist?
Ansonsten ist natürlich die die Interaktion mit anderen Feldern immer nicht so einfach, weil man ganz oft eine andere Sprache spricht. Also sehr viel von den Fallstudien in den Verkehrswissenschaften finde ich auch persönlich immer noch schwer zu lesen, weil mir am Ende diese Aussage fehlt –W as habe ich verstanden? Wobei natürlich da das Ziel ist, die Aussage zu machen: Das ist ein Vorschlag, so sollte man das in der Stadt umsetzen oder hier ist die Methode, um das in anderen Städten auch so anzuwenden. Und ich glaube, umgekehrt ist es natürlich genauso, Paper die wir schreiben und veröffentlichen, teilweise in Physikjournalen, teilweise in interdisziplinären Journalen. Da ist dann natürlich für Verkehrswissenschaft oder angewandte Wissenschaftler die Frage, was habe ich denn jetzt davon? Ihr habt mir ja gar nicht gesagt, was ich jetzt in der Stadt machen soll. Aber es gibt auf beiden Seiten auf jeden Fall interessierte Leute und Kooperation ist schwierig. Aber natürlich versucht man es. Wir reden mit vielen Leuten und versuchen einen gemeinsamen einen Überlapp zu finden. Welche Fragen kann man beantworten? Was kann man daraus lernen? Welche Methoden kann man sinnvoll anwenden? Und natürlich versuchen wir auch dann zu fragen, was für Fragen haben die Verkehrswissenschaftler eigentlich? Und wie können wir da vielleicht von unserer Seite aus helfen und dazu beitragen.
Diringer: Auf jeden Fall auch verschiedene Blickwinkel, die da auf das Thema gerichtet werden, um eben dann die gemeinsame Lösung zu finden. Ich denke, das ist genau der Ansatz, wie sie gerade meinten, dass man in den Dialog tritt und findet wo sind die Schnittstellen dieser verschiedenen Sprachen. Gibt es gerade noch weitere Fragen?
Gast: Wie sieht es denn jetzt mit der Anwendung in der Praxis aus? Ist schon mal was erprobt worden im kleinen oder großen, in einer Stadt, in einem ländlichen Gebiet?
Dr. Schröder: Von uns hier, vom Lehrstuhl für Netzwerkdynamik an der TU Dresden, noch nicht. Aber in Göttingen: ich war nicht beteiligt, aber Marc Timme der Lehrstuhlinhaber war an einem Ecobus Projekt beteiligt. Also die Idee war, geteilte Mobilität im ländlichen Raum umzusetzen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu ergänzen. Es wurde im Harz getestet, aber eben auch in dem kleinen Raum mit, ich glaube, bis maximal zehn Bussen. Es gibt natürlich viele von diesen Angeboten, also Uber und Lyft, die man aus Amerika kennt, die natürlich ganz viel Ride-Hailing machen, also im Prinzip Taxi Service anbieten. Aber auch teilweise gezwungen, weil Städte das fordern, mittlerweile, weil die Politik das fordert, teilweise aber auch weil es sich idealerweise lohnt, wenn man eben gut Poolen kann, auch solche Angebote machen. Oder für Deutschland sind große Beispiele in Hamburg MOIA von VW als Sammeltaxi oder in Berlin, der Bergkönig in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben da.
Diringer: Also existieren schon ein paar Beispiele im In- und Ausland?
Dr. Schröder: Es gibt einige Beispiele. Das geht jetzt natürlich viel mehr in Richtung der Anwendung. Viele von den Beispielen gehen aktuell auch sehr in die Kooperation mit den öffentlichen Verkehrsbetrieben, weil es natürlich politisch einerseits gewollt ist, dass man diese Angebote ergänzt und entsprechend fördert und nicht kannibalisiert oder miteinander konkurriert. Und weil es auch eben aufgrund dieser Skaleneffekte dieser Größen - ich muss einfach viel Größe haben, damit es sich lohnt - oft nicht einfach ist, diese Angebote sinnvoll und ökonomisch anzubieten, dass man damit auch tatsächlich Geld als Unternehmen verdient. Deswegen ist die Zusammenarbeit oft wichtig und kann auch in vielen Bereichen als Zubringer helfen.
Da gibt es eine Studie aus Amerika, die das zum Beispiel insbesondere für Uber versucht hat nachzuvollziehen, mit einem was wäre, wenn es dieses Angebot nicht gäbe - wie würde dann der Verkehr aussehen? Sie kommen einerseits dazu, dass es weniger Verkehr gäbe.
Also die Idee dahinter ist: es natürlich viel einfacher zu fahren, wenn ich nur auf den Knopf in der App klicken muss. Also mache ich das viel öfter. Dadurch sind tatsächlich mehr Autos auf den Straßen als weniger, wie teilweise versprochen. Man hat auch ein paar Effekte: teilweise fahren eben weniger Leute Bus, andererseits wird dadurch aber der Bahnverkehr, weil ich einfacher zum Bahnhof komme, auch mit Gepäck zum Beispiel. Also gibt es verschiedene positive und negative Effekte, die man da immer abwägen muss. In vielen Fällen muss man dann tatsächlich wieder auf die einzelnen Städte und auf diese Porträts genau gucken. Aber die grundlegenden Ideen, welche Interaktionen es gibt, da können wir hoffentlich doch helfen, die auch zu verstehen, warum mehr Leute dieses Angebot nutzen.
Diringer: Also auch hier wieder sehr komplexe Systeme, die dann Folgen haben, wie sie auch schon erwähnt haben: Rebound-Effekte und so weiter, mit denen man vielleicht am Anfang gar nicht rechnet. Gibt es aktuell weitere Fragen?
Gast: Also sie hatten ja jetzt schon sehr viele Faktoren genannt. Gab es denn irgendeine Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren, die sie irgendwie überrascht hat, wo man so dachte: ja, daran hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht?
Dr. Schröder: In vielen Fällen sind wir auch erst zufrieden, wenn wir das System so vereinfacht haben, dass man am Ende natürlich sagt: ja, das war doch klar, das musste ja so sein. Das ist im Nachhinein immer viel einfacher oder dann, wenn man es erklärt. Eine Sache, die da eigentlich sehr, sehr spannend ist, die wir in einem Modell von der Akzeptanz für diese für diese Angebote bemerkt haben, ist, dass es tatsächlich passieren kann, dass sich das System nur in einem Bereich der Stadt genutzt wird, in einem anderen nicht.
Die Idee zum Beispiel ist: Man kann annehmen alle Leute, die am Flughafen ankommen, von einem Ort wegfahren wollen, haben die Möglichkeit, entweder eine geteilte Fahrt zu nehmen, also zu buchen oder ein Taxi zu nehmen, effektiv eine einzelne Fahrt. Ich will die geteilte Fahrt buchen, weil das billiger ist. Aber ich habe unter Umständen Umwege dabei, wenn ich jetzt zwei Leute habe, die in verschiedene Richtungen fahren wollen und die eine Person sagt, ich buche eine geteilte Fahrt, die anderen Person sagt ich auch, dann hat die eine Person einen großen Umweg. Nächstes Mal macht die Person das nicht mehr, und dann teilen sich die Leute ihre Fahrten in eine Richtung, weil wenn ich da teile, ist mein Umweg relativ gering, weil ich immer mit Leuten zusammengebracht werde, die in dieselbe Richtung fahren. In die andere Richtung der Stadt wird es eben nicht genutzt, weil unter Umständen der Umweg zu groß wäre. Andererseits kann folgendes in dem gleichen System passieren: Wenn alle Leute schon von vorneherein geteilte Fahrten buchen, dann werde ich natürlich, wenn ich zum Beispiel nach Süden will, eben auch nicht mit jemandem anderen zusammengepackt, sondern es gibt ja, wenn es genug Anfragen gibt, auch wenige Umwege. Und dann ist auch der Zustand tatsächlich stabil. Und ich habe eben die Frage: Komme ich da überhaupt hin, dass alle dieses System nutzen oder bleibe ich in dem Zustand, wo es vielleicht nur in einem Teil genutzt wird und dann gar nicht so effizient ist, wie es vielleicht sein könnte?
Diringer: Auch sehr interessant. Wie schaffe ich es dann eigentlich auch das auf Region auszuweiten oder eben Menschen, die am Anfang oder einmal vielleicht auch negative Erfahrungen hatten, auch wieder davon zu überzeugen, eine positive Erfahrung einzugehen oder sich darauf einzulassen? Gibt es weitere Rückfragen?
Gast: Ja, vielleicht eher ein Statement. Spannend wird es ja vor allem dann, wenn man Aussagen dazu treffen kann. Oder wenn die theoretischen Aussagen dazu erzeugt werden können, welche Erfolgsfaktoren jetzt notwendig sind, um bestimmte Systeme gut einführen zu können oder dann gut zu etablieren, denke ich mal.
Dr. Schröder: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, herauszufinden, unter welchen Bedingungen kann das überhaupt funktionieren? Das ist einerseits natürlich auch Teil unserer Forschung in dem Bereich von: Wie können wir das wirklich einfach darstellen? Welche Variabel muss ich mir eben anschauen?
Zum Beispiel kann ich je nach System, je nach Stadtgröße oder Größe vom System und den Anfragen nicht so klar erkennen, ob das System sich lohnt, ob es sich vor allen Dingen auch ökologisch lohnt. Also ich mache es ja meistens, damit ich eben Strecke spare oder wenn also weniger Strecke insgesamt gefahren wird, um dieselbe Anzahl Menschen zu befördern.
Oft wird dafür und auch im Gesetz eben festgelegt: Das sollte ich anhand der Besetzungszahl von den Fahrzeugen messen. Macht grundsätzlich Sinn zum Beispiel, wenn doppelt so viele Leute im Auto sitzen statt eine Person. Wenn ich aber Umwege fahre und dann doppelt so lange fahre, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Und das hängt eben wieder von der Größe, von der Stadt ab und wie effizient ich poolen kann. Man kann durch diesen Vergleich von den Skalen – also von wieviel muss ich eigentlich zusammenlegen - tatsächlich sehr genau vorhersagen. Ab einem bestimmten Punkt, wenn eben die Load oder die effektive Anfragerate des Systems eins überschreiten, muss ich Anfragen poolen. Ab dem Punkt ist es tatsächlich auch sinnvoll, und das System wird nachhaltig im Sinne von: erspart auch also die Strecke. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo man eben sagen kann: Mit diesen einfachen Darstellungen kann man sinnvolle Messgrößen definieren, um eben festzulegen, wann das Sinn macht und wonach ich auch vielleicht diese Qualität von dem Service abfragen oder evaluieren sollte.
Diringer: Weiß man schon, welche Zielgruppen in etwa sich anbieten würden oder in Frage kommen? Für einerseits das Angebot und andererseits die Nachfrage
Dr. Schröder: Für die geteilte Mobilität / Für diese Angebote hätte man gern idealerweise natürlich gern Leute, die vom selbst Auto fahren, umsteigen. Viel, was man dann natürlich sieht ist, dass Leute auch vom öffentlichen Nahverkehr umsteigen und dann sagen ich bezahle ja nur ein bisschen mehr, aber es ist tatsächlich viel bequemer. Teilweise steigen auch Leute vom Fahrradfahren um, also es ist effektiv immer die Sache, dass man natürlich am einfachsten Leute zum Umsteigen bewegt, die schon ähnliche Verkehrsmittel nutzen. Und man zum Beispiel, wenn man Leute vom Auto fahren zum Umsteigen bewegen will, man insbesondere darauf achten muss, dass das eben genau so bequem, genauso flexibel und genauso effizient ist und ich mit möglichst wenigen Umwegen ankomme. Während wenn das System viele Umwege hat, die Leute das eher weniger nutzen würden. Aber Leute die zum Beispiel sowieso Busfahren, die sagen okay, Umwege und Warten bin ich gewohnt, aber es ist trotzdem sinnvoll und bequemer, das System zu nutzen.
Diringer: Auch ein interessanter Ansatz, dass man je nachdem welche Zielgruppe ansprechen möchte oder gewinnen möchte, sein System dann ein bisschen verändert oder auf etwas Anderes optimiert auf jeden Fall. Vielleicht auch noch mal die Rückfrage im Hinblick auf öffentlichen Nahverkehr. Es kam jetzt immer mal wieder so ein bisschen zum Anklang, vielleicht in Kombination, vielleicht teilweise als Ersatz oder als Konkurrenz. Wie ist denn der Stand so? Ich sage jetzt mal ausklammern vom Carpooling, vielleicht gerade in Innenstädten, wo öffentlicher Nahverkehr schon sehr viel existiert, gibt es da Ansätze, was man verbessern muss, was man verändern muss, um trotzdem die Pkw-Fahrenden zu reduzieren?
Dr. Schröder: Das ist tatsächlich ein Aspekt zudem kann ich nicht viel sagen. Ich glaube ein Beispiel ist ja immer Dresden: Die Stadt macht das ja schon mit dem Nahverkehr eigentlich sehr gut. So kommen also die meisten Linien alle fünf bis 15 Minuten. Man kommt überall hin. Und trotzdem haben sie ja am Anfang gesagt es ist trotzdem immer Stau und nicht so einfach.
Was man da machen muss oder kann, dass weiß ich leider auch nicht. Ich hoffe also, dass das in den nächsten drei Monaten, das 9-Euro-Ticket, was kommen soll, vielleicht mal ein sehr schönes Experiment zumindest ist, ob so etwas überhaupt funktionieren könnte unter Umständen. Aber das muss man natürlich abwarten.
Diringer: Also wir hatten ja eben auch aus dem Wissenschaftsjahr die Frage, ob man das Auto mit ÖPNV ohne Schnelligkeitsverlust ersetzen kann. Da jetzt auch eben vielleicht aus Dresden schon das Beispiel: es gibt ja viele Bahnlinien mit vielen kurzen Abfolgen, kurzen Zeiten.
Dr. Schröder: Also in der in der Flexibilität wird es wahrscheinlich mit dem Linienverkehr nicht gehen, weil ich natürlich nicht jede Strecke mit einer Linie abbilden kann. Also in den meisten Fällen oder oft genug, will ich wahrscheinlich irgendwohin, wo ich einmal umsteigen muss. Für solche Fälle kann entweder als Anbindung oder auch als Direktfahrten, wenn die Verbindung eben nicht gut ist, diese Kombination mit geteilter Mobilität sinnvoll sein. Inwiefern das funktioniert, untersuchen wir gerade zum Beispiel: Würden Menschen entlang von diesen existierenden Linien das System auch noch nutzen oder in welchem Bereich, sie es eben nicht nutzen würden und ab welcher Dichte von Linien solch ein System als Zubringer oder als Alternative für Fahrten, die nicht abgedeckt sind, noch Sinn macht und ab wann das vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll ist, weil ich das meiste doch mit Linien abdecke und dann vielleicht eher das System ausbauen sollte.
Diringer: Okay vielen Dank auch dazu. Vielleicht noch mal ein Blick in die Runde: Gibt es Rückfragen, egal ob zu Carpooling, ÖPNV oder gern auch Meinungen? Was haben Sie noch für Bedürfnisse? Welchen Bedarf haben Sie, wenn Sie mobil sein möchten?
Gast: Man hat ja in der Vergangenheit viel dafür getan, um den Autoverkehr zu reduzieren, es den Autofahrern, auch schwerer zu machen, also weniger Parkplätze in Städten anzubieten und so weiter. Sollte man das dann nicht eigentlich genau umgekehrt machen, damit hier also auch diese Fahrer, die das Car-Pooling machen - das sind ja auch Autofahrer – parken können? Also dass man mehr Parkplätze hat, wo man zum Beispiel zusteigen kann mit Kinderwagen, großen Einkauf und so weiter?
Dr. Schröder: Das kommt tatsächlich wieder auf die Umsetzung von diesen Angeboten an. Das Carpooling wirklich als Privatperson machen, gab es auch mal von Uber. Also es war im Prinzip ursprünglich mal die Idee, dass Uber effektiv genau das anbietet für Privatpersonen, also als Vermittler für diese Fahrten effektiv. Mittlerweile sind die meisten Angebote eben doch dedizierte Fahrer, die genau das machen, effektiv wie die Taxifahrer. Da ist natürlich auch wichtig, wo und wie ich zu steigen kann. Da ist aber natürlich die Frage, ob Parkplätze in der Stadt oder Parkplätze in dem Fall helfen. Dann habe ich natürlich effektiv irgendwann dasselbe System wie bei Bushaltestellen, wo ich an bestimmten Orten zu steigen kann und verliere effektiv vielleicht auch wieder die Flexibilität von dem System, die ich ja gerne hätte, dass es mich von Haustür zu Haustür bringt.
Was man auf jeden Fall immer braucht, ist diese Push- und Pull-Faktoren. Also ich muss es einerseits schwerer machen, aber natürlich andererseits auch Alternativen bieten, dass ich etwas machen kann. Vielleicht dazu als ein aktuelles Beispiel aus letzten Jahr: Während Corona gab es ja auch sehr viele von diesen Pop-Up-Radwegen, wo man eben Straßen in verschiedenen Städten teilweise ganz gesperrt hat und gesagt hat, das ist jetzt für Fahrräder. Da könnt Ihr Fahrrad fahren, damit eben ÖPNV nicht so genutzt werden muss und die Ansteckungen reduziert werden. Das ist in vielen Städten auch auf sehr viel Resonanz gestoßen und wird teilweise auch weiterverfolgt und weiter umgesetzt. Das ist eben diese Idee, ich versuche wirklich diese Umstellung zu fördern, statt einseitig auf die Verkehrsmodi einzuwirken.
Diringer: Gerade zum Fahrrad gab es auch eine Frage beim Wissenschaftsjahr: Es ist auch die Frage, ob es jetzt theoretisch physikmäßig Anklang findet oder mehr sozialwissenschaftlich. Die Frage war tatsächlich, wie die Begeisterung für das Fahrradfahren gesteigert werden kann. Lässt sich das auch modellieren oder untersuchen mit theoretischer Physik?
Dr. Schröder: Wir haben tatsächlich ein Projekt, in dem wir versuchen, nicht so sehr die Begeisterung fürs Fahrradfahren zu modellieren, aber tatsächlich die Struktur von Fahrradwegnetzen. Also was für Eigenschaften müssen die haben, damit ich möglichst überall hinkomme. Zum Beispiel kann man sich überlegen, dass ich vielleicht nicht überall einen Fahrradweg brauche, weil ich in den Wohngebieten auch auf der Straße fahren kann. Aber in vielen anderen Gebieten hätte ich gerne einen Fahrradweg, damit ich möglichst sicher und möglichst gerade ohne große Umwege von A nach B komme. Und natürlich will ich nicht nur auf den Hauptstrecken fahren können, weil ich vielleicht mein Fahrrad nutze, um einmal um die Stadt zu fahren. Aber für die meisten anderen Fahrten würde ich mein Fahrrad nicht benutzen, weil ich oft auf der Straße fahren müsste. Und dann lohnt es sich für mich vielleicht nicht das Fahrrad anzuschaffen oder das Fahrrad eben vorzuhalten, in dem Sinne. Da gibt es aber natürlich auch wieder viele detailliertere Aspekte im Fall von: Wie soll man diesen Ausklang von den Radwegen machen? Also es ist ein eigener Bürgersteig oder ist es auf der Straße oder nur abgetrennt? Also da sind wieder auch viele praktische Fragen, wo wir uns dann eben aus den Verkehrswissenschaften versuchen die Daten zu holen, wie man das effektiv modellieren kann und wie effizient verschiedene von diesen Aufbauten also von diesen Umsetzungen sind.
Diringer: Gerade bei den Fahrradfahrerenden ist es ja auch schon so, dass es viele, ja Fahrradanbietende gibt, bei denen man sich das teilen kann. Wo du von A nach B kommst und es dort wieder abstellen. Lässt sich da auch was für Autos oder eben für solche Carsharing-Angebote ableiten?
Dr. Schröder: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wieviel Überlapp es da gibt. Ich würde vermuten, dass in dem Fall die Zielgruppe vielleicht, die wir vorhin schon angesprochen haben, etwas anders ist. In vielen Fällen ist ja dieses, dass das Bikesharing von der Idee her für kurze Trips benutzt werden. Oder das Scooter-Sharing, was man jetzt auch überall sieht - die E-Scooters, dass man die vielleicht mal eben für kurze Trips benutzt, weil man sowieso zu Fuß unterwegs ist undl man nicht so viel zu transportieren hat. Da kann ich natürlich einfacher mit dem Fahrrad fahren oder es für die letzte Meile nutzen, weil ich mit der Straßenbahn gefahren bin, aber noch ein Stück laufen müsste oder so. Wogegen das Carsharing vielleicht viel eher als Ersatz für Fahrten gemacht wird, wo ich Dinge transportieren muss oder die länger sind, die ich sonst mit dem Fahrrad nicht zurücklegen kann. Also da ist unter Umständen, wie ich vermuten würde, die Zielgruppe anders. Oder man spricht da verschiedene Leute an, die das sonst interagiert. Ich bin sicher, es gibt Ähnlichkeiten. Das müssten wir uns aber vielleicht auch mal anschauen.
Diringer: Ist ja auch wieder die spannende Frage, weil wir vorhin die Strichmännchen hatten: Wie viel darf ich jetzt reduzieren? Und dann natürlich dann auch wieder darf ich jetzt das Fahrrad mit einem Auto ersetzen, sozusagen bei dem Strichmännchen? Vielleicht wäre das zu viel.
Dr. Schröder: Man kann definitiv einige Aspekte übertragen, im Sinne von der Frage: wie weit habe ich es denn bis zu meinem, also bis zum Auto oder bis zum Fahrrad? Wenn das zu weit ist, lohnt sich das Angebot natürlich nicht. Wenn ich zum Fahrrad erst mal ein Kilometer laufen muss, dann kann ich es auch gleich lassen.
Da kommt dann aber natürlich auch wieder die Frage rein, die das von den Verkehrsmitteln nicht ganz agnostisch machen kann, sondern wenn ich zum Auto einen Kilometer laufen muss - das mache ich vielleicht, weil, da fahre ich ja noch ein ganzes Stück. Das lohnt sich unter Umständen.
Grundsätzlich sind die Fragen: Wie viele brauche ich? Wo soll ich die Fahrzeuge positionieren, damit die genutzt werden? Und die kann ich auch in beiden Fällen mit vielleicht ähnlich Methoden vermutlich beantworten.
Diringer: Dann noch mal einen Blick in die Runde, sind weitere Fragen aufgekommen?
Gast: Ja, vor allem vorhin fiel schon mal das Wort neun Euro Tickets. Gibt es eigentlich Pläne oder Vereinbarungen zwischen Forschungseinrichtungen und Verkehrsbetrieben aller Art, um dort die in diesen drei Monaten, das Verkehrsaufkommen mal zu beobachten und eventuell im Nachgang dann Rückschlüsse zu ziehen, was man dort insgesamt verbessern könnte? Also dass die Forschungseinrichtung, die Verkehrsbetriebe, dabei unterstützen?
Dr. Schröder: Inwieweit das wissenschaftlich begleitet wird, weiß ich tatsächlich nicht, da müssten Sie definitiv die Verkehrswissenschaftler fragen. Ich gehe aber davon aus, dass definitiv Fahrgastzählung und so, also die Ausnutzung zumindest auch von den Unternehmen aufgezeichnet wird, um zu schauen, wo brauchen wir unter Umständen eben auch neue oder mehr Fahrzeuge oder Zusatzfahrten. Und so weiter. Ich würde Ihnen zustimmen und es wäre auf jeden Fall wichtig, das zu machen, damit das Experiment – weil man daraus auch etwas lernt – eben für die Zukunft genutzt wird oder man weiß, wie man das dann später vielleicht sinnvoller und besser umsetzen kann.
Diringer: Dann hier vorne war noch eine Frage.
Gast: Es geht in eine ähnliche Richtung auch nochmal um das 9-Euro-Ticket. Es ist ja nun ein politisches Instrument und wird subventioniert. Aber mich würde interessieren, ob sie als Forscher trotzdem da mit Spannung hinschauen, wie das anläuft, dieses Experiment. Beziehungsweise auch hinterher, wenn es eben nicht mehr da ist, nach den drei Monaten also, das beschäftigt mich zum Beispiel. Es wird sicherlich viel genutzt, aber was ist, wenn es nicht mehr da ist? Also wird es vermisst werden? Es ist natürlich eine allgemeine populäre Frage, aber Sie schauen, denke ich mal als Wissenschaftler, vielleicht auch mit Spannung darauf, oder?
Dr. Schröder: Also wir schauen auf jeden Fall mit Spannung darauf, weil im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Physikern wie Experimentalphysikern, können wir ja nicht einfach hingehen und sagen verbietet mal alle Auto in der Stadt, wir gucken mal wie der Verkehr aussieht. Wir wollen das gerne wissen. Das können wir maximal simulieren, wenn wir dafür sinnvolle Modelle haben. Und dann sind eben solche Experimente immer sehr hilfreich, um mal zu sehen was wäre wenn in der echten Welt. Zum Beispiel um eben zu zeigen, wie wird das genutzt? Was ändert das vielleicht auch an den Autofahrern, also wie viele Leute wechseln da rüber? Was ändert das an der Nutzung von den Fahrzeugen? Vielleicht auch was ändert das zum Beispiel an der Nutzung von Carsharing oder von den Bikesharing oder Scooter-Sharing Angeboten? Hat eben das 9-Euro-Ticket da auch positiven Einfluss, weil ich die als Anschluss nutze oder weil ich eben weniger Carsharing nutze zum Beispiel. Also diese Experimente oder Ideen wie autofreie Sonntage zum Beispiel sind tatsächlich aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man sonst sehr schwer mit dem System experimentieren kann und eben nur verschiedene Länder oder Städte vergleichen kann, wo aber dann die Gegebenheiten vielleicht doch zu unterschiedlich sind, um sinnvoll Vergleiche ziehen zu können und verstehen zu können, was das genau macht, dieser Aspekt.
Diringer: Ja, gibt es weitere Fragen?
Gast: Also das ist jetzt schon ein bisschen her das Thema, aber vielleicht noch einmal zum ländlichen ÖPNV. Ich kenne es auch so von mir aus dem Ort, dass der Bus vielleicht viermal am Tag kommt. Dann nutzt man den natürlich nicht, weil man extrem unflexibel ist. Beziehungsweise, wenn man ihn nutzen muss - Okay. Aber eigentlich holt man sich so schnell wie möglich ein Auto oder ein Motorrad. Gibt es denn Simulationen, wo mal untersucht wurde, was denn passieren würde, wenn mehr Busse fahren würden oder wenn es halt zum Beispiel Sammeltaxen oder so was in diesen Orten gibt?
Dr. Schröder: Das ist ein Aspekt. Also das ist, wie gesagt, teilweise Fokus von diesen Pilotprojekten, die nicht auf urbane Mobilität abzielen. Gerade weil das natürlich in ländlichen Räumen weniger ist und Nahverkehr immer auch tatsächlich immer weiter abgebaut wird, aber ja da sein soll und muss. Wir schauen uns das auch an in der Frage: Wie interagiert das System mit Linien zum Beispiel? Ich meine, in den meisten Fällen habe ich ein Ort in der Nähe mit Bahnlinien. Wenn ich also weiter weg will, macht es zum Beispiel Sinn, dass ich direkt von einem Ort eine Fahrt anbiete in die Stadt oder dass die Kunden zur Bahnlinie bringe und dann von da fahren lasse.
Unter welchen Umständen macht das Sinn? Man hat natürlich das Problem, dass entweder man oft sehr viel, sehr große Umwege hat, weil man von einem Ort zum nächsten vielleicht doch mal durch den Nachbarort noch fährt und dann 50 Prozent, 100 Prozent länger unterwegs ist. Oder das man oft sehr wenige Fahrten teilen kann, weil natürlich in den Orten sehr weniger Leute wohnen und dann wenige Leute zur gleichen Zeit Anfragen stellen.
Da muss man vermutlich ein bisschen die Flexibilität doch wieder einschränken und ja effektiv nicht sagen: Ich biete den Bus an, der nur morgens um zehn und um eins und um vier fährt. Aber ich kann ja durchaus meine Fahrt auch vorher anmelden und dann entsprechend für andere Leute, die dann sehen Ah zu der Zeit, zu diesem Zeitpunkt gibt es eine Fahrt, wenn ich da auch fahre, ist es für mich zum Beispiel günstiger, da mitzufahren. Das wäre eine Möglichkeit eben um diese Anreize zu setzen, damit die Systeme vielleicht doch funktionieren, in dem Bereich.
Diringer: Also auch Lösungen für eher ländliche Regionen anstatt jetzt nur das Beispiel Dresden mit Innenstadt betrachten. Gibt es weitere Rückfragen? Ich sehe jetzt gerade aktuell noch keine, gibt es dann von ihrer Seite aus noch ein Themenfeld, das jetzt zu kurz kam. Wo Sie denken da forsche ich jeden Tag dran und kann es viel zu selten nach außen tragen?
Dr. Schröder: Tatsächlich ist der Kernaspekt von unserer Arbeit wirklich die geteilte Mobilität und wie man das sinnvoll umsetzen oder beschreiben und dann hoffentlich umsetzen kann. Wir haben wieder dann auch diese Projekte zu den Fahrradwegen und schauen uns teilweise, auch wenn wir dazu Ideen oder Fragen haben - wenn wir uns denken, da gibt es doch sicherlich spannende Effekte, in der Elektromobilität und dem autonomen Fahren an. Aber das sind tatsächlich eher Randbereiche von unserer Forschung.
Diringer: Vielleicht auch noch die Rückfrage, wie denn deutschlandweit oder international auch das Forschungsfeld aufgebaut ist. Also gibt es da Länder, die besonders fortschrittlich sind, oder Regionen, die schon viel im theoretischen Forschen entwickelt haben?
Dr. Schröder: Aus dem Bereich von der theoretischen Physik oder international viel eher meistens angewandte Mathematik eigentlich. Weil es so interdisziplinär ist, wird immer gerne gefordert, es ist aber trotzdem sehr, sehr schwer, das wirklich umzusetzen. Es gibt einige Leute, die das auch schon sehr lange machen in Frankreich, in Paris oder in den USA, die sich also vor allen Dingen vielmehr mit Mobilität beschäftigen, wie Städte entsprechend als sozioökonomische System funktionieren und dann natürlich in dem Zusammenhang auch Mobilität als integraler Bestandteil von einer Stadt betrachten. Und ich meine natürlich in Dresden gibt es durchaus auch eine, nicht nur in den Verkehrswissenschaften, aber auch aus Sicht der Physik, erfolgreiche, würde ich mal sagen, Geschichte in der Beschreibung zum Beispiel von Fußgängerdynamik oder von dem Verhalten von Menschen, die aus einem Stadion oder aus Gebäuden eben rausgehen oder fliehen wollen eben bei Feuer. Es gibt einige Menschen, die sich viel damit befassen, die auch die sind, die ähnliche Ansätze verfolgen. Das wird in letzter Zeit insbesondere mit viel mehr Fokus auf diese komplexen Systeme auch mehr tatsächlich. Und dann haben natürlich verschiedene Gruppen, verschiedene Foki, worauf man sich jetzt genau festlegt, ob man eben auch geteilte Mobilität macht, ob mal mehr Städte anschaut oder mehr vielleicht auf Fahrradfahrer schaut als neue System. Es gibt eine eigene Community, die ist aber würde ich sagen, vergleichsweise klein also und oft auch sehr lokalisiert in den einzelnen Ländern.
Diringer: Sehr interessant schon mal auch den Status quo und auch Ihre Vorausschau, dass es in Zukunft vielleicht noch mehr wird oder auch hier gerade Forschungseinrichtungen aufpoppen. Es ist auch eine weitere Frage noch aufgepoppt hier vor Ort.
Gast: Weiß man, ob das Wetter eine Einflussgröße ist?
Dr. Schröder: Also definitiv hat das einen Einfluss! Ich meine ich würde bei Regen nur sehr ungern Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist relativ klar. Wie groß der Einfluss direkt ist, dass weiß ich tatsächlich nicht. Das Wetter ist so einer der Aspekte, den wir einfach mal zuerst aus unseren Modellen rauswerfen. Weil das ist im Prinzip genau die Sache. Es ist halt ein externer Einfluss, den wir nicht kontrollieren können. Wie wir das versuchen zu beschreiben, ist indem wir das System anschauen, bei verschiedenen Parametern also zum Beispiel bei geteilter Mobilität. Wie weit wären Sie bereit zu einem Haltepunkt zu laufen, um dann da einzusteigen? Und dann kann ich natürlich effektiv abbilden bei schlechtem Wetter, bei Regen wollen sie weniger weit laufen. Und dann kann ich mir die Systeme angucken, wenn ich sie wenig laufen lasse oder wenn ich sie viel laufen lassen und was das mit der Effizienz macht und habe dadurch effektiv diese Effekte von Wetter oder von Gepäck oder anderen Aspekten abgebildet, aber nicht explizit modelliert.
Diringer: Für die Aufnahme kurz: Die Frage war gerade, wie eine Kopplung zwischen eben der Wetterlage und dem Angebot möglich sein könnte.
Dr. Schröder: Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Wir schauen auch immer gerne auf Daten, wenn es denn Daten gibt, zum Beispiel von der geteilten Mobilität, also ganz viel in Amerika, in New York, einfach, weil es so groß ist und weil die Daten öffentlich verfügbar sind, von den Taxifahrten oder von den Überfahrten. Man kann die immer schön als Stichprobe nutzen, ob denn das Modell vielleicht, das man hat, auch häufig Sinn macht und funktioniert. Wir haben es noch nicht mit den Wetterdaten verglichen, wann oder ob Menschen, das denn nutzen. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob man da signifikante Effekte sehen kann. Ich denke auf jeden Fall, wenn solche Systeme wirklich genutzt und umgesetzt werden, macht es definitiv Sinn die Wettervorhersage genauso wie natürlich auch die Schwankungen über den Tag hin von der Anfragerate mit einzubeziehen und zu sagen jetzt ist gerade viel los, also lauf doch mal ein kleines Stück weiter. Dann müssen wir einmal anhalten und nicht zehnmal auf den Weg, während, wenn vielleicht nicht so viel los ist, mittags oder vielleicht nachts, dann fahre ich auch bei der Haustür vorbei, weil dann habe ich eh nicht so viele Umwege. Also in diesen Bereichen kann man definitiv für die Umsetzung und Optimierung solche Daten mit einbeziehen, wenn man das denn wies.
Diringer: Vielen Dank. Wir nehmen noch die allerletzte Frage, denn die Zeit ist eigentlich schon um. Und wir wollen ja auch, dass wir alle das schöne Wetter im Botanischen Garten noch genießen können.
Gast: Das fällt mir nur gerade zu Wetter ein. Ich habe in Münster studiert, und da wird bei jedem Mist-Regenwetter auch Fahrrad gefahren. Kann es auch sein, dass zum Beispiel die Gewohnheit der Menschen einfach mit reinspielt? Das kann man ja eigentlich nicht wirklich rational mit reinbringen, oder? Lässt man das raus oder versucht man es trotzdem mit einzubeziehen?
Dr. Schröder: Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Die Gewohnheit also, was mache ich? Denn fahre ich normalerweise Fahrrad, dann bin ich natürlich auch geneigt, viel öfter Fahrrad zu fahren. Da spielt auch ganz oft die Frage rein, warum fahre ich überhaupt? Wenn ich also zur Arbeit fahre, dann mach ich das bei jedem Wetter. Ich muss zur Arbeit. Wenn ich einfach nur irgendwohin fahre, zum Spaß. Dann denke ich mir vielleicht beim Regen: das will ich nicht so gerne machen, dann nehme ich da lieber den Bus oder mein Auto.
Also es kann auf jeden Fall funktionieren und hängt ein bisschen auch wahrscheinlich von der Infrastruktur und von dem gelernten Verhalten ab. Und da würde ich auch vermuten, dass es auch jetzt so eine Art Generationswechsel teilweise gibt, auch von der zum Beispiel Autonutzung, das so viele Leute, wahrscheinlich jetzt viele junge Leute eher kein Auto mehr kaufen oder weniger ein Auto kaufen, als das früher der Fall war. Und dass solche Aspekte natürlich definitiv da mitreinspielen. Die Änderung der Mobilitätsverhalten werden aber natürlich auch auf sehr langen Zeitskalen erst passieren. Wir würden so etwas eben auch wieder abbilden, indem wir nicht so sehr schauen, was machen Menschen bei dem Wetter speziell, sondern einfach es gibt mehr Nutzer. Wie verhält sich das System dann? Und das kann auch aus unter unterschiedlichen Gründen eben so sein, weil es billiger, weil es einfacher ist, weil Menschen es eben gewohnt sind und mehr machen.
Diringer: Ich habe es gerade schon angekündigt. Wir sind schon am Ende mit unserer Zeit, und ich möchte mich auf jeden Fall zum einen noch mal bei Ihnen bedanken für die vielen spannenden Fragen und fürs Zuhören und dann natürlich bei Doktor Schröder. Wir haben Einblicke darin bekommen, wie Sie jeden Tag forschen und aus Daten der Statistischen Physik und Thermodynamik Dinge ableiten, Dinge modellieren, Strichmännchen bauen und eventuell auch solche Experimente, wie sie jetzt deutschlandweit stattfinden, nutzen können, um uns weiterzubringen, um Mobilität und verschiedene Kombinationen von Mobilitätsangeboten neu zu denken oder auch zu verändern. Und ich glaube, wir sind alle jetzt mit unseren Gedanken auch noch einmal deutlich tiefer eingestiegen und werden uns jetzt vielleicht auf dem Rückweg, je nachdem, ob es zu Fuß, per Fahrrad, Auto oder Straßenbahn ist, noch einmal hinterfragen, welches Verkehrsmittel wir heute gewählt haben oder auch in Zukunft wählen werden. Vielen, vielen Dank dafür. Auch noch mal Dankeschön an den Botanischen Garten und diese schöne Lokalisation hier, diesen schönen Ort. Ich entlasse sie gerne noch mal hier vorzukommen, nochmal individuell Rückfragen zu stellen und ansonsten, wie gerade schon angedeutet, vielleicht noch mal das schöne Wetter zu genießen und natürlich gerne zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Bis dahin viel Spaß!
Bestäubungsökologie - Dr. Katharina Stein
Weltweit geht die Zahl der Insekten zurück - was sich auch auf die von ihnen bestäubten Pflanzen auswirkt. Doch wie genau verändern sich die Erträge einzelner Arten? Dr. Katharina Stein berichtet, warum sich nicht so leicht vorhersagen lässt, welche Bestäuber eine Blüte anlockt und wie viel Geduld und Einsatz die Forschung von ihr als Bestäubungsökologin fordert.
Börge Mehlhorn - Moderator: Herzlich willkommen im Botanischen Garten! Das ist jetzt die dritte Ausgabe von der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Die Koryphäe unter der Konifere. Genau, worum soll es heute gehen? Um Bestäubung im hauptsächlichen Teil und im Speziellen um die Bestäubung durch die Biene. Und das ist ja auch ein recht aktuelles Thema. Vom Bienensterben hört man ab und zu in den Medien. Und ich würde das Ganze vielleicht anfangen mit einem Zitat von Albert Einstein, der ja sagte: Wenn die Biene ausstirbt, dann dauert es nicht mehr lange, bis die Menschheit auch ausstirbt. Und jetzt, da ich auch Laie bin, würde mich interessieren, was denn die Wissenschaftlerin dazu zu sagen hat.
Dr. Katharina Stein: Vielen Dank Börge. Ein dramatischer Einstieg. Ich gehe auch gleich darauf ein. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Katharina Stein. Ich bin Biologin, und ich habe in Leipzig Biologie studiert, habe dann in Halle Saale promoviert. Darauf komme ich auch ganz kurz gleich zurück. Und habe dann meine Postdoc-Phase - also wenn man promoviert ist, die Phase danach, bis man irgendwann hoffentlich mal eine Professur ergattert - habe ich in Westafrika verbracht und habe dann angewandt geforscht. Darum geht es jetzt gleich in den nächsten Minuten. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Und ich freue mich, dass der Botanische Garten einen Pavillon zum Sonnenschutz errichtet hat. Das ist, das ist fein, vielen Dank dafür. Barbara Ditsch, die Kustodin des Botanischen Gartens. Und genau, um die gleich die Frage zu beantworten von Börge Mehlhorn: Albert Einstein ist ein schlauer Mann gewesen. Und auch was die Bienen angeht, hat er recht gehabt. Denn ungefähr 90 Prozent der Blütenpflanzen sind abhängig von Bestäubung, nicht nur von den Bienen, aber zumindest teilweise, für eben die sexuelle Reproduktion, das heißt Samenproduktion, damit die sich eben fortpflanzen können. Und 75 Prozent unserer Nahrungsmittel sind von Bestäubung abhängig. Darauf komme ich nachher noch. Wenn die Biene fehlt, haben wir wirklich ein signifikantes Problem was die Ernährungssicherheit angeht. Also wenn wir nicht nur noch Kartoffeln und Getreide essen wollen, dann müssen wir die Bienen erhalten. Und ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt - ich reiche das einfach herum. Das hab ich jetzt einfach nur mal ausgedruckt. Ein Supermarkt. Die Marke steht jetzt drauf, ist aber auch egal. Dort hat man in 2018 alle Produkte über Nacht aus den Regalen genommen, die irgendwas mit Bestäubung zu tun haben. Kaffee, Kakao, Obst, Gemüse... Und von ungefähr 2500 Produkten, die in so einem Supermarkt so regulär angeboten werden, sind 1600 irgendwie abhängig von Bestäubung. Na also, die haben jetzt nicht nur den Honig aus dem Regal genommen. Und sie haben in der Frühe, ohne die Leute vorzuwarnen, einfach die Türen geöffnet. Und haben wirklich verblüffte Gesichter erlebt. Also manche waren auch sauer. Also, manche ältere Leute, die sich mühsam auf den Weg gemacht haben, konnten eben nicht ihre Einkäufe erledigen. Aber ich gebe das einfach mal rum, dass Sie es sehen. Und die Aktion war eine Zusammenarbeit mit dem Nabu und hieß halt "Biene weg, Regal leer". Also einfach ein schönes - ja, es ist einfach ein medienwirksames Experiment gewesen, auch nur einen Tag lang. Aber um diese Bedeutung zu untermauern
Und das Erste, was ich meine Studenten frage zum Beispiel ist: Was ist denn Bestäubung? Und es ist eine ganz einfache Definition. Sie kennen ja - stellen Sie sich einfach mal eine Kirschblüte vor. Die hat glaube ich jeder vor Augen. Und da haben Sie den weiblichen Teil der Blüte. Na, also, den Stempel mit der Nabe. Und dann haben Sie die Staubfäden mit den Staubbeuteln, wo der Pollen produziert wird - das ist der männliche Teil. Also ein Großteil der Blüten ist Hermaphrodit. Das heißt, die haben beide Geschlechter in einer Blüte. Und Bestäubung ist einfach nur die Übertragung vom Pollenkorn auf die Narbe vom Griffel eben. Mehr ist das nicht. Das ist einzig und allein Bestäubung im botanischen Sinne. Und Bestäubung kann manchmal auch durch Bewegungen, durch Wachstumsbewegungen von alleine stattfinden. Aber normalerweise braucht so ein Pollen irgendeinen Vektor. Der braucht quasi so etwas wie einen Zug, mit dem er irgendwie zur Narbe gelangt. Das kann der Wind sein. Wasser. Aber natürlich am wichtigsten ist das durch Tiere. Also Tierbestäubung ist unglaublich effektiv und wie gesagt 90 Prozent aller unserer Blütenpflanzen sind irgendwie tierbestäubt zu irgendeinem Ausmaß. Die wichtigsten Bestäuber sind Insekten. Das ist einfach Fakt. Und unter den Insekten sind es die Bienen. Es gibt 20.000 Bienenarten auf dieser Welt, in Brasilien ungefähr 3000. In Deutschland schwanken die Angaben, je nachdem, was man liest. Aber ungefähr 550 bis 580 Bienenarten gibt es in Deutschland. Und Barbara korrigier mich, aber hier im Botanischen Garten habt ihr ungefähr 150 Bienenarten - sind zu viele? Ja aber trotzdem toll. Also chapeau! So als Refugium mitten in der Stadt. Also Bienen sind die wichtigsten Bestäuber weltweit. Egal welche Bienenart. Und dann kommen natürlich viele Schmetterlinge, Fliegen, Käfer. Und in den Tropen gibt es eine Besonderheit, da werden viele, auch viele Früchte, die wir konsumieren, von Wirbeltieren bestäubt, und zwar von Kolibris zum Beispiel, von Vögeln und von Fledermäusen. Genau, nur, um ganz kurz auf meine Doktorarbeit zu kommen. Das war Grundlagenforschung. Komplette Grundlagenforschung. Habe ich in Brasilien gemacht, in Südamerika, und zwar hier im Osten von Brasilien, in der Nähe von Rio de Janeiro. Da ist der atlantische Küstenregenwald. Was in so Braun dargestellt ist, ist die ursprüngliche Ausbreitung. Was in grün ist, ist noch das, was übrig ist davon. Das ist ein Biodiversitäts-Hotspot. Wird gerne in aller Munde verwendet, aber im ökologischen Sinne ist ein Hotspot eine Fläche, die mindestens 1500 endemische Gefäßpflanzen aufweist. Das heißt, das sind Pflanzen, die wirklich nur regional sehr limitiert vorkommen. Ja also, die finden sie nicht in Argentinien und Kolumbien, sondern mitunter auch ein superkleinen Refugien. Und die mittlerweile schon bis zu 70 Prozent ihrer ursprünglichen Fläche verloren haben. Na also, es ist eine schöne Auszeichnung, ein Hotspot zu sein. Aber eigentlich ist das dramatisch. Nun also: Besser, man ist keiner. Es gibt 34 Hotspots mittlerweile, die ausgewiesen sind. Madagaskar natürlich, die Regenwälder Westafrikas und so weiter. Dort habe ich gearbeitet, im Regenwald und habe mir zwei Pflanzenarten angeguckt. Eine musste jetzt hier leiden, aber die darf wurzeln und hat eine zweite Chance und zwar Nematanthus. Das ist eine - das gehört zur Familie der Gesneriengewächse. Usambaraveilchen haben Sie bestimmt alle auf der Fensterbank stehen. Sie können das jetzt zugeben, aber müssen Sie auch nicht. Und jetzt fliegen mir meine Fledermäuse davon... Auf jeden Fall gehören die zur gleichen Familie, man glaubt es kaum. Ja also, ich habe mir verschiedene Pflanzenarten angeschaut. Und zur gleichen Familie wie die gehört auch diese. Die heißt Besleria, die so gelb ist, so kleine gelbe Blüten, Gelb, Weiß. Und im Vergleich dazu eine, die so schön Pink ist, und die hat so ganz tubuläre Blüten; also ähnlich wie die. Und es gibt ein tolles Konzept aus der Bestäubungökologie. Da war ich als Studentin total begeistert von. Das nennt sich Bestäubungsyndrome. Das heißt je nachdem, wie die Blüte ausschaut - na?: welche Farbe hat die? Wann blüht die? Blüht die nachts? Duftet die? Hat die Nektar?- kann man bestimmen, wer potenziell als Blütenbesucher oder sogar als Bestäuber vorbeikommt. Na, das ist das Konzept. Und diese Blüte sagt: Hier kommt ein Kolibri. Erstens, wir sind in Südamerika, da gibt es sowieso - also Kolibris sind nur in den Amerikas vertreten, und deswegen habe ICH mir gedacht bei diesen Pflanzen: Da kommen hundert Prozent Kolibris. Und bei dieser, die eher so gelb-weiß blüht, kommen bestimmt eher Bienen oder irgendwelche anderen Tiere. Wahrscheinlich mehr Insekten als Vögel. Weil das Syndrom mir eben sagt: Das findet eine Biene schöner als ein Kolibri. Und um das kurz zu halten, weil das war wie gesagt man eine ganze Doktorarbeit, die ging vier Jahre: Es kommt immer alles anders, als man denkt. Und wie es so war: Diese perfekten ornithophilen, also vogelbestäuben Blüten - Da waren mehr Bienen als Besucher da. Und bei der, wo ich denke, da passt doch perfekt die Biene dazu: Da kamen mehr Kolibris. Nun also bloß dieses kleine - ja, es ist frustrierend, wenn man das publizieren soll, aber einfach nur als kleines Beispiel: Es lohnt sich hinzuschauen, Konzepte zu hinterfragen, weil die Realität ist immer komplexer. Und Pflanzen mögen spezialisiert sein, aber die Tiere sind eben mobil. Und die sind meistens auch nicht ganz so wählerisch. Also viele spezialisierte Blüten, wie diese hier, werden eben auch von generalistischen Insekten besucht. Also, das war die Quintessenz in a nutshell von meiner Doktorarbeit.
Und als Beispiel, was es noch für schöne Syndrome gibt - ich gebe das nur rum, ich habe gar keine Zeit, darauf einzugehen. Aber es gibt halt, wie gesagt, viele Nutzpflanzen, die von Fledermäusen und Flughunden bestäubt werden. Zum Beispiel Durian, können sie sich gleich noch mal anschauen. Die Banane. Tequila zum Beispiel, also Tequila wird natürlich jetzt nicht aus der Blüte gewonnener. Man ritzt die Pflanze ein und aus dem Wundsaft heraus nutzt man diesen Zuckersaft zur Vergärung. Aber die Pflanze an sich ist Fledermaus bestäubt. Und auch genau Durian. Das gebe ich mal rum. Das können Sie sich einfach mal anschauen. Und hier sind noch ein paar andere niedliche Fotos. Ja, ich gebe einfach mal was rum, und es gibt auch - nur so als Aha-Effekt - es gibt auch nicht-fliegende Wirbeltiere, die zufällig als Bestäuber agieren. Das sind kleine Nagetiere und auch Beuteltiere. Zum Beispiel in Australien, die da auf den Eukalyptus- und Protea-Gewächsen lang sausen. Die haben eine ganz lange Schnauze, denn die haben eine lange Zunge, und mit der langen Zunge kommen die eben an diesen tief verborgenen Nektar ran. Und wenn man eine lange Zunge hat, die manchmal 150 Prozent länger ist als die eigene Körpergröße - also, da wäre meine Zunge jetzt drei Meter oder so was. Da muss man die ja auch irgendwo verstauen. Und deswegen haben diese - schauen Sie sich mal die kleinen Kerle an - es ist total niedlich. Deswegen haben die auch so ein langes Rostrum. Also erstens angepasst, um mit dieser langen Schnauze in die Blüten reinzukommen, in die Blütenstände. Gleichzeitig muss die Zunge auch irgendwohin. Ich gebe es einfach nur mal rum, und damit springe ich schon, weil die Zeit eben nicht dazu da ist, hier meine Standard Vorlesung zu halten - Okay, gehe ich mal weiter.
Und zwar hatte ich dann promoviert und habe ein Angebot bekommen, als Postdoc und bin vom Regenwald und Kolibri-bestäubten Pflanzen gesprungen nach Westafrika in die Savanne. Also viel viel trockener, als mir lieb ist ehrlich gesagt und zur Bienenbestäubung. Also ich hatte nicht viel Ahnung von Bienen, und mittlerweile hat sich das etwas gebessert. Und ich konnte auch kein Französisch - hatte ja Portugiesisch in Brasilien. Also, man muss als Wissenschaftler nicht nur Forschung betreiben, man muss auch die ganze Infrastruktur drum rum mitmachen: die Sprachen, die Kultur, und da gehört noch viel mehr Kompetenz dazu, als man immer denkt. Und ich habe dann von 2012 bis 2017 aktiv in Burkina Faso gearbeitet. Sie müssen sich nicht schämen, wenn sie nicht sofort wissen, wo das liegt, das wusste ich auch nicht bei der Ausschreibung. Also wir sind hier in Afrika, hier ist der Westen, und das liegt südlich von Mali und nördlich von Ghana und Cote Ivoire. Also, das hab ich hier so rot indiziert.
Beim Human Development Index - also das ist ein Index über die Entwicklung dieser Länder. Da sind 189 Ländern gelistet. Burkina Faso ist auf Platz 185, also ist ein bettelarmes Land; wie viele in Westafrika. 80 Prozent - 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung lebt von ruraler Landwirtschaft. Subsistenzlandwirtschaft. Das heißt, was die anbauen essen, die auch auf und brauchen das auch. Extrem anfällig auch jetzt für den Klimawandel natürlich: Wenn es Dürren gibt oder wenn diese Heuschreckenplagen kommen. Und deswegen ist die Landwirtschaft dort wahnsinnig wichtig. Und ich habe mich jetzt nicht um Tomaten und Paprika gekümmert - wär auch spannend gewesen - ich habe mich um sogenannte Cash-Crops gekümmert. Und zwar sind das Feldfrüchte, die angebaut werden für den Export. Und Burkina Faso war mal der größte Baumwollexporteur von ganz Afrika. Wurde jetzt abgelöst durch Mali, aber ist immer noch an Platz zwei. Und ich habe mich eben auseinandergesetzt mit Baumwolle und mit Sesam. Weil das sind einfach die Sachen, die bauen die an, damit sie eben Geld gewinnen, wenn sie mal ... für Arztkosten, Schulgeld und so weiter. Also nur vom Feld in den Mund klappt nicht. Also auch da braucht man ein bisschen Geld. Und man glaubt es kaum bei einem Land was wirklich Top zwei ist für ganz Afrika am Baumwollexport: Es war nicht bekannt, welchen Beitrag Bienenbestäubung für die Ernte oder für den Ertrag dieser Feldfrüchte hat, von Sesam und von Baumwolle. Es gibt in der Literatur sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Manche Studien zitieren 60 Prozent Selbstbestäubung, was heißt, da muss man muss keine Biene kommen, dann muss kein irgendwie Bestäuber kommen, die bestäubt sich einfach selbst die Pflanze und macht Früchte und Samen. Und ich wollte es aber genau rausfinden mit der Art, die am meisten dort angebaut wurde. Also ich hab die Varietät genommen, die zu 80 Prozent in Burkina auf den Feldern angebaut wird und habe zuerst rausgefunden, zu welchem Ausmaß ist diese Pflanze selbst bestäubt? Und zu welcher Rate braucht die Fremdbestäubung durch Insekten, in dem Falle Bienen? Hier ist ein Exemplar einer Baumwolle, bereitgestellt vom Botanischen Garten. Tut mir leid, dass ich hier ein bisschen lachen, wenn ich die sehe. Wenn die auf dem Feld stehen, dann sehen die manchmal ein bisschen anders aus. Und zwar so ungefähr. Also die werden recht groß, so hüfthoch. Gut, es gibt viele Arten, manche klettern ja auch. Ja, und zunächst einmal schaut man sich diese Pflanze an und versucht zu verstehen. Denn als Bestäubungsökologe muss man genau wissen, wann muss man ins Feld gehen, um was zu beobachten oder was zu manipulieren. Und Baumwolle hat wunderschöne Blüten. Das ist an Tag eins, das hat so eine cremig-weiße Blüte. Duftet auch ganz leicht. Die öffnet sich 6.30 Uhr. Wenn es geregnet hat, dann eine halbe Stunde später. Und dann ist die quasi funktionell. Also man hat bei Baumwolle nur einen Tag, um irgendetwas zu machen als Bestäubungökologe. Tag zwei ist sie eigentlich noch schöner, dann ist sie sogar Rosa, die wird rosa über Nacht, aber die öffnet sich nicht mehr, die bleibt geschlossen. Und dann ist zwar rein optisch noch eine Blüte an der Pflanze, aber damit können Sie nicht mehr arbeiten. Also phänologisch - oder vom Blührhythmus her - ist es eine Zweitagesblüte. Aber funktionell ist es eine Eintagesblüte. Und das heißt, ich musste immer, egal, wie weit das Feld weg war, spätestens sechs Uhr 30 vor Ort sein, wenn die Blüte aufgeht, damit ich schneller bin als die erste Biene. Und wir haben dann natürlich rausfinden wollen, zu welchem Ausmaß kann die sich selbst bestäuben und haben - ich gebe es einfach rum, das können Sie auch sehen - Wir haben die einfach in Bestäubungsbeutel eingepackt die Knospen. Hier ist die Blüte dann schon geöffnet. Also man nimmt, die geschlossene Blüte noch. Man kennt die dann so gut, man sieht bei jeder Knospe, an welchem Tag die aufgeht, also man kann das genau dann abschätzen. Und die Bestäubungsbeutel sind furchtbar teuer, sehen aber eigentlich aus wie so ein Brötchenbeutel aus dem Supermarkt. Die sind aus Plastik, so leicht perforiert, und die sind Pollendicht, das heißt, durch diese Perforierung - Das Mikroklima ist wohl vergleichbar mit dem, was außen herrscht. Ist im Regenwald fragwürdig, ganz ehrlich. Aber es kann kein Pollen irgendwie zur Blüte gelangen. Und indem wir die eingetütet haben - Um das jetzt einfach zu halten: Wir haben da ganz viele Auskreuzungsexperimente gemacht, Pollen drauf und hin und her, ja, Pollen weggeschnitten und so weiter, aber um es einfach zu halten: Mit diesen Beutel haben wir Bestäuber ausgeschlossen. Das ist unser Scenario, dass wir alle Bestäuber oder alle Bienen verlieren. Das ist jetzt ein bisschen Schwarz-Weiß, erklärt aber "Beutel drauf - kann keiner ran". Das heißt, die Blüte kann sich nur selbst bestäuben. Nun haben wir am Ende geschaut, wie viele Früchte gibt es denn dann. Wenn man hundert Blüten eingetütet hat und hatte am Ende 60 Früchte, dann weiß man: "Okay, zu 60 Prozent kann die sich selbst befruchten". Und dann geht das natürlich noch weiter, weil eine reine Frucht zu haben - ich gebe das jetzt einfach mal rum... Bei Sesam haben wir das auch gemacht. Die reine Frucht an sich sagt noch lange nichts über die Qualität aus. Wir haben die Quantität, das ist schön. Ich weiß dann, wie viele Früchte wir haben durch Selbstbestäubung. Ich weiß auch, wie viele Früchte wir haben durch Auskreuzung. Wir haben natürlich dann auch Blüten offen gelassen, wo eine Biene Zugang hatte und haben am Ende - das wurde uns vom Botanischen Garten freundlicherweise bereitgestellt, mal ein paar Früchte von von der Baumwolle. Und am Ende haben wir das gewogen, weil die Bauern bekommen das Geld - also für ihren für einen Anbau - da kommen dann die Baumwollfirmen daher, und es wird schlichtweg einfach nur gewogen. Also das Einkommen wird nur über das Gewicht ermittelt. Also es ist wichtig, wie viele Samen da drin sind, weil die wiegen. Und wieviel Fasern da sind - die wiegen nicht viel. Also die Faserindustrie, die Textilindustrie, die schaut sich dann noch an, wie die Faser ist - wie lang die sind, verzweigt... Machen wir nicht. Aber für den Bauern ist es wichtig, dass diese Frucht so schwer ist wie geht. Und das haben wir eben verglichen mit Blüten, die von Bienen bestäubt wurden und mit Blüten, die eben das Szenario haben, also aus Selbstbestäubung resultieren. Ich geb das mal rum, das können Sie sich mal anschauen. Sie fühlen das auch. Wenn Sie das mal so ein bisschen durchfühlen. Das ist wie kleine Erbsen oder wie so kleine Böhnchen, die da drin sind. Das sind die Samen. Genau, Börge hilft mir, das ist nett von dir. Also ich weiß so weit, dass wir rausgefunden haben, zu welchen Prozentzahlen Baumwolle und Sesam selbst bestäubt sind. Da muss ich auf meinen Spickzettel schauen. Und zwar ist die Selbstungsrate tatsächlich sehr hoch bei Baumwolle, bei dieser Varietät, die ich genutzt habe, und zwar 61 Prozent. Das ist für den Bauern gut. Denn egal, was passiert, wie degradiert die Landschaft ist, der hat erstmal Früchte und kann die verkaufen. Also wenn man jetzt mal ökonomisch denkt. Bei Sesam waren es 20 Prozent, die sich ohne Bestäubung einfach Früchte bilden. Wenn wir aber Bienenbestäubung hatten, dann hatten wir einen Anstieg vom Gewicht oder von diesen Früchten um 62 Prozent bei Baumwolle und bei Sesam hat sich das Gewicht verdreifacht. Na also, ich habe es auch gleich monetär noch aufgeschlüsselt. Die Zahlen werden sie umhauen. Und wenn man das Szenario durchspielt, dass wir alle Bestäuber, alle Bienen verlieren würden, dann hätten die Bauern dort vor Ort mit den Gegebenheiten einen Ernteausfall von 37 Prozent Baumwolle und bei Sesam sind es 59 Prozent. Nun also das tut schon richtig weh.
Und dann gehen wir noch weiter, und zwar die reine, die reine Frucht und das Geld für die Ernte ist schön. Aber normalerweise benutzen die Bauern auch die Saat, die Samen für das nächste Jahr zur Aussaat. Also, die fummeln das raus - macht ganz viel Spaß, glauben Sie mir. Das haben wir natürlich auch gemacht. Jeden einzelnen Samen gewogen und so weiter, und das Saatgut wird dann eben im nächsten Jahr ausgebracht. Und deswegen haben wir uns mal die Keimung angeschaut. Wie keimen die, wenn die aus Selbstbestäubung resultieren? Und wie keimen die, wenn die Biene vorher da war? Und da auch wieder krasse Zahlen, muss ich sagen. Wenn die Biene bestäubt hat, dann haben die Samen in der F1 Generation, also in der Folgegeneration, um 72 Prozent gekeimt und bei Sesam waren es 62 Prozent. Ausschuss hat man immer, das ist normal. Wenn jetzt aber die die Blüte sich komplett nur selbstbestäuben musste und die Samen haben wir dann genommen zum Auskeimen, dann haben bei Baumwolle nur noch 47 Prozent ausgekeimt, also weniger als die Hälfte. Und bei Sesam sind 1,81 Prozent aller Samen noch gekeimt. Das heißt, Sie können sich vorstellen: 50 Kilo-Säcke an Sesam werden hat auf einen Acker ausgetrieben und zwei Prozent - noch nicht mal zwei Prozent! - davon keimt und wird wieder eine neue Pflanze. Na, da baut ja keiner mehr Sesam an. Na also, deswegen auch diese Kaskade von dieser Auskreuzung oder Bienenbestäubung ist halt so signifikant. Und ich habe, weil ich das - ich komme auch gleich noch mal zu den Zahlen, weil das... - oder ich mache es gleich, dann bleibt das stimmiger. Dann komme ich noch kurz auf die Bienchen. Ich habe ein paar Bienen mitgebracht. Da muss ich auch spicken, das habe ich natürlich nicht im Kopf. Das ist auch alles publiziert, also wer sich dafür interessiert, findet man auch alles im Netz. So ein Bauer hat, wenn der ganz normal seine Baumwolle angebaut, hat er ungefähr eine Tonne Ernte pro Hektar. 100 mal 100 Meter, dass ist so eine typische Feldgröße auch. Damit verdient er nach, nach dem was in Burkina damals bezahlt wurde, 2018, ungefähr 220 US-Dollar pro Hektar. Das bekommt er dafür. Da ist aber... da habe ich abgezogen, die Kosten das Saatgut zu kaufen, Düngemittel und Pestizide. Die haben normal angebaut wie immer. Ich habe den Bauern nicht gebeten, irgendetwas anders zu machen. Es sollte realistisch sein. Was ich nicht einkalkuliert habe, ist die Arbeitskraft. Also der Bauer, die Bäuerin, die Kinder - alle, die mit auf dem Acker helfen. Die Arbeitskraft habe ich nicht kalkuliert, dann würde die Bilanz noch ganz anders aussehen. Also da kriegt eigentlich so 220 US-Dollar pro Hektar, wenn wir alle Bienen.... die Baumwolle bestäuben, dort, dann hat der Bauer nur noch 600, ungefähr 600 Kilogramm pro Hektar und verdient nur noch 89 US-Dollar pro Hektar. Na also, von 220 auf 89. Das ist signifikant.
Und bei Sesam ist es noch schlimmer. Vor allen Dingen: Sesam ist Frauenarbeit. Die Felder gehören den Frauen. Es ist sehr, sehr aufwendig. Das sind meistens die schlechtesten Böden, ehrlich gesagt, die schlechtesten Standorte, aber das wird den Frauen zugeteilt: Hier hast du dein Feld, kannste was machen. Und für Sesam, weil es eben eine harte Arbeit ist, bekommen sie ungefähr 200 Kilogramm Ernte raus, verdienen damit 52 US-Dollar pro Hektar. Das Monatseinkommen, durchschnittliche Monatseinkommen in Burkina Faso ist bei 30 Euro im Monat, also deswegen 50 Euro verdienen ist besser als nichts. Wenn wir die Bienen verlieren würden, dann kann die Frau statt 200 Kilogramm pro Hektar nur noch 83 Kilogramm pro Hektar ernten. Und mit allen Kosten abgezogen, ohne ihren eigenen Arbeitsaufwand verdient sie pro Hektar ein Dollar achtzig. Und damit baut keiner mehr Sesam an.
Also deswegen nur, diese Zahlen untermauern das, wie unglaublich wichtig diese Ökosystemleistungen ist der Bienen, die eben sogenannt "gratis" auf die Felder ziehen und dort die Bestäubung leisten. Und das ist das, was wir vermitteln wollen: Erhalte die Savanne! Erhalte die natürlichen Systeme, wo die Biene lebt! Sesam und Baumwolle blühen vier bis sechs Wochen im Jahr. Aber was frisst denn die Biene für den Rest des Jahres, die braucht ja auch Nektar und Pollen durchgängig. Und die braucht Nisthabitate und so weiter. Deswegen ist halt unglaublich wichtig, überall auf dieser Welt, die natürlichen Habitate zu erhalten, damit wir eben von dieser Ökosystemleistung profitieren. In dem Beispiel ist es die Bestäubung. Genau.
Und jetzt wissen wir, dass die Biene wichtig ist. Aber wir wissen nicht, welche Biene wichtig ist. Biene ist nicht Biene. Ich habe gesagt 20.000 Arten, ne. Und das wusste in Burkina Faso auch keiner. Es wusste auch keiner, welche Bienenarten dort überhaupt existieren. Deswegen haben wir Bienen gefangen, zwei Jahre lang. Wir haben über 800 Fallen aufgestellt, sogenannte pan traps. Sie kennen ja sicherlich solche Plastikschalen, aus dem... die sind ja jetzt Gottseidank verboten, ab nächstem Jahr, nicht? Aber diese, die man so bei.. bekommt. Diese kleinen weißen Plastikschälchen. Die haben wir angesprüht mit UV-Farbe in Blau, Gelb und Weiß. Weil das sind die Farben, die für Bienen am attraktivsten sind. Das haben wir dann an so einen Holzpflock gepackt. Also einfach nur ein Holzpflock. Drei so ne Schalen dran. Das wird befüllt mit einer Salzlösung, mit einer gesättigten Salzlösung. Ist so was wie ein Konservierungsmittel, weil wir das drei Tage in der Savanne offen gelassen haben. Und ein ganz kleines bisschen Seife rein, damit die Oberflächenspannung zerstört wird. Das heißt, wenn die Biene kommt - das klingt jetzt martialisch - wenn die Biene kommt, dass die nicht erst noch schwimmt, stundenlang, sondern gluck gluck weg ist sie. Und Insekten - für alle, die das jetzt furchtbar finden - Insekten haben keinen Neocortex. Und da ist das Schmerzzentrum lokalisiert. Das heißt, was die Tierphysiologen uns beigebracht haben, ist, dass Insekten keinen Schmerz wahrnehmen können.Wir haben über 40.000 Bienen gefangen, für die Wissenschaft und haben erstmal rausgefunden, welche Bienen existieren. Was macht Landnutzung auch mit den Bienen? Das halte ich jetzt kurz. So können Sie noch Fragen stellen, wenn sie mögen, also je nachdem, wie degradiert die Landschaft ist, sehen wir da schon Unterschiede. Und welche Biene besucht die Blüten von Sesam und Baumwolle und vor allen Dingen: Wie effektiv ist eine Biene? Nicht jeder Blütenbesucher ist gleich effektiv. Manche stehlen Nektar oder manche räubern einfach den Pollen weg. Oder andere sind effektiv, aber wenn man eine größere Biene ist es vielleicht effektiver. Und das haben wir eben herausgefunden. Auch sehr, sehr aufwendig. Die Methodik spare ich mich jetzt mal hier. Und wir haben herausgefunden, dass eine Wildbiene, eine Langhornbiene - kann ich Ihnen auch umgeben, die heißt Tetralonia fraterna - ist eigentlich ganz hübsch das kleine Kerlchen, die ist hier drauf. Hab ich jetzt nicht mit, die ist in Brüssel im Naturkundemuseum, weil die so wertvoll ist. Genau, also diese Biene ist der effektivste Bestäuber neben Honigbienen, die wild vorkommen in Westafrika, von Baumwolle. Und bei Sesam war es eher die Honigbiene. Ich geb das einfach mal rum.
Und weil mir das so wichtig ist: Ich habe hier einen Kasten mit der Westlichen Honigbiene. Wenn man von Biene spricht, spricht man von dieser Art. Welche Unterart das ist, weiß ich nicht, ist auch nicht relevant hier in dem Moment. Also das ist ein Kasten von unseren genadelten Honigbienen. Wir haben für jede Biene, von den über 40.000, haben wir GPS-Koordinaten. Wir wissen, wo wir die gefangen haben und wann. Na, also Feld, in der Savanne, in welchem Monat, in welcher Falle. Riesendatensatz. Den haben wir ausgewertet und damit, dass es auch ... ich geb es einfach mal rum. Damit Sie auch mal sehen, dass es andere Bienen gibt, außer die normale Honigbiene, habe ich hier mal stachellose Bienen mitgebracht. Die sind so klein, die können Sie nicht mehr nadeln, die muss man kleben. Also mit Insekten- ... entomologischem Kleber. Wahrscheinlich ist es auch nur normaler Leim. Aber der wird teuer verkauft, weil man kann ihn wieder auflösen. Wenn man doch noch einmal nachbestimmen muss, könnte man das von diesem Blättchen wieder runterlösen und noch mal nachschauen. Also sind kleine stachellose Bienen, die machen auch Honig. Wird in - auch in Westafrika, vor allen Dingen aber in Südamerika - wird auch dieser Honig vermarktet. Also das ist eine wichtige Wertschöpfungskette, dass man diese Bienen hat. Die stehlen gerne Pollen, dafür sind sie berühmt, aber sie sind auch wichtige Bestäuber. Na also, die haben ein bisschen schlechten Ruf. Aber bei uns waren die sehr, sehr abundant. Das heißt, sie kamen sehr, sehr häufig vor. Aber haben dadurch eben auch eine gewisse Leistung erzielt. Genau, Sie machen das ganz prima, herzlichen Dank. Genau. Und da bin ich jetzt eigentlich zeitlich... Wo stehe ich denn, Börge? Gibst du mir mal ein Input? Oh, also dann, höre ich jetzt mal auf und freue mich auf auf Ihre Fragen. Danke!
Mehlhorn: Ja, das war ja schon ein schneller Abriss über eine sehr, lange wissenschaftliche - oder nicht sehr lange, aber eine längere wissenschaftliche Karriere. Ich hoffe, Sie konnten Folgen. Ähm, genau. Und ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen: Wir haben angefangen mit Forschung in den Regenwäldern in Südamerika. Da ging es darum, vorherzusehen, welche Blüten von welchen Bestäubern bestäubt werden und sind dann gegangen nach Afrika, um relativ anwendungsbezogene Forschung zu ähm, haben wir von dieser relativ anwendungsbezogenen Forschung erfahren, wo es um die alltäglichen Probleme der dortigen Bauern geht. Und es geht um Baumwolle, es geht um Sesam, es geht um Geld, das fasst es denke ich ganz gut zusammen. Die Biene spielt quasi eine große Rolle im finanziellen Leben der Menschen dort. Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Seien Sie mutig, und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich kurz, weil wir zeichnen auf, und es wäre gut, wenn Sie dann das Mikrofon sprechen können.
Gast: Okay, mich würde interessieren was passiert genau mit der Landschaft, warum die Bienen eventuell weniger vorkommen. Oder leben die solitär, sind es irgendwie im Volk lebende Bienen? Was brauchen die Bienen in der Landschaft? Das finde ich spannend.
Stein: Und das ist eine richtig gute Frage. Da sind wir nämlich noch dabei, das herauszufinden. Also die meisten sind ja Wildbienen, die wir untersucht haben. Und die meisten Wildbienen sind solitär. Für alle, die das nicht wissen, das sind keine staatenbildenden Bienen. Und wir haben - also die, wie sagt man so - diese Faktoren, die das Bienensterben oder das Insektensterben eben ausmachen, sind natürlich Landschaftsnutzungswandel. Na also, wir haben intensivierte Landschaft. Wir haben Fragmentierung von Habitaten, haben Waldzerstörung. Was eben in Westafrika... Dieser Wandel wird halt ganz stark degradiert, weil eben die Nutzfläche benutzt wird für die Landwirtschaft. Die Bevölkerung wächst, man muss sich ernähren - Das ist bei uns übrigens auch nicht anders - Und weil eben die Böden nicht viel hergeben, aber der Bedarf höher ist, wird eben immer mehr natürliches Habitat degradiert oder sogar einfach nur abgeholzt, damit man dort ein Feld etabliert. Das meiste, was man an Holz braucht, ist auch für die Energiegewinnung, fürs tägliche Kochen. 80 Prozent des Energiebedarfs wird über Feuerholz gedeckt. Also der größte Effekt dort ist eigentlich die Degradierung der Waldhabitate und der Savanne. Dann kommt - in Westafrika noch nicht, aber was natürlich hier in den industrialisierten Ländern der große Fall ist - intensivierte Landwirtschaft mit riesengroßen Monokulturen. Starker Pestizid- und Insektizid-Einsatz, was die Bienen dezimiert. Und für Westafrika haben wir das noch nicht ganz verstanden. Also, was ich habe: Wir sehen schon, dass, je nachdem, wie stark diese Landschaft gestört ist - Also je einfacher die wird, sagen wir es mal so - je mehr Felder mann hat, je homogener die Landwirtschaft wird, sehen wir, dass einige Arten sind Gewinner, wie zum Beispiel diese ganz winzigen, stachellosen Bienen. Die leben auch gerne in Häusern, sind nicht wählerisch, was die Nahrung angeht. Aber wir sehen das einige spezialisierte Bienenarten schon fehlen. Also, da gibt es auf jeden Fall große Effekte und wir sind jetzt dabei - oder meine Kollegen vor Ort - seit einigen Jahren. Wir machen Netzwerkanalysen, das heißt, wir schauen, welche Pflanze oder welche Baumart, Bäume und Sträucher wird besucht von welcher Bienenart? Da sind wir gerade dabei. Das ist unglaublich viel Arbeit und stundenlang im Feld zu sitzen. Es sind die Tropen. Da gibt es natürlich auch viele Mücken, die einen ärgern. Und wenn man Bienen beobachtet, darf man kein Repellent benutzen. Also man kann sich nicht einfach eindieseln und riecht nach Autan - funktioniert nicht. Es heißt, es ist wirklich aufwendig, und da sind wir gerade dabei. Wir haben jetzt schon eine große Liste: Welche Pflanzenart wird von wie vielen Bienenarten besucht? Was bieten die an? Bieten die Pollen und Nektar an? Und wann blühen die? Damit man eben auch das Nahrungsangebot über den Jahresverlauf irgendwann mal abdeckt. Genau die Frage, die wir noch nicht beantworten können. Da sind wir tatsächlich noch dran.
Mehlhorn: Ja danke für die Frage und danke für die Antwort. Dann war hier vorne eine Frage.
Gast: Eigentlich habe ich zwei Fragen, die eine Frage ist: Wird diese Selbstbestäubung, kann man das als so eine Art Notbestäubung der Pflanzen sehen, wenn keine Bienen da sind? Also, dass die so zur Arterhaltung sich auf so eine Notbestäubung reduzieren? Und die andere Frage, die sich mir stellte, war: Gibt's schon wie bei uns - in Gewächshäusern und so was werden ja schon gezüchtete Insekten eingesetzt, um bestimmte Bestäubung oder auch gegen Schädlinge, Schädlingsfeinde sozusagen einzusetzen. Gibt es so was schon in Afrika?
Stein: Okay, dann sage ich erst mal vielen Dank. Ich beantworte erst einmal Frage eins, ob Selbstbestäubung für die Pflanze, ähm, ja eine Notlösung sein könnte. Und es ist tatsächlich so. Also Inzucht - Selbstbestäubung führt zu Inzucht, das wissen Sie ja alle, denke ich - ist natürlich evolutionär gesehen nicht der goldene Weg. Aber es ist eine Möglichkeit. Das nennt sich reproductive assurance - also eine Art Reproduktionssicherung. Also wenn gar nichts klappt, dann hat man immer noch wenigstens die Selbstbestäubung, um eben Saatgut zu machen. Das sehen wir auch in den alpinen Gebieten, wenn die Winter sehr hart sind oder wenn es einfach ... der Sommer ist misslungen, es regnet, es kam keiner vorbei quasi. Dann ist wenigstens die Selbstbestäubung noch diese Versicherung, dieses Hintertürchen, die sie haben. Also das ist eigentlich bekannt und wird aber tatsächlich auch nur als so eine Art, ja Hintertür angesehen. Zumindest im evolutionären Sinne konnte man das nicht anders einordnen.
Und zur zweiten Frage: Natürlich hier... Es gibt ja viele, viele Nützlinge - Bestäuber und eben auch Prädatoren, also zum Beispiel Marienkäfer und Wespen, die man in den Gärten, in so Glashäusern... Schlupfwespen, was man so einsetzt, um das irgendwie ökologisch diese Schädlingskontrolle zu betreiben. Für West-Afrika weiß ich es nicht, weil dort eigentlich nicht im großen Stil unter - in Glashäusern stattfindet. Das ist alles, was ich weiß. Es ist unter freiem Himmel. Auch andere Cash-Crops. Unten im Süden hat man dann ganz viel Kakao, an der Elfenbeinküste. Sie haben Cashew, aber da ist, das ist alles draußen. Und deswegen versuche ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit Wissenschaftlern vor Ort, auch mit Entwicklungszusammenarbeit eben die Menschen zu sensibilisieren. So gut es geht eben diese Habitate zu erhalten, damit sie die Leistungen erhalten. Aber ich weiß hier in Deutschland hat man natürlich - also man kauft natürlich Bestäuber ein. Also Hummeln im großen Stil für Erdbeeren zu
Gast: Ja für Erdbeeren, dass die Erdbeeren ja auch Fremdbestäubung größer werden,
Stein: Genau, also selbstbestäubte sind so deformiert und klein. Und der Markt zahlt halt für ne pralle, perfekte Erdbeere. Und je mehr Bestäubung und auch - das ist lustig: Es ist nicht nur, dass irgendwie Bestäubung stattfand, sondern es geht sogar darum - das haben Kollegen aus Würzburg von mir rausgefunden: Es geht um die Kombination. Welche Biene an der Erdbeerblüte war. Also nicht nur einmal, sondern das waren drei, vier, fünf. Ich weiß nicht, wie viele Masterarbeiten das geworden sind. Aber auch die Kombination von Bienenarten haben dann am Ende die perfekte Erdbeere gemacht. Deswegen, dieser Input, dass tatsächlich die Bestäuber einzukaufen und in die Glashäuser reinzubringen, das rentiert sich wirtschaftlich trotz aller Mühe.
Mehlhorn: Ja danke für die Frage. Hier gibt es eine weitere Frage?
Gast: Es gibt ja diese schwedische Bestsellerautorin Maja Lunde, die auch über Bienen geschrieben hat. Mich interessiert - da geht es ja speziell um die Frage des Bienensterbens - Das ist ja eigentlich eine Publikation, die versucht, die Menschen darauf hinzuweisen. Mich interessiert jetzt mal, wie aus wissenschaftlicher Sicht, sagen wir mal, diese Publikation bewertet wird.
Stein: Ich kenne die leider nicht. Es wird aber sehr, sehr viel über Insektensterben publiziert. War das eine wissenschaftliche Publikation? Oder war das so ein...?
Gast: Sie ist eine Autorin mit gewissen biologischen Hintergrund. Aber sie ist keine Wissenschaftlerin mit dem Sinne. Sie ist eine Romanautorin eigentlich.Hat monatelang auf der Bestsellerliste ganz oben gestanden.
Stein: Ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, das zu lesen. Aber es ging wahrscheinlich um die Honigbiene, also um die westliche Honigbiene. Das ist immer ja, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Wildbienen, die höchste bedroht sind, die unseren Schutz vielmehr bräuchten als die westliche Honigbiene. Die wird gemanagt. Die hat natürlich viele Probleme. Wir wissen alle: also Pilze, Bakterien, die Varroa-Milbe und so weiter; Neonicotinoide, die Pflanzenschutzmittel, die da neurologische Störungen machen. Das ist alles wahr. Aber die Honigbiene, würde ich nicht als bedrohte Art dieser Welt einordnen. Die ist gemanagt, die wird gepampert, die wird mit Medikamenten verfüttert, also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Machen Sie sich Sorgen um die ganzen Wildbienen, die keine Lobby haben und die die wichtigeren Bestäuber sind und die am meisten bedroht sind. Das wäre eine Stellungnahme, ohne das tatsächlich zu kennen, was die Maja Lunde geschrieben hat.
Gast: Welche Chancen haben Sie denn, dass ihre Forschungen auch wahrgenommen werden? Dort vor Ort?
Stein: Sind Sie von der DFG zufällig? Nein, neider nicht. (lacht) Nee, also das Problem ist... also vor Ort wahrgenommen werden wir. Das war ein großes Anliegen. Ich habe erstens - oder wir in unserem großen Projekt - wir haben ausschließlich afrikanische Doktorandinnen und Doktoranden gefördert, damit wir eben - das nennt Capacity Building - damit wir eben das Wissen dort aufbauen, damit das dort weitergetragen wird. Und wir haben unsere Ergebnisse an unsere Bauern natürlich kommuniziert in den lokalen Sprachen. In Burkina allein sind es 60 lokale Sprachen. Ähm, damit wir wenigstens etwas zurückgeben. Und wir haben natürlich Berichte angefertigt und den Ministerien gegeben. Und wir sind auf Konferenzen tätig. Was jetzt der nächste schöne Schritt wäre, wenn wir Förderung hätten, die wir zurzeit nicht haben: Wir wollten Booklets machen, also kleine Informationsbroschüren. "Mein Freund der Bestäuber" - da gibt es ein tolles Buch in Kenia und so was wollten wir für Westafrika machen. Ganz einfach erklärt. Das ist: Comics. 80 Prozent der Leute sind alliterat und damit die, auch wenn sie nicht lesen können, das einfach verstehen können. Da habe ich Kollegen, die haben auf Madagaskar Comics entwickelt, mit den Leuten zusammen. Wenn da der Baum falsch gezeichnet war oder die falsche Farbe hatte, haben die das absolut nicht akzeptiert. Es musste wirklich so sein, wie es eben dort ist. Und dann, mit diesen Comics kann man halt viel Wissen verbreiten auf einfache, spielerische Art und Weise. Also uns fehlt tatsächlich die Finanzierung, um diesen Wissenstransfer vor Ort zu machen. Aber wir waren in den Schulen auch und haben kleine Workshops gemacht. Wie nachhaltig das jetzt ist bei solchen kurzfristigen Sachen, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist uns bewusst. Und da sehe ich auch großen Handlungsbedarf tatsächlich.
Gast: Das ist alles sehr interessant und spannend. Vielen Dank. Sie sagten gerade, um die Wildbienen sollten wir uns Sorgen machen. Haben Sie jetzt für uns praktisch Handlungsempfehlungen zu geben, was wir tun können?
Stein: Ja, tatsächlich. Also, das habe nicht nur ich, sondern da gibt es ganz, ganz tolle Broschüren. Also nicht nur die botanischen Gärten publizieren das, auch der Nabu zum Beispiel. Was Sie als erstes machen können, wenn sie ein bisschen Grün haben. Nehmen Sie einfach mal ... bauen Sie bienenfreundliche Pflanzen an. Lokales Saatgut, keine gefüllten Blüten, damit eben noch Pollen drin ist und nicht nur einfach es schön aussieht, wo die Biene aber nix mehr findet. Lassen Sie einfach mal eine Ecke ein bisschen wüst in Ihrem Garten. Also wenn der Nachbar motzt, dass Sie zu faul wären, sagen Sie einfach: "Ich mache hier Insektenschutz aktiv". Weniger mähen, also Mahd reduzieren und einfach eine Totholz-Ecke mal lassen, das sind Nisthabitate. Oder lassen Sie auch mal eine Brennessel stehen, damit man eben auch Nahrungsspezialisten, auch Schmetterlinge zum Beispiel, unterstützt - jetzt nicht nur an Biene gedacht. Und wenn man kann, einfach mal nicht so viel Boden versiegeln, zum Beispiel. Na also, dass sie sich ... weil der Großteil der Wildbienen sind Bodennister: 75 Prozent nisten im Boden. Und da einfach - da hat der Botanische Garten auch toll mit Sand und Lehmmischung und auch viele Erfahrungen gemacht, was zusammen rieselt wieder und was klappt. Aber einfach mal so ein bisschen wegschauen und Mal machen lassen. Das sind einfache Sachen, die kosten wenig. Und auch der Botanische Garten hat Saatgutpäckchen hier. Ich werde dafür nicht bezahlt, hier Werbung zu machen. Aber es ist einfach nur: Da wissen Sie, was sie haben, und es ist so einfach und da können Sie ganz, ganz viel leisten schon für die Wildbienen mit wenig Aufwand und vor allen Dingen wenig monetären Input.
Ditsch: Vielleicht kann ich da vonseiten des Botanischen Gartens noch etwas anfügen. Ein ganz wichtiger Punkt wäre auch, beim Mähen darauf zu achten, nicht die ganze Wiese auf einmal, weil damit natürlich dann auch komplett in dem Moment sämtliche Futterpflanzen auf eins weg sind. Also die Insektenkundler empfehlen schon Streifenmahd, dass man sozusagen seine Wiese in zwei oder drei längst gerichtete Streifen aufteilt und die sozusagen immer mit so 4wöchigem Abstand etwa mäht, sodass die Tiere praktisch dann von der gemähten Fläche immer noch auf eine noch intakte überspringen oder übergehen können. Und ein zweiter Hinweis dazu: Wir haben zum Thema Wildbienen hier im Botanischen Garten einen Info-Pfad im Moment in Vorbereitung. Also kommen Sie einfach noch einmal in vier Wochen wieder. Da werden die Tafeln dann stecken. Und da sind zu verschiedensten Aspekten der heimischen Wildbienen interessante Informationen zusammengetragen.
Mehlhorn: Danke. Wir haben noch eine Frage, sehr gut.
Gast: Jetzt noch weiter zu den Wildbienen hier, zu den heimischen, wenn wir jetzt diese kleinen Habitat errichten würden im Garten, also irgendwelche Ecken, wo die Nahrung finden, inwieweit ist es ein Problem, dass die Habitate eventuell zu weit auseinander sind? Also inwieweit können die Bienen fliegen, um zur nächsten ein Futterpflanzen zu kommen? Muss da irgendwie minimal oder maximal zehn Meter dazwischen sein? Oder was für Distanzen sind das?
Stein: Auch eine sehr, sehr gute und sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Quintessenz ist, je kleiner man ist, desto weniger weit fliegt man. Das klingt doof, aber es ist eine wichtige Erkenntnis. Und bei diesen, was jetzt unsere heimischen Wildbienen für Distanzen schaffen, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es für die westliche Honigbiene und da ist bekannt, dass die gerne ungefähr in einem Ein-Kilometer-Radius bleiben von ihrem Stock. Aber wenn Sie eben eine größere Fläche haben, wo eben kein Rapsfeld zum Beispiel daneben steht, na, dann ist es ungefähr fünf Kilometer, maximal acht. Nun also das ist die Distanz, die die fliegen. Da sehe ich eigentlich weniger das Problem also von der Habitatfragmentierung. Also ich glaube, die Kerlchen, die Distanzen kriegen die locker hin, dass die von einem kleinen Garten zum nächsten - oder Barbara hast du da mehr...
Ditsch: Das kommt wirklich auf die Größe der Biene an. Die ganz Kleinen für die sind zwei 300 Meter schon ein Problem.
Stein: Und wenn dann Wind dazukommt, dann...
Ditsch: Ja, deswegen eben auch diese Geschichte mit dem abgestuften Mähen, damit einfach die nächste Futterpflanze nicht zu weit weg ist.
Stein: Aber das ist total artspezifisch. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob man das tatsächlich in Deutschland kennt - für die ganzen Wildbienenarten. Weiß ich tatsächlich nicht.
Ditsch: Wahrscheinlich nicht. Für einzelne wird es untersucht sein.
Börge: Danke für die Fragen. Haben Sie noch Fragen? Es wäre jetzt noch die Chance. Gerade haben wir die Wissenschaftlerin noch da. Vielleicht auch Fragen mehr noch zum tatsächlichen Forschungsgegenstand in Afrika? Noch eine Frage?
Gast: Ja, zur Methodik, wieviel Blüten wurden da zum Beispiel mit den Beuteln versehen, wieviel Stück waren das so?
Stein: Also wir haben verschieden... ist schwierig zu beantworten. Also für die Bestäubung-Experimente... Wir haben sechs verschiedener Bestäubungs-Treatments gemacht, also nicht nur Selbstung und Auskreuzung, ganz verschieden. Und da war Minimum immer 100 für ein Dorf. Und ich habe das halt wiederholt an drei verschiedenen Standorten, auch um diesen Land-, also die Nutzungsintensität reinzubekommen. Das heißt für, sagen wir mal pro Dorf also 600 Blüten. Und für die für die Effektivität zum Beispiel - also, dass wir wissen, welche Biene ist wie effektiv - haben wir 300 Blüten eingetütet. Das klingt wenig, aber das ist furchtbar aufwendig. Kann ich ganz kurz erklären. Also man geht den Tag zuvor übers Baumwollfeld zum Beispiel sucht eine Knospe, die am nächsten Tag geöffnet sein wird. Man weiß, dass dann irgendwann sehr, sehr gut. Das wird dann eben in diesen Betäubungsbeutel eingepackt. Markiert. Weil das ist gar nicht so einfach, so eine markierte Blüte auf so einem grünen Baumwollfeld wiederzufinden am nächsten Tag. Und am nächsten Morgen, wie gesagt, um sechs Uhr 30 ungefähr, geht man eben dorthin, sucht sich eine Knospe, wo man dann recht hatte. Die meisten sind dann leicht geöffnet, nimmt den Beutel ab, geht dort ein Stückchen weg und stellt sich so lange hin, bis die erste Biene kommt. Und das kann Stunden dauern. Und auch da, wie gesagt, kein Mückenschutz oder so, man darf kein Perfum benutzen. Na also, Geruch ist für Bienen extrem wichtig. Also, man sollte so gut wie nicht da sein. Ich hatte auch Studenten dabei, die haben tolle Outdoor-Klamotten angehabt in knalle Rot - ist Quark. Na also, dann locken die... Das sind so Effekte - man muss quasi nicht da sein, so gut es geht. Also irgendwie Grün und nach nichts riechen am besten. Und dann wartet man, dass die erste Biene kommt. Dann haben wir immer die Blüte schnell zusammen gemacht, die Blütenblätter. Haben dann die Biene eingefangen. Dann haben wir die betäubt, und dann kamen die in Ethanol. Und dann wurde die Blüte wieder in diesen Beutel gepackt, damit keine zweite Biene rankommt. Das war jetzt nicht diese Forschung mit der Erdbeere. Das wäre auch wieder was Tolles. Einfach mal machen: Was ist denn, wenn zwei, drei kommen und vielleicht noch verschiedene Arten. Konnten wir alles nicht leisten. Aber Blüte wieder eingetütet, wieder markiert. Und dann ist es ganz oft auch passiert, dass bei diesem letzten Aspekt die Blüte abgebrochen ist. Bum, weg war se - dann alles verloren. Geht man zur nächsten Blüte. Und wir haben Tage gehabt - ich hab da mit meinen Feldassistenten im Feld gesessen - da haben wir in vier, fünf Stunden haben wir 20 Bienen gefangen. Und deswegen - 300 klingt wenig, aber da ist unglaublich viel Aufwand dahinter. Und dann wartet man, bis die Trockenzeit kommt. Im Oktober ist die Baumwolle reif, dann platzen die eben auf diese Kapseln und - was hier rumging - also kommen eben schön diese Fasern raus. Da sein müssen. Und da muss man wieder eher seien als Ziegen, Elefanten, Affen, Esel, Kinder, auch die Bauern, Feuer. Also man hat so viel Verlust, weil alles, was ich am Ende brauche, ist diese Frucht. Wenn die mir verloren geht, hab ich die ganze Vegetationsperiode für umsonst gearbeitet. So viel zu unserer Sample size, zum Stichprobenumfang. Klingt wenig, aber da steckt viel dahinter.
Mehlhorn: Ja, danke für die Frage und für die unglaublich aufwendige Forschung. Hier ist noch eine Frage.
Gast: Ich hab nochmal eine Zusatzfrage eigentlich. Mich interessiert, weil sie gerade noch einmal die Bauern erwähnt hatten, wie haben denn die Bauern, sagen wir mal, Ihre Forschungsarbeiten begleitet. Also es gibt ja ein relativ breites Vorurteil gegen Wissenschaft. Wir erleben das ja gerade bei uns mit der Pandemie in einem ganz anderen Feld. Wo ja doch, also auch mit Argusaugen „Das ist alles falsch“. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch bei Bauern – also ich will da niemandem zu nahe treten - aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine gewisse Reserviertheit besteht. Sind Sie ernst genommen worden? Haben Sie den Eindruck, dass das doch mit wirklichem Interesse verfolgt wurde? Gab es auch eventuell etwas hämische Bemerkungen? Oder ging es doch relativ gut zu? Also, dass sie ordentlich arbeiten konnten und nicht behindert worden sind, auch durch solche Bemerkungen vielleicht.
Stein: Gut, dann muss ich, glaub ich, mal ganz kurz das Prozedere beschreiben, wie es ist, wenn man in Westafrika arbeitet. Man kann nicht einfach wie in Deutschland irgendwo hingehen und sagen: „Schönen guten Tag, hier bin ich. Ich mache jetzt meine Forschung.“ Diese Felder gehören entweder dem Dorf oder dem Dorfvorsteher - also da gibt es verschiedene Besitzregelungen - und das Allererste, was man macht, ist mit einem Übersetzer natürlich - also ich habe irgendwie versucht, Französisch zu reden und der Übersetzer hat das dann in die lokale Sprache übersetzt. Das erste, was man macht, ist, man verabredet sich und dann sitzt man dort mit den Dorfältesten und mit den Männern - alles Männer - je nachdem, wo also ja... unter einem Mangobaum und auf solchen kleinen Holzschemeln - so kleine Holzschemel, wo so ein halber Hintern draufpasst ehrlich gesagt. Und dann sitzt man dort stundenlang und erzählt erst mal, wer man ist und was man macht. Wenn dann der Übersetzer eben das dann irgendwie übersetzt, sitzt man halt grinsend daneben und hofft nur, dass er das irgendwie erklärt und kann halt nicht viel.... Irgendwie: Man kann nur hoffen. Man wird halt auch beäugt, na also, man ist dann halt wirklich... Viele Kinder die ersten, vielen Wochen sind schreiend weggerannt, wenn sie mich gesehen haben. Na also, wenn die Langnase kommt und dann auch noch weiß. Und haben sich dann aber daran gewöhnt. Also es ist ein langer Prozess, um Vertrauen zu gewinnen. Und dann haben wir aber auch ganz, ganz eng zusammengearbeitet. Und ohne diese Bauern vor Ort hätten wir unsere Forschung nicht durchführen können. Es war ganz, ganz toll. Die haben uns unterstützt. Die kamen immer auch, und manche haben auch direkte Bedarfe signalisiert. Ich habe ja nun zur Bestäubung gearbeitet. Anderen Bauern war ganz wichtig: Es gibt ja viele Schädlinge, die ihn da die Ernte zerstört haben. Dann kamen sie an: Mach mal hier was dagegen bitte. Find mal raus! Und ich sage, puh, tschuldigung, ich gucke mir jetzt erst mal nur die Biene an. Aber also das war eine exzellente Zusammenarbeit. Und ich werde tatsächlich immer noch angerufen, alle paar Monate mit der Frage, wann ich zurückkomme. Also, und die sind auch wenn sie vielleicht nicht lesen können, die sind so intelligent, die wissen genau, was Sache ist, und die haben mich auch angerufen. Ich habe dann, damit die nicht im Busch-Taxi einen Tag unterwegs sind, um mit mir zu reden -- Ist auch passiert: Auf einmal kam der Bauer zu meiner Feldstation. Er war ein Tag unterwegs, um mit mir zu sprechen! -- habe ich Handys besorgt - also solche kleinen Credits halt und dass die mich anrufen, wenn was ist. Ne und die haben mich bevor sie spritzen, haben sie mich immer angerufen, weil sie wussten, dann wenn die gespritzt haben – Pestizide -, dann haben wir die nächste Woche oder bis zum nächsten Regen keine Biene mehr gefangen. Damit wir auch nicht unnütz durch die Gegend.... Also wir haben ganz wunderbar zusammengearbeitet, und ich wüsste jetzt sofort, wo ich wieder hingehen kann und wo wir weitermachen könnten. Also das war super.
Mehlhorn: Vielen Dank für die Frage. Sehr interessante Geschichten, die du erzählen kannst aus Afrika. Noch weitere Fragen? Ja, dann, würde ich sagen: Vielen Dank, dass du hier warst! Wir haben angefangen mit Albert Einstein. Deswegen noch eine kurze Endbemerkung von mir einfach nur, um auszudrücken, wie mich das begeistert, dass man in der Botanik so unglaublich komplexe Systeme untersucht. In der Physik sucht man sich ja immer nur das Allereinfachste, und das allersimpelste Zeug raus, wo man es am besten sogar noch mathematisch beschreiben kann. Und mit der Botanik hat man Systeme, die man nie irgendwie vorhersehen kann. Aber trotzdem es ist dir gelungen, da belastbare Ergebnisse rauszuholen. Und das ist eine sehr, sehr große Leistung, die mit großem Aufwand zusammenhängt. Und deswegen wollte ich einfach nur noch mal Danke sagen. Und danke, dass du hier bei uns warst.
Stein: Dankeschön, vielen Dank für Ihr Interesse.
Diese Veranstaltung wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.
Das Quantenpendel - Prof. Michael Kobel
Prof. Michael Kobel vom Institut für Kern- und Teilchenphysik beschäftigt sich in seiner Forschung mit Neutrinos und anderen Elementarteilchen. Im Gespräch erklärt er, wie Physiker dem Beginn des Universums mit viel Geduld auf die Spur kommen, wie sein Arbeitsalltag als Forscher aussieht und darüber, was man eigentlich noch nicht weiß aber gerne herausfinden möchte.
Moderatorin, Lilith Diringer: Jetzt natürlich zu unserem Gast. Sie wurden gerade auch schon angekündigt: Professor Michael Kobel. Selbst habe ich erstmal ein Zitat gefunden von ihrerseits, und zwar: "Unsere Forschung ist ein Kulturgut, getrieben von der menschlichen Neugier, die wir alle innehaben. Und Kultur ist etwas, was nur lebt, wenn sie miteinander geteilt wird." Genau dafür sind wir heute da: Wir teilen Forschung, und dazu passt natürlich auch, dass sie Prorektor für Bildung der TU Dresden sind, also immer auch das Wissen, dass man forscht, auch weiterzugeben und didaktisch aufzubereiten. Wir sind super gespannt. Wir sehen hier auch schon vielversprechend ein Modell, auf das wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen werden. Sie selbst sind Teilchenphysiker und forschen über die fundamentale Ebene der Elementarteilchen und nicht mehr teilbare Grundbausteine des Universums. Also super spannend schon mal, als ich mich da so ein bisschen eingelesen hab. Und deshalb möchte ich auch gar nicht mehr lange Sie vorstellen, sondern das könnten Sie gerne jetzt einmal selbst tun und einen kurzen Input geben. Was hat es denn mit Ihrer Forschung auf sich? Was tun Sie den lieben langen Tag?
Prof. Kobel: Herzlichen Dank auch an Christoph, für die Einführung. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen, bisschen was über meine Forschung erzählen zu können. Ich selber bin seit 15 Jahren in Dresden, habe aber auch vorher schon Elementarteilchenforschung gemacht an verschiedenen Orten Europas. Das passiert mit großen Beschleunigern, wo wir die Teilchen, bekanntere wie Elektronen oder Protonen, auf sehr hohe Energien bringen. Das tun wir, um ganz nahe an die Entstehung des Universums ran zu kommen. Ganz am Anfang des Universums, vor 13,8 Milliarden Jahren, wie man jetzt weiß, ist Raum, das Universum, alle Elementarteilchen, alle Materie in einem großen - ja, ob es einen Knall war, ob es irgendjemand hören konnte, das weiß man nicht - Aber das, was man Big Bang nennt, hat vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden. Dass ist ungefähr dreimal so alt wie unsere Sonne alt ist. Und wir versuchen, möglichst nah ran zu kommen, im Nachstellen von Dingen, die passiert sind, von Prozessen, die passiert sind. Und wir kommen jetzt schon sehr nahe ran, nämlich eine Billionstelsekunde nach dem Big Bang. Eine Billionstelsekunde ist, kann man sich nicht mehr vorstellen. Das Licht schafft es gerade drei Haaresbreiten weit in so einer Billionstelsekunde, also sehr, sehr nah. Und die Prozesse stellen wir gerade an dem sogenannten Large Hadron Collider nach in Genf. Und da haben zum Beispiel die Elementarteilchen, Elektronen, die wir kennen, erst ihre Masse bekommen durch einen Mechanismus, den man Higgs-Mechanismus nennt, aber über den heute ich nicht reden will. Ich will heute hauptsächlich über Neutrinos reden, weil die sehr viel zu tun haben mit dem, was dann passiert ist. Es ist dann, das Universum hat sich ausgedehnt, hat sich abgekühlt in den Bruchteilen von Sekunden danach. Es gab noch keine Kernbausteine, wie wir sie heute kennen. Es gab so eine Suppe aus Teilchen, die wir Quarks und Gluonen nennen, das sogenannte Quark-Gluon-Plasma, was man als weiteren Aggregatzustand - nach fest, flüssig, gasförmig kann die Materie auch diesen Aggregatzustand einnehmen. Und aus diesem Quark-Gluon-Plasma sind dann die Kerne entstanden. Die Kern-Bausteine erst mal, wie wir sie heute kennen, Protonen und Neutronen. Das passierte ungefähr nach einer Mikrosekunde. Darunter kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, aber auch noch sehr kurz. Und dann hat es noch länger gebraucht, bis die sich zu den einfachen Kernen zusammenschließen konnten. Helium zum Beispiel war einer der ersten Kerne, die gebildet wurden, nach einigen Sekunden oder auch Minuten. Was aber auch währenddessen passiert ist - und da kommen das erste Mal vielleicht die Neutrinos ins Spiel - Wir wissen es noch nicht - Ist das eine Milliarde Mal mehr Materie da war, als wir heute im Universum haben. Es war nämlich nicht nur Materie vorhanden. Es war Antimaterie auch vorhanden. Und eigentlich sagen alle Gesetze der Physik: Es muss immer gleich viel Materie und Antimaterie entstehen. Antimaterie ist eigentlich dasselbe wie unsere bekannte Materie. Nur alle Ladungen sind umgedreht, sind entsprechend positiv oder negativ andersrum. Und wir könnten auch prinzipiell alle aus Antimaterie hergestellt sein. Dann würden wir im Anti-botanischen Garten sitzen und von nem Anti-Direktor begrüßt werden. Und das würde aber genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Wir würden es nicht merken, und es hätte sich eigentlich alles wieder vernichten müssen. Hat es aber nicht, weil ein Milliardstel Überschuss von Materie gegenüber Antimaterie ganz am Anfang entstanden ist. Und da könnten die Neutrinos mitgespielt haben, das wissen wir noch nicht. Und dann hat sich in den ersten Sekunden alles wieder in einer riesigen Vernichtungsschlacht vernichtet, und ein Milliardstel ist übriggeblieben. Und das ist das, was wir hier sehen. Sterne, Galaxien, Planeten, fast 3 Milliarden Jahre alte Gesteinsformationen, die hier auf diesem Planeten entstanden sind. Insofern passt dieser Ort wunderbar: 2,8, Milliarden Jahre alt. Und dann war es erst mal recht langweilig. Dann war unser Universum sehr undurchsichtig. Die Elektronen flogen noch rum, ungefähr ein Viertel war Helium. Dreiviertel war Wasserstoffkerne, und es musste erst für das Universum sehr kalt werden, nämlich 3000 Grad kalt. Ich habe vergessen zu sagen, wie heiß es war, als diese Billionstelsekunde: Da war es eine Billiarde Grad heiß. Das ist ungefähr so viele Male heißer als das Zentrum der Sonne, wie das Zentrum der Sonne von 0,1 Grad Kelvin am absoluten Nullpunkt weg ist. Also von da aus gesehen war die Sonne eiskalt, wenn es sie schon gegeben hätte. Und von diesen Billiarden Grad hat es sich dann nach 400.000 Jahren auf 3000 Grad abgekühlt. Das ist so die Temperatur von rot glühenden Eisen. Und dann konnten sich endlich Atome bilden, Atomhüllen - die Atomkerne haben die Elektronen eingefangen, und das Universum wurde auf einmal durchsichtig. Das war es vorher nicht. Und war sogar im sichtbaren Licht rot. Ist dann langsam abgekühlt, so ins Grün und Blau, und dann wurde es dunkel. Dann war es Infrarot, das hätten wir nicht mehr sehen können, wenn wir damals dagewesen wären. Und dann ist auch etwas ganz Seltsames passiert. Was, wo auch man gedacht hatte, dass die Neutrinos damit zu tun haben, dass sich diese Wasserstoff- und Heliumkerne so ein bisschen geklumpt haben, an bestimmten Orten angesammelt haben, dass sie Gaswolken gebildet haben. Und da wurden sie rein geholt durch dunkle Materie, von der wir nicht wissen, was es ist. Da dachte man erst, das seien die Neutrinos. Aber wir können diskutieren, warum sie es nicht sind oder nur ein kleiner Teil. Und dann sind die ersten Sterne entstanden. Dann sind Gasbälle entstanden, so wie unsere Sonne aus Wasserstoff und Helium. Und die waren im Zentrum so dicht, dass dann Kernfusion anfing. Und bei der Kernfusion, da sind jetzt wirklich die Neutrinos auch dabei, weil da wird Wasserstoff zu Helium gebrannt. Und da müssen sich Protonen in Neutronen umwandeln. Und das heißt, irgendwo müssen die positiven Ladungen weg in Form von Antielektronen und eben Neutrinos, die entstehen. Die Neutrinos sind die elektrisch neutralen Partner oder Geschwister der Elektronen. Ja, und das ist das, was wir heute hier haben. Die Sonne, scheint. Es ist jetzt die dritte Generation von Sternen. Also die Sonne ist nicht 13 Milliarden Jahre alt, die Sterne sind ungefähr hundert bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Die Sonne ist schon die dritte Generation. Auch alle Atome, aus denen wir - die schweren Elemente - aufgebaut sind, sind inzwischen schon in zwei Sterngenerationen gebacken worden und dann wieder ins Weltall geschleudert worden und dann hier irgendwann auf der Erde angekommen. Und jetzt sitzen wir hier und fragen uns, warum das alles so funktioniert #00:12:07-3#
Diringer: Super spannend, auf jeden Fall. Vielen Dank für die ist wirklich sehr, ja sehr prägnante Wrap-Up sozusagen. Eine Geschichte der Jahrmillionen. Vielleicht auch gerade da einhaken: Sie meinten jetzt schon häufiger das Ganze ist recht unvorstellbar. Und auch diese ganzen Sekündelchen. Und diese großen Mengen Grade, Minusgrade. Wie schaffen Sie es, sich da immer wieder was vorzustellen oder sich das zu versinnbildlichen innerhalb ihrer Forschung?
Prof. Kobel: Ich versuche, mir Vergleiche zu holen, dass man sich Entfernungen vergleicht, dass man sich, dass man sich - Alter ist schon sehr schwer zu fassen, weil wir können gar nicht in Millionen Milliarden von Jahren denken. Wir werden nur100 Jahre alt. Die Geschichtsschreibung hat vielleicht mit der Menschheit vor einigen 10.000 Jahren angefangen, aber alles andere ist schwierig. Aber diese Faktoren kann man sich immer mit - ich zumindest - mit Verhältnissen von Entfernungen vorstellen. Auch wenn ich mir die Größen von Atomen und Atomhülle vorstellen will, dann suche ich mir als Atomkern eine Erbse zum Beispiel und frag mich "Wie groß ist denn dann das ganze Atom? Und dann kommt so ungefähr ein Fußballfeld raus. Und dann kann ich mir vorstellen, wie winzig dieser Atomkern ist im Vergleich zum Ganzen Atom? Und entsprechend mache ich das mit den Temperaturen, dass ich mir Verhältnisse angucke, dass man, sich fragt wie viel heißer ist es denn als in der Sonne? Und die Sonne ist ja schon unvorstellbar heiß, und wenn es dann noch mal hundert Millionen Mal heißer ist als in der Sonne, dann ist es richtig heiß.
Diringer: Da sind wir ja mit, ich glaube, so angenehmen 26 Grad noch ganz gut im kühlen, aber auch sehr spannend. Also, ich glaube, alle werden jetzt am Essenstisch und im Fußballstadion an Quantenphysik denken. Auf jeden Fall sehr schöne, anschauliche Bilder. Und bevor wir zum anschaulichen Modell hier kommen, vielleicht noch eine kurze Überleitungsfrage, was Sie denn antreibt in ihrer Forschung? Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt im Alltag direkt Dinge daraus verwenden können oder dass Sie irgendetwas ja praktisch forschen, was wir dann direkt umsetzen, wie jetzt, wie auch immer der Corona-Impfstoff, deren sofort irgendwie da ist. Was treibt Sie denn da an? Und welche Anwendungsfelder gibt es denn konkret?
Kobel: Also mich selber treibt wirklich die Grundlagenforschung, die grundsätzlichen Fragen, an. Was finden die Gesetzmäßigkeiten, nach denen das funktioniert und auch das, was Einstein mal gefragt hat: Hätten, die auch anders aussehen können? Hätten die Naturgesetze anders sein können, ein anderes Universum rauskommen können? Oder ist das die einzige Art wie ein Universum entstehen kann. Davon sind wir noch weit entfernt. Dazu brauchen wir das, was man immer als diese mystische "Weltformel" an die Wand schreibt. Wir haben eine kleinere Weltformel, aber die beschreibt noch nicht bei weitem alles. Das treibt mich an, zu wissen, wie das entstanden ist und einfach, was Sie auch vorhin zitiert haben, diese Neugier, die man dann auch gerne mit anderen Menschen teilen will. Und es ist dann wie in anderen Forschungen auch: Es kommt irgendwann auch was Anwendbares raus, auch wenn man nicht... Es funktioniert, meistens auch viel besser. Also ich vergleiche es auch gern mit einem Feld das man düngen muss, bevor was wächst. Und Grundlagenforschung ist der Dünger für das Feld der Anwendung. Wenn wir den nicht haben, kann da nichts wachsen. Und wir wissen noch nicht, was wächst. Aber irgendwann wächst etwas. Und das war zum Beispiel mit der Antimaterie, die ja in den 90er-Jahren erst einmal völlig theoretisch postuliert wurde von Dirac. Keiner hat ihm geglaubt, aus purem mathematischen Gründen. Da hat er gesagt, da gibt es eine zweite mathematische Lösung, die muss doch auch in der Welt vorhanden sein. Und alle hatten gesagt: Das ist doch in Mathematik, das hat doch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und dann hat wirklich acht Jahre später Anderson das erste Antimaterie-Teilchen gefunden. Und dann hat es 50 Jahre gebraucht, bis die in der Anwendung war. Ist heute Alltag in der in der Medizin, heißt Positron-Emissions-Tomographie. Da verwendet man Dinge, die also... man nimmt in den Körper Positronen, also Antielektron-Strahle auf, die dann, wenn man sie so da anhängt, dass der Körper sie sehr gut verarbeiten kann, dahin transportiert werden, wo besonders viel Aktivität im Körper ist. Und dann kann man mit Teilchendetektoren sehen, wo sind die Stoffe hingewandert? Wo ist live gerade viel Aktivität. Organe untersuchen, insbesondere die Gehirnaktivität untersuchen. Man kann zugucken, wie das Gehirn gerade denkt, welche Gehirnregion aktiv ist, um auch Krankheiten im Gehirn zu heilen oder um eben zu gucken, wie überhaupt das Gehirn funktioniert. Da hat Dirac sicherlich nicht dran gedacht, als er vor fast hundert Jahren die Antimaterie postuliert hat.
Diringer: Also auf jeden Fall eine wichtige Relevanz, dann auch von der Grundlagenforschung. Ich würde erstmal noch sagen, wir gehen zu dem Modell über, und dann können wir die die Fragen mal sammeln, die sich bisher auch schon sicher aufgetan haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir es schön anschaulich auch in unsere Mikrofone sprechen, für jetzt diejenigen, die nur die Audiospur dann bekommen. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Und ich bin schon ganz gespannt was ist hier mit diesen Pendeln, die ich jetzt einfach mal so benennen würde, auf sich hat?
Kobel: Ich muss dann ein bisschen beschreiben, was man sieht. Also ich habe hier ein Pendel, nicht nur eins, sondern drei Pendel aufgebaut und auf den Pendeln, das kann man von hinten vielleicht nicht sehen, steht ein ein griechischer Buchstabe "My", mit einem kleinen anderen Buchstaben, unten im Satzkript. hier steht ein "E". Was heißt, dass dieses Neutrino, der Partner oder die Partnerin, das Partner, was auch immer es für ein Geschlecht hat, des Elektrons ist. Und es gibt dann auch, das ist was, was wir noch nicht verstanden haben, gibt alle Elementarteilchen, aus denen die Materie aufgebaut, ist in dreifacher Ausfertigung, in drei sogenannten Generationen, die sich im Wesentlichen nur durch die Masse unterscheiden. Es gibt also ein schweres Elektron, das heißt "Myon". Da hat vielleicht der eine oder die andere von ihnen schon davon gehört. Die entstehen ständig, - jetzt auch - in der Erdatmosphäre und fliegen auch ständig durch uns hindurch und sind ein Teil der natürlichen Strahlenbelastung, denen die Menschen ausgesetzt sind, diese Myonen. Und dann gibt es noch schwerere, die aber so kurz leben, dass sie sofort wieder verschwinden, die "Tauonen". Und zu jedem dieser Elektron-Geschwister gibt es ein Partner-Neutrino. Und das lustige und das Merkwürdige an Elementarteilchen ist - Und das hat in dem Fall, was mit Masse und mit diesem berühmten Higgs-Mechanismus zu tun ist, dass die sich ineinander umwandeln können. Also das ist was, was eigentlich eine Revolution ist im Denken. Was die Alchemisten im Mittelalter geträumt haben, dass man aus Eisen Gold machen kann, also, dass sich Stoffe ineinander umwandeln lassen. Und das hatte ich ja schon bei der Kernfusion in Sternen erzählt, dass da Neutronen, wenn man Helium machen will, aus Protonen entstehen. Und jetzt können eben auch Neutrinos sich ineinander umwandeln. Das hat man erst in den letzten 20 Jahren gemerkt, und das ist nur deshalb möglich, weil sie eine Masse haben. Und man kann eben interessanterweise aus der Tatsache, wie schnell sie sich ineinander umwandeln, ausrechnen, wie groß die Massen oder die Massenunterschiede sind. Und das ist eine Antwort auf die Frage schon die ich am Anfang hatte. Diese mystische, dunkle Materie, die überall im Universum ist, hat genau die Eigenschaft, die Neutrinos haben. Und als ich studiert hab, waren Neutrinos der heiße Kandidat und alle dachten, das wird die dunkle Materie sein, wir müssen nur deren Masse messen. Und jetzt haben wir gemessen, dass die einige hundert Mal zu leicht sind. Dass die Neutrinos, also so was wie ein Prozent der Dunklen Materie ausmachen. Aber dass wir den Rest nicht verstanden haben. Also viele offene Fragen. Und wie man draufgekommen ist, ist, dass man auf der Erde, wenn die Neutrinos in der Kernfusion in der Sonne entstehen, entstehen nur diese hier blau markierten Neutrinos und man weiß ungefähr - man weiß ja, wie hell die Sonne ist. Dann können Astrophysiker ausrechnen, wie viel Kerne sich da im Zentrum pro Sekunde verschmelzen müssen. Das heißt auch, wie viel Neutrinos da pro Sekunde rauskommen müssen. Sind höllisch viele, also pro Daumennagel pro Sekunde durchdringen uns 60 Milliarden Neutrinos, die praktisch nicht wechselwirken. In unserem Lebensalter wechselwirken vielleicht drei Neutrinos in unserem Körper. Ich habe schon zwei hinter mir dieses Jahr - es wechselwirkt das dritte, also so alle 20 Jahre eins. Und wenn man genügend lange wartet - es kommen ja genügend viele an - und genügend große Detektoren aufstellt, dann kann man schon so ein paar am Tag messen, und das hat ein sehr geduldiger Mensch versucht, in einer unterirdischen - Ich weiß gar nicht, was es für eine Mine war in Kanada - und der hat so ungefähr 1 pro Tag erwartet und hatte aber dann nur eins, alle drei Tage
gemessen. Und der Grund ist - und das kann ich jetzt mal vorführen - das habe ich jetzt hier mit Federn dargestellt, es entsteht - und dieser Pendelausschlag das ist diese quantenmechanische Amplitude - wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ein Neutrino zu finden? Es entsteht am Anfang das das blaue Neutrino in der Sonne. Aber nach einer Weile ist es weg. Nach einer Weile ist nur noch das grüne und das rote da. Und dieser Detektor, den dieser Physiker hatte, der war halt so aufgebaut, dass der nur das blaue messen konnte. Und wenn Sie jetzt die andere Hälfte halten - Ich hab’s es leider nicht anders als mit so einer Sichtblende - Wenn man wirklich nur auf das blaue sieht und guckt, wieviel kommen denn dann so pro Tag an, dann fehlen einfache welche und das liegt eben daran, dass das sich in die anderen umwandelt. Und dann konnte man ausrechnen, wie schnell sich das umgewandelt hat und wie schwer sie sind und konnten rausfinden, dass die nicht die dunkle Materie sind.
Diringer: Ganz kurz noch für die Audio Zuschauer noch mehr zum Modell. Wir sehen jetzt eben, dass das mittlere der Pendel schwingt und dadurch, dass sie mit den Federn mit dem Grünen und dem orangenen verbunden sind, eben hier auch mit in Schwingung geraten. Wir hatten jetzt gerade zwei Sichtblenden davorgehalten und haben eben nur das blaue gesehen. Und das wäre ja genau dann, dass der der Forscher, der Detektor sozusagen immer nur das blaue gemessen hat,
Kobel: Ja genau. Und das blaue ist eben - manchmal hat das einen Ausschlag, und wenn es einen Ausschlag hat, heißt es, man kann es messen. Aber manchmal hat es auch keinen Ausschlag und das heißt es hat sich in dem Moment in die beiden anderen umgewandelt. Und die fliegen dann komplett unmessbar durch den Detektor durch. Und drum misst man eben weniger als man ausgerechnet hat. Und dieser geduldige Mensch hat wirklich das 30 Jahre lang gemessen, jeden Tag oder alle drei Tage eins, bis er es genügend statistisch beweisen konnte. Auch das war eine Geschichte, erstmal haben viele gedacht na gut, dann haben sich die Sonnen-Theoretiker verrechnet. Aber es hat sich dann herausgestellt, es ist wirklich dieser Effekt. Und er hat dann den Nobelpreis dafür gekriegt.
Diringer: Da haben sich die 30 Jahre ja gelohnt. Sehr spannend auf jeden Fall, auch hier wieder. Und nachdem wir jetzt auch schon Einblicke in diese vielen einzelnen Teilchen hier auch schon schön bunt gezeigt und dargestellt bekommen haben, würde ich einmal in die Runde gucken und Sie auffordern: Welche Nachfragen gibt es? Welche Gedankengänge haben Sie auch? Das Mikrophon kommt gleich von da hinten an. Genau dann würde ich Sie bitten, erst mal kurz zu warten, bis das Mikro da ist. Sie schlängelt sich durch die Zuschauenden,
Gast: Wenn er nur das Blaue beobachtet hat. Und dann war es mal weg, dann war es mal wieder da. Warum hat er nicht das rote zusätzlich beobachtet und hat gesagt, wenn ich das blaue, das rote, - das grüne brauche ich nicht, denn das ganze System muss ja wahrscheinlich eine Einheit bilden, da ergibt sich das. Aber dann hätte ich wenigstens nicht solche Zeiten, wo ich nichts messe und ich weiß, was eigentlich los ist. Geht das prinzipiell nicht oder warum ist er gerade auf das Blaue gekommen?
Kobel: Eine sehr, sehr gute Frage, also sogar in zweifacher Hinsicht. In der Tat stimmt die Aussage, dass es genügt, zwei zu messen, weil es darf nichts verloren gehen, irgendeins muss da sein. Das ist genau das, was man machen kann. Aber sein Detektor konnte wirklich nur das blaue messen. Er hat einen riesigen Tank an ja so eine Art Reinigungsmittel gehabt, 300.000 Liter, in dem Chlor drin war. Und dieses Chlor, der Chloratomkern wurde durch das Neutrino umgewandelt in Argon, also in ein Edelgas und das passierte eben mit einem Atomkern alle drei Tage. Und es ist sowieso unvorstellbar, wie man in einem 380.000 Liter Tank findet, dass da ein Atomkern sich in Argon umgewandelt hat. Das ist eh schon einen Nobelpreis wert, dass es überhaupt funktioniert hat. Aber die zwei anderen, die können das nicht, weil die nicht - die Neutrinos, die aus der Sonne kommen, nicht die nötige Energie dazu haben, weil die müssen sich immer in ihr Partner-Teilchen umwandeln. Und dieses Elektron-Neutrino muss sich immer in ein Elektron umwandeln, wenn's im Chlor ein Proton in ein Neutron umwandelt. Und das Myon-Neutrino muss sich eben immer in ein Myon umwandeln. Nur ist dieses Myon jetzt 200 Mal schwerer als das Elektron. Das heißt, ich brauche 200 Mal höhere Energie. Und so viel Energie haben die Neutrinos nicht aus der Sonne. Das heißt mit dem Prozess ging es wirklich nur mit dem Elektron-Neutrino. Aber mit der Idee, die sie haben, hätten Sie, wenn es nicht schon jemand gemacht hätte, den 2ten Nobelpreis dann auch absahnen können. Es gab nämlich eine zweite Gruppe, die genau das gemacht hat, die gesagt hat: Ich konstruierenden anderen Detektor, der nicht nur das blaue, sondern auch das rote und das Grüne nachweisen kann. Nämlich einen großen Tank aus schwerem Wasser. Das ist also, wo ein Wasserstoff durch Deuterium - da ist einfach im Atomkern ein Neutron mit am Proton dran. Und die haben ich glaube fast das gesamte schwere Wasser der Welt zusammengeLIEHEN, wohlgemerkt nicht gekauft, das hätten sie gar nicht bezahlen können. Und haben dann, das kann man dann nämlich mit solchen anderen, die können das aufteilen in ein Proton und ein Neutron. Und dann hat man gemessen das wirklich hundert Prozent ankommen. Die Theorie der Sonne hat gestimmt. Es kommen genauso viele Neutrinos an, wie man ausgerechnet hab, nur eben zum Teil als Grüne und als rote. Und da gab es dann vor 15 Jahren den 2ten Nobelpreis,
Diringer: Also Fast-Nobelpreisträger hier im Publikum. Hier gab es auch noch eine Meldung.
Gast: Meine Frage reicht weiter zurück. Sie sprachen davon, dass Materie und Antimaterie sich vereinigt oder vernichtet hat. Wie ist die energetische Seite dieses Vorgangs?
Kobel: Da ist sehr viel Energie frei geworden am Ende, hauptsächlich in Form von Licht, also von Photonen und die fliegen noch heute durchs Weltall. Das ist das, was man die kosmische Hintergrundstrahlung nennt. Und das ist auch das Untersuchungsobjekt, aus dem man all das weiß, weil man eben mit Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung zurückgucken kann und auch gucken, wie intensiv kommt sie denn aus unterschiedlichen Richtungen. Da sieht man dann diese Dichte-Fluktuationen von 13,8 Milliarden Jahre alt, wo dann die Sterne entstanden sind und das ist - heute kommt natürlich alles Fernsehen digital aus der Steckdose - aber als man früher noch alle - noch analoge Fernsehapparate hatte, mit Antenne und so was und den Sender falsch eingestellt hat, sodass es rauschte, da ist wirklich zwei bis drei Prozent von diesem Rauschen ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die man da wohl mit dem eigenen Fernsehapparat messen konnte. Und die ist einfach noch da und ein total spannendes Untersuchungsobjekt,
Diringer: Vielen Dank nochmal für die Frage. Und da gibt es auch schon die nächste. Eine Reihe weiter hinten.
Gast: Dankeschön. Ja, meine Frage wäre - also es ist bisher super spannend - aber mich würde interessieren: Zum einen wie schnell ist der Erkenntnisprozess momentan. Also, wie schnell findet man da neue Erkenntnisse? Flacht das jetzt irgendwie auch langsam ab die Kurve. Und was macht ihr vielleicht auch gerade in Dresden? Also wir haben ja keinen großen Elektronenbeschleuniger oder so. Plant ihr da eher die Forschungsvorhaben? Und vielleicht noch eine dritte Frage, naja, zweieinhalb. Wie schaffst du es jetzt, mit deinem neuen Amt als Prorektor Bildung ja auch irgendwie den Bezug zur Forschung zu halten, weil ich denke, dass das ja nicht mehr so viel Platz und im Alltag haben wird.
Kobel: Das stimmt, da hast du recht. Ich kann mal mit der letzten anfangen. Ich habe glücklicherweise wie alle Prorektoren und Prorektorinnen eine Professurvertretung, also in meinem Fall einen jungen Nachwuchswissenschaftler, der die Gruppe übernommen hat und die Forschung weiterführt, solange ich Prorektor bin. Ich die gehe wirklich - ich schaffe es nicht häufiger - einmal pro Monat in unsere Gruppen-Meetings, um aktuell zu bleiben. Ich bin auch noch dabei in dem Experiment, indem ich bin, auch in sogenannten Editorial Boards zu sein - da war ich jetzt auch gerade - von Veröffentlichungen, die geschrieben werden, um einfach zu sehen, was macht mein Experiment und stell da mehr oder weniger kluge Fragen zu der Forschung, die die anderen machen. Und dann lese ich natürlich die Doktorarbeiten, die da rauskommen. Da freue ich mich schon auf drei, die vielleicht alle noch dieses Jahr fertig werden. Und so versuche ich da dran zu bleiben.
Das zweite ähm - das erste war: Wie schnell ist der Fortschritt? Das zweite war: Was machen wir in Dresden? In der Tat macht einer meiner Kollegen also die Professur für Kernphysik, Kai Zuber, macht Neutrinophysik und zwar auch speziell für Prozesse, die in der Sonne stattfinden. Er hat gerade auch mit seiner Kollaboration einen Preis gekriegt dafür, dass er einen 2ten Prozess der Energiegewinnung in der Sonne, der nur ein Prozent oder sogar weniger zur Energiegewinnung beiträgt, nachgewiesen hat, den man schon lange vermutet hatte. Funktioniert fast so wie im Auto der Katalysator, dass man diese Fusion von Wasserstoff zu Helium nicht macht, indem diese Wasserstoff und Protonen sich alle gemeinsam treffen müssen, sondern dass sie angelagert werden, an andere Kerne, sich an diesen anderen Kernen ein Helium bildet. Und was dann als fertiges Helium abgestoßen wird. Das ist der Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus, den Weizsäcker schon postuliert hatte. Der ist jetzt das erste Mal nachgewiesen. Und er guckt auch nach, äh, ganz lustigen Effekten in doppeltem Beta-Zerfall, aber den will ich jetzt nicht erklären. Ansonsten forschen wir eben, wie auch erwähnt wurde, an großen Beschleunigern, die woanders stehen. Das heißt ich habe - gut als Doktorand habe ich da gewohnt, wo der Beschleuniger war, nämlich in Hamburg, am Desy und habe da meine Doktorarbeit gemacht und wirklich auch jeden Tag am Detektor rumgeschraubt und an der Elektronik. Jetzt ist es so, dass wir mit 3000 Leuten einen Detektor gebaut haben, der in Genf steht, am CERN, und den betreiben wir auch mit - mit den Unis sind wir, wir sind knapp 40 Länder, 170 Unis, glaube ich, die an diesem Detektor beteiligt sind und das zu 3000 gemeinsam auswerten. Äh, das heißt, man kann diese großen Maschinen nicht in in jedem Uni-Ort bauen. Da gibt's ein, zwei, maximal drei Plätze in der Welt, wo das stattfindet. Und das machen einige von meinen Kollegen auch mit unterschiedlichem Forschungshintergrund.
Und das erste: Wie schnell ist der Fortschritt? Es ist eben immer relativ. Also für uns gesehen... Von außerhalb ist der Fortschritt in der Neutrino-Forschung gerade unglaublich schnell, weil innerhalb von 20 Jahren unglaublich viele Erkenntnisse herausgekommen sind. Aber man denkt wirklich in Jahrzehnten dabei. Also, dass man nächstes Jahr irgendetwas weiß, das ist hoffnungslos. Man muss viel Geduld haben und auch das, was ich selber forsche: Wirklich sagen zu können, das ist so, wie es vorhergesagt ist, das wird auch noch 20 Jahre benötigen. Wir haben jetzt den Prozess, den ich gesucht habe, nach zehn Jahren Forschung das erste Mal eine Handvoll von solchen Ereignissen gesehen und können jetzt sagen: "Ja, ihn gibt es." Aber ob die vorhergesagte Häufigkeit stimmt, wissen wir noch nicht. Und auch die Experimente, die wir betreiben - die immer so kostspielig vorkommen - die werden über viele Jahre betrieben. Der Detektor, an dem ich arbeite, ist - die ersten Ideen waren glaube ich schon in den 80er-Jahren wirklich konkret entwickelt. In den 90er-Jahren gebaut, in den Nullerjahren. Und dann wird er jetzt zwei bis drei Jahrzehnte lang in Betrieb sein. Mindestens zwei Jahrzehnte in Betrieb sein, vielleicht noch länger. Also Generationen von Physikern und Physikerin können da arbeiten.
Diringer: Auch die Jahrmilliarden, in denen wir ja auch schon denken, wo Sie meinen, Sie versuchen, so nahe wie möglich dran zu sein, obwohl es so eine unvorstellbare Zeit ist. Da sind ja dann die zehn oder die 30 Jahre, bei denen wir vorhin ja schon dran waren, bis dann der Nobelpreis erreicht wurde, doch eine sehr kurze Zeit. Aber trotzdem wünscht man sich ja hier und da natürlich auch schnelle Forschungserkenntnisse
Kobel: Es ist sehr selten, dass es in diesem Feld wirklich schnell geht. Weil die Technologie ist auch eine, die man nicht kaufen kann. Sondern auch die Detektoren müssen eben entwickelt werden, speziell für unsere Anwendungen. Was aber dann auch wieder diese berühmten Spin-Offs hat, weil wir hochpräzise hochempfindliche Detektoren entwickeln, die dann auch wieder woanders eingesetzt werden können. Zum Beispiel auch bei Röntgenaufnahmen beim Arzt, sodass man vielleicht auch die Röntgen-Dosis, die man abkriegt, die Strahlungsdosis vermindern kann, wenn man die Strahlung mit empfindlicheren Detektoren messen kann. All das sind so Dinge, die dann wirklich in die Anwendung - ganz nebenher hat dann jemand eine Idee: "Ach, könnte man das nicht auch beim Röntgen einsetzen?" Und schon hat man wieder eine Anwendung.
Diringer: Hier auch noch mal die Frage in die Runde, ob sich da noch mal Nachfragen ergeben haben. Da ist direkt eine.
Gast: Ich hab eine Frage, und zwar bezogen auf die Detektoren. Man hat ja zum Beispiel ATLAS oder den CMS. Die suchen ja nach relativ allem, was sie finden können. Und ich frage mich, wie viel ist da noch? Also erwartet man jetzt noch neue Grundbausteine? Oder denkt man, das Modell ist jetzt so, wie es ist, erst mal relativ abgeschlossen?
Kobel: Das ist eine sehr gute Frage. Was man wusste, was da irgendetwas ist, ist, dass die, das hatte ich kurz erwähnt, diesen Higgs-Mechanismus, dass es einen Mechanismus gibt. Oder man sollte vielleicht Brout-Englert-Higgs-Mechanismus sagen, weil die Idee kam mindestens von dreien. Das Higgs-Teilchen wurde von Herrn Higgs vorhergesagt, dass da irgendwas sein muss, was die Masse der Teilchen, also zum Beispiel die Masse des Elektrons macht. Das wusste man, und man wusste, dass dieser Mechanismus bei Energien stattfindet, die man mit dem Atlas und CMS Experiment hatte oder geplant hatte. Das heißt, es war einer der wenigen Fälle, wo man wusste, man wird irgendetwas finden. Man wusste nicht, ob es dieses Brout-Engler-Higgs-Modell ist, das war das populärste, das war das einfachste. Man hat 50-Jahre lang gesucht, aber es hätte auch was ganz anderes sein können. Aber man wusste, es passiert bei dieser Energie. Und dann hat man in der Tat das Higgs-Boson gefunden. Und es war doch das, was Higgs und Kollegen sich ausgedacht hatten. Bei anderen Dingen ist man - also man weiß zum Beispiel, hatte ich vorhin erwähnt, es gibt dunkle Materie, und man weiß inzwischen auch, das müssen irgendwelche Teilchen sein. Das sind also keine Planeten, die da irgendwo rum schwirren. Es gibt noch ein paar, die postulieren jetzt "vielleicht sind es ganz am Anfang entstandene kleine oder nicht so kleine Schwarze Löcher, die irgendwo rumfliegen". Aber das ist alles sehr unwahrscheinlich. Es ist es sind aller Wahrscheinlichkeit nach Elementarteilchen, die die Eigenschaften von Neutrinos haben. Nur die Neutrinos sind es nicht, das weiß man jetzt. Und das muss man irgendwann finden, das muss ja irgendwie DA sein. Oder - ich nehme es ein bisschen zurück - wenn sie genau dieselbe sogenannte schwache Wechselwirkung machen wie die die Neutrinos, dann wird man sie auch finden. Wenn man Pech hat, macht diese dunkle Materie nur Gravitation als Wechselwirkung. Und dann wird es richtig schwer. Also dann wage ich zu sagen, dass man die auch in 500 Jahren noch nicht gefunden haben wird, weil dann einfach - auf Teilchen-Niveau ist Gravitation so schwach, dass man deren Effekte nicht messen kann. Da braucht man schon so eine Erde, wo man dann merkt hier ist was, was einen anzieht. Und das ist eine offene Frage.
Die andere offene Frage ist, warum da drei Pendel sind. Unsere Theorie sagt das nicht vorher. Unsere Theorie kann wunderbar beschreiben, wie die Wechselwirkungen dieser Teilchen miteinander sind. Welche Kräfte da wirken, welche Umwandlungen wie häufig stattfinden, das kann man alles auf Promille genau vorhersagen. Aber warum es gerade drei gibt und warum gerade die und warum die nicht noch einen dritten Partner und Geschwister haben? Keine Ahnung. Und es ist auch so - dieser Aufbau dieser Pendel habe ich ganz ähnlich wie die sozusagen miteinander wechselwirken, habe ich so aufgebaut, wie es in der Natur auch ist. Und man sieht, da ist eine gewisse Symmetrie dahinter, weil auch die Federn sind - also das ist spiegelsymmetrisch zum Beispiel, wie man sieht. Der Aufbau, diese Symmetrie ist auch unverstanden. Und natürlich, die große Frage: Wo ist die Antimaterie hin? Warum ist sie verschwunden? Machen Antineutrinos ein bisschen was anderes als Neutrinos? Das will man wissen. Also viele offene Fragen noch die ganz zum Anfang zurückweisen. Ob der LHC und dieses Atlas- und CMS-Experiment, die klären wird, das weiß man nicht. Man plant jetzt schon einen nächsten Beschleuniger. Man weiß zum Beispiel noch nicht, wie diese Higgs-Teilchen miteinander wechselwirken. Das ist das nächste, was vorhergesagt wird, aber man noch nicht messen kann. Man weiß wie ein Higgs-Teilchen mit einem Elektron und - nagut, mit dem Elektro noch nicht - aber zumindest mit den anderen, mit den Top-Quarks und den Myonen wechselwirkt. Das hat man alles gemessen. Und das stimmt alles. Aber wieso zwei Higgs-Teilchen miteinander wechselwirken, das würde man auch gerne messen. Und da könnten ganz fundamentale Sachen rauskommen. Da könnte vielleicht rauskommen, dass wir in gar keinem stabilen Universum leben, sondern dass dieses Universum nur gerade glücklicherweise im einen Energie-Minimum ist und sich vielleicht irgendwann in ein anderes Energie-Minimum begibt, mit einer Lebensdauer von zehn hoch hundert Jahren, die uns keine Sorgen machen muss. Aber auch das ist schon wieder spannend, wo man sich fragt, ja, ist sozusagen das Ende unseres Universums schon klar durch solche Sachen. Das sind Fragen, die uns alle bewegen: Wo geht es hin? Wo kam es her?
Diringer: Also für alle im Publikum noch viel Potenzial für Mitforscher und Mitforscherinnen, wie ich hier höre. Hier auch noch mal so ein bisschen von meiner Seite: Die Forschung ist ja das eine Thema, das andere: Prorektor Bildung. Didaktisch sind sie da ja auch sehr gut aufgestellt. Sie haben auch gleich ein Modell mitgebracht. Ich habe gehört, dass sie sogar noch ein größeres Modell gerne mit dabeihätten. So dass es da auch vieles gibt zum Anschaulichmachen. Können Sie vielleicht dazu auch noch ein paar Worte verlieren? Wie kann man solche tiefe Forschung, in der man jahrelang steckt, wirklich auch der Außenwelt kommunizieren, jetzt auch in Formaten wie diesen? Was haben Sie da so bisher miterleben können?
Kobel: Ja, ich habe da so vor 20 Jahren ungefähr angefangen, weil es mir, äh, sehr schade vorkam, dass von dieser Forschung so wenig in der Schule ankam, all die Theorien von diesen Wechselwirkungen, von den Neutrinos - zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Das war Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts abgeschlossen. Das ist das, was wir das Standard-Modell der Teilchenphysik nennen, also weit mehr als ein Modell. Das ist die beste Theorie, die die Menschheit je hatte, über wie der Mikrokosmos funktioniert und - 73 war das fertig. Und ich hatte das Glück, einen Physik-Leistungskurs-Lehrer zu haben, der mir was von Quarks gesagt hat. Im Schulbuch stand da nix drin. Und heute noch ist da ganz wenig drin. Und wir sind 50 Jahre danach. Und das hat mich dann irgendwann so geärgert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt raus aus dem Campus in die Schulen. Wir müssen überlegen, was wir machen. Und wir haben dann mit Kollegen aus Großbritannien, Vereintem Königreich ein Format aufgestellt, was Masterclasses heißt und was es auch heute noch gibt. Und was wir hier in Dresden nicht nur national, sondern weltweit leiten, wo wir unsere Daten der Bevölkerung, insbesondere jungen Menschen in der Schule, zur Verfügung stellen und zwar so aufbereitet, dass sie eigene Messungen machen können. Das heißt sie erleben für einen Tag: Was heißt Wissenschaftler an so einem Experiment zu sein oder Wissenschaftlerin. Und sind dann auch unter Anleitung von unseren Masterstudierenden, von unseren Promovierenden. Also, da kommen junge Wissenschaftler:innen in die Schule und erklären mal, was sie machen. So als Rollenvorbild. Was macht man denn heute so als Physiker:in? Und das ist schon mal das erste, wo man in Verbindung kommt und denkt: Oh, wär vielleicht was für mich. Und selbst wenn man denkt: Ist nix für mich - kann man sagen: "Aber faszinierend ist es trotzdem." Und dann gibt es vielleicht auch mal - sitzt man, wenn man Politiker oder Politikerin geworden ist, im Forschungsausschuss im Bundestag und hört, ob diese Forschung vielleicht sinnvoll ist und ob die gefördert werden sollte. Und es haben einfach alle - wie Sie sagten: Für mich ist es ein Kulturgut, so wie ein Orchester oder wie eine Theater-Truppe. Ich bin absolut fasziniert von dem, was wir da finden. Aber, wenn eine Theatertruppe immer nur fasziniert vom Stück ist und vor leeren Publikum spielt - oder ein Orchester - das will man auch nicht. Man will diese Faszination raustragen, man will auftreten, und das heißt nicht, dass jeder jetzt ein Musikvirtuose sein muss, der da im Publikum sitzt. Und hier im Publikum muss nicht jeder ein Physiker, Physikerin oder Mathematiker:in sein, der jetzt die Bewegungsgleichung dieser Pendel ausrechnen kann. Aber man kann sagen: Okay ist interessant. Und das ist das, was mich antreibt. Und das mache ich eben seit 20 Jahren in nationalen und internationalen sogenannten Masterclasses.
Diringer: Auch hier wieder eine superwichtige Relevanz auch für alle. Also bleiben Sie aktuell und up-to-date und gucken Sie was es hier noch für Bildungsveranstaltungen auch gibt. Wir sind leider schon relativ am Ende von der Veranstaltung. Fragen sehe ich teilweise gibt es noch im Publikum. Würde ich auch sehr anraten, danach noch hier vorzukommen, sich das Modell auch noch einmal genauer anzuschauen und natürlich auch auf Sie dann nochmal zuzukommen. Sie sind ja auch noch ein paar Minütchen da und, ähm, ja, entschwinden nicht sofort. Den Botanischen Garten entsprechend würde ich gerne als letzte Frage auch noch mal an Sie stellen. Sie hatten den internationalen Rahmen gerade auch schon angesprochen. Wie sieht es denn - ich sage jetzt mal weltweit - in dem Forschungsbereich in der Zukunft aus? Was können wir da vielleicht noch erwarten? Wie sind so die Nationen aufgestellt? Wo sollten wir unseren Blick hinwenden, wenn wir weiter ja in im Blick bleiben wollen, wie es jetzt weitergeht?
Kobel: Ja, es gibt - von den Forscherinnen und Forschern sind wir wirklich weltweit auf allen Kontinenten aktiv. Das Atlas-Experiment, was hier im Publikum erwähnt wurde, was in Genf steht, hat Institute aus 38 Ländern, die mitarbeiten. Die Personen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommen allerdings aus 92 Ländern, das heißt in 92 Ländern mindestens wird man ausgebildet, dass man auch an so einem Experiment arbeiten kann, auch wenn man im eigenen Land vielleicht keine Universität findet, die das macht, dann wechselt man als Doktorand irgendwohin, wo es ist. Und vielleicht tragen wir das ja dann auch in andere Länder. Die Gerätschaften sind in der Tat sehr konzentriert. Hamburg war ein großes Zentrum, geht jetzt mehr in Richtung Anwendungen der Teilchenbeschleuniger und weniger in die Teilchenbeschleuniger, also jedenfalls nicht mit Gerätschaften, die in Hamburg stehen. Die machen natürlich auch in Genf mit, und an anderen Orten der Welt. Die Japaner sind gerade in der Neutrino-Physik weltweit seit vielen Jahren sehr führend. Die Amerikaner haben im Fermi National Lab bei Chicago eine große Forschungseinrichtung, die sehr viel auch mit Antiprotonen geforscht haben, die jetzt dieses eigentlich alltägliche Myon erforschen, weil dessen magnetische Moment nicht so ganz stimmt, wie es vorhergesagt ist. Ist gerade durch die Presse gegangen. Arbeitet auch in Dresden ein Theorie-Kollege dran. Die Abweichung ist zwar nur ein Milliardstel, aber sie wird ernst genommen. Und das könnte so auch auf diese dunkle Materie hindeuten. Vielleicht findet man die indirekt im Magnetismus des Myons. Sehr spannend. Und das wird auch in die Richtung - würde es ja weitergehen. Ich kann fast vorhersagen - also glaube ich, vorhersagen zu können - was die nächste große Entdeckung sein wird, weil man da schon sehr weit ist. Vergleich wie verhalten sich Neutrinos und Antineutrinos. Verhalten die sich unterschiedlich oder verhalten die sich gleich? Und da wage ich zu sagen, dass vielleicht schon in fünf Jahren - aber spätestens am Ende der 20er-Jahre wird man das wissen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil man da vielleicht ein Hinweis kriegt, ob auch dieses kosmologische Antimaterie-Ungleichgewicht mit den Neutrinos zusammenhängt, das ist sozusagen ein Gewinn, ein Experiment-Ergebnis, was kommt - ganz sicher im nächsten Jahrzehnt. Die anderen, die wird diskutiert, haben: Keine Ahnung. Wann man Dunkle Materie nachweisen wird? Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht nie - je nachdem, was sie für Eigenschaften hat. Es ist das Wesen der Forschung, dass man nicht weiß, wann die Ergebnisse gekommen und dass man viel Geduld haben müssen.
Diringer: So haben wir trotzdem schon einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und die Glaskugel so ein bisschen für uns transparent dargestellt. Und entsprechend möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Bei ihnen, liebes Publikum. Wir haben uns von eine Billiarde Grad heißen Erzählungen entlanggehangelt über die Erklärung eines gewissen Anteils des Rauschens im Radio - das war für mich auch neu, dass man da auch so ein bisschen sagen kann: "Ach ja, das kommt jetzt durch die Hintergrundstrahlung". Auch sehr interessant. Wir haben einen ganz neuen Aggregatzustand kennengelernt. Also zumindest auch für mich - und viele andere vielleicht auch - einer, der noch nicht so bekannt war. Der eben noch nicht in der Schule, im Chemieunterricht gelehrt wird. Und sitzen tatsächlich noch im Botanischen Garten, der vielleicht aber auch der Anti-Botanische Garten ist. Wer weiß?! Ganz, ganz herzlichen Dank für ihre Beiträge. Für ihr Experiment. Ich möchte sie nun noch einmal auffordern: Kommen sie gerne mit ihren Rückfragen hier noch mal nach vorne. Schauen Sie sich hier das Modell noch an. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn sie bei der nächsten Veranstaltung sich wieder hier einfinden, um unter den Koniferen die Koryphäen kennenzulernen. Und entsprechend wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Genießen Sie die Sonne und bis zum nächsten Mal
Bäume in der Literatur - Dr. Solvejg Nitzke
Dr. Solvejg Nitzke vom Institut für Germanistik analysiert in ihrer Forschung Beziehungen von Bäumen und Menschen in Literatur und Kultur. „Botanik und Literatur sind für mich eng verknüpft“, erzählt die Wissenschaftlerin, „Die eine Seite kommt nicht mehr ohne die andere aus – man könnte von einer Symbiose sprechen“.
Diringer: Auch von meiner Seite aus noch mal ganz herzlich Willkommen. Ich bin Lilith Diringer, unter anderem auch Studierende oder Studentin an der TU Dresden und eben in „der bühne“ aktiv, dem Theater der TU und moderiere dort auch sehr viele Live- und Onlineformate , falls Sie oder Ihr da auch mal vorbeischauen möchtet. Aber heute geht es vor allem um unsere Gästin Solvejg Nitzke. Wir hatten uns auch im Voraus schon auf das „Du“ geeinigt, von daher dürft ihr das auch sehr gerne so übernehmen, auch dann nachher bei der Fragerunde. Es wird eben so sein, dass das ganze sehr offen gestaltet ist, das heißt, wir möchten viele Fragen von eurer Seite aus hier aufgreifen und diskutieren. Dennoch möchte ich einen kleinen Input einleiten von deiner Seite, um erst mal einen kleinen Überblick über deine Arbeit zu bekommen. Wie kam es denn dazu, wie hast du deinen Weg gefunden, was ist gerade so spannend, was du neues entdeckst jeden Tag. Überleiten möchte ich mit einem Zitat, das ich gefunden habe und sehr spannend fand, und zwar: „Wir leben in der Welt der Bäume, nicht umgekehrt.“ Was hat es denn damit auf sich und wie kannst du dazu?
Solvejg Nitzke: Ja vielen Dank erst mal, dass Sie alle da sind. Ich freue mich so sehr richtige Menschengesichter zu sehen und tatsächlich Adressat:innen für meine Worte vor mir zu haben und nicht irgendwie versetzt. Also diese Romantik bin ich noch nicht ganz los, dass es so schön ist manchmal. Was es damit auf sich hat, dass wir in einer Welt der Bäume leben, ist erstmal eine triviale Feststellung. Bäume sorgen - Bäume und alle anderen Pflanzen - für all das, was wir überhaupt zum Leben brauchen, d. h. ziemlich existenzielle Feststellung. Für eine Literaturwissenschaftlerin ist es aber durchaus eine, die auch – jetzt könnte ich natürlich die vielen Papierwitze machen, denn nicht zuletzt all das was, was ich für meine Arbeit brauche - Papier - und Tinte wurde lange auch aus Baumprodukten hergestellt. Also auch wir sind darauf angewiesen, aber das ist eine ziemlich weit reichende Feststellung für jemanden, die sich von Berufs wegen mit Literatur beschäftigt. Jetzt komme ich relativ schnell in die großen Fragen. Was ist denn eigentlich diese Literatur und wie kommt man eigentlich von da aus an den Punkt einem anfängt, etwas über Bäume zu sagen? Literatur im fast schon engeren Sinne müssten ja solche Dinge sein: Also, wir haben hier ein Buch - relativ viel Text drin und darauf steht Roman. Das ist für mich das einfachste womit ich arbeiten kann. Wenn da Roman draufsteht, darf ich davon ausgehe, dass sich jemand hingesetzt hat, eine Geschichte erfunden hat und ich damit leben kann, dass all die Dinge, die in dem Text sind, innerhalb dieses Textes eine Wirklichkeit beanspruchen, die nicht unbedingt mit der Wirklichkeit außerhalb übereinstimmen muss, d. h. in so einem Buch können Bäume sprechen und dann stimmt das auch. Also, ich gucke schon direkt rüber (lacht). Man nennt sowas Willing suspension of disbelief. Also wir einigen uns in dem Moment, in dem wir so einen Roman aufschlagen - vielleicht nicht direkt mit der Autor:in, aber zumindest sozusagen mit uns selbst - darauf, dass wir für die Zeit wir jetzt lesen, die Plausibilität, die innerhalb eines Textes hergestellt wird, annehmen. Jetzt bin ich sozusagen schon mittendrin, denn da können Dinge passieren, die außerhalb nicht passieren können. Wie gesagt, Bäume sprechen; manche Bücher erzählen auch von von herumlaufenden Bäumen. Das sind dann Dinge, die innerhalb dieser Erzählung funktionieren können, auch wenn wir eigentlich „wissen“ - ich mache Anführungsstriche (sag ich mal für die Aufnahme dazu) -, dass das ja ganz in echt gar nicht sein kann. Da hör ich aber mit Literatur nicht auf. Was mich interessiert und das kommt so ein bisschen auf deine Frage zurück, wie ich da eigentlich hingekommen bin, ist, wie das, was in Literatur sozusagen kein Problem ist - also, dass jemand anfängt eine Geschichte zu erzählen, die aufzuschreiben, dass die geformt ist, ja dass, man nicht am Anfang anfängt und in der Mitte weitermacht und am Schluss hört man auf. Sondern man kann Rückblenden machen. Vorblenden. Ja, man kann damit spielen, dass man gar nicht weiß, wer gerade erzählt. Und wir sind alle irgendwie eher bereit, in der Literatur uns darauf einzulassen. Und, das sollte ich vielleicht dazu sagen, damit meine ich jetzt nicht nur die sogenannte hohe Literatur, also nicht nur irgendwie Goethe und Schiller, sondern durchaus auch alles, was irgendwie dieses Label, zum Beispiel „Roman“ hat. Da sind wir irgendwie einverstanden mit dieser Art von Vertrag, die uns sagt, dass da dann Dinge passieren können, mit der wir arbeiten. So. Mich interessiert jetzt genau der Ort, wo das sozusagen ausfranzt, ja, wo entweder solche Romane für sich beanspruchen - nicht nur Romane, aber fiktionale Erzählungen zum Beispiel - beanspruchen, dass sie auch über Dinge sprechen, die in der Wirklichkeit passieren.
Stichwort: Science-Fiction. Ja da kommen dann plötzlich ganz viele wissenschaftliche Dinge vor.
Hier in „Betrunkenen Bäume“ passiert das auf eine ziemlich klassische Weise. Das ist Ada Dorians „Betrunkene Bäume“. Ich lass die Bücher hier auch nachher nochmal liegen, wenn sich jemand weiter dafür interessiert. Das ist eine Geschichte, die spielt sich zwischen einer jungen Frau, die von zu Hause abhaut, und einem seit Jahren pensionierten Forstwissenschaftler, bei dem man nicht so ganz sicher ist, ob er seinen Verstand verliert oder ob er eigentlich gerade erst so richtig tief in seiner Forschung ist. Das ist – so viel darf ich vielleicht sagen - auch im echten Leben bei Forschern nicht immer ganz deutlich trennbar, sondern immer so vom Ende her erst klar. Hier jedenfalls, und das nehme ich jetzt mal vorweg, es ist ein schönes Buch und eine der tollen Sachen, die hier passieren, ist die, dass dieser Wissenschaftler zu Forschungszwecken, aber auch, um sich zu umgeben mit dem, was er liebt, einen Wald in seinem eigenen Schlafzimmer anlegt. Und allein wie er versucht, das vor seiner Tochter, die eigentlich gern hätte, dass er langsam in ein Altersheim zieht, zu verbergen. Entspinnt Beziehungen zwischen diesen Menschen und den Bäumen, die für mich ganz interessant sind. Aber noch mal zurück zu der Frage, wo das sozusagen ins wirkliche Leben reicht. Dieser Wissenschaftler erklärt der jungen Frau relativ viel über die Forstwissenschaft, die er macht. So, und da kann man dann relativ gut sich hinsetzen, man könnte jetzt nachvollziehen, gibt es das wirklich? Gibt es die Wissenschaftler, auf die sich bezogen wird, stimmen diese Sachen? Diese betrunkenen Bäume sind welche, wo der Boden sich aufgelöst hat. Also, so steht‘s im Buch. Wo der Boden so weich geworden ist, dass die schief anfangen zu wachsen und dann in ganz seltsamen Formen. All das, woran wir sozusagen bei Bäumen als erstes denken, dieses gerade nach oben wachsen, nicht mehr stimmt. Und diese Eigensinnigkeit ist was, was mich interessiert. Um das sozusagen nochmal hervorzubringen.
Was ich also mache, ist weder mir anzuschauen, welche Bäume als Motiv irgendwo auftauchen. Das könnte ich wunderbar machen, irgendwie vom ersten Mal als jemand irgendwas aufgeschrieben hat, relativ bald, kam auch ein Baum vor. Bis jetzt. Ja, dann hätte ich so eine Kulturgeschichte, wie Alexander Demandt. Und dann kann man schöne Sachen sagen. Der Mann ist Historiker - ja das Schöne an Bäumen ist, dass man dann auch als Historiker endlich was gefunden hat, was sich nicht so viel bewegt.
Das ist nicht mein Ansatz bei Bäumen, sondern ich guck mir an, wo bestimmte Dinge die jetzt in Baumwissenschaften in Bewegung kommen, vor allem im öffentlichen Diskurs, in der Wissenschaftskommunikation dieser neueren Erkenntnisse oder dem, was sich vielleicht auch nicht etablieren wird, anfangen sozusagen zu verändern, was da überhaupt stattfinden kann. Und da komme ich tatsächlich sozusagen jetzt von meiner Wissenschaftsbiografie her aus der literarischen Katastrophenforschung über das Klima zu den Bäumen und frage mich eben immer genau - hier jetzt auch wie vorher schon - an welchen Stellen Literatur sozusagen Räume öffnet, um Wirklichkeit zu diskutieren. In genau diesem Modus, in dem etwas sein kann, was wir vielleicht noch nicht kennen. Das muss dann nicht heißen, dass wir etwas lernen aus der Literatur und hinterher ganz viel schlauer sind, sondern dass bestimmte Sachen verunsichert werden. Diese Verunsicherung ist was, was ich dann – das darf ich vielleicht in diesem Format auch sagen – für ein sehr produktives Format halte.
Was ich da konkret tue, jetzt und in den nächsten sagen wir mal zwei Jahren, ist dieses Buch und den Rest des Regals den ich zu Hause gelassen habe, weiterhin darauf zu untersuchen und auch noch ein Buch zu schreiben,
Diringer: Das klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube wir freuen uns alle schon auf die Ergebnisse dann im Buch oder auf das Zwischenfazit. Vielleicht schon mal so weit: Es ist es ja auch immer die Frage, wann ist jetzt ein Wald ein Wald, wann sind es nur einzelne Bäume. Ist das dann Definitionen, die in der Literaturwissenschaft, gefällt werden oder sind das tatsächlich forstwirtschaftliche Definitionen? Wo ist da also die Grenze zwischen „Was ist jetzt wie wahr“ und aus welcher Disziplin kommt es jetzt?
Nitzke: Ähm, mit all den Dingen arbeite ich. Also, ich kann mir anschauen, wenn ich - also das tue ich dann auch - dann gucke ich in populärwissenschaftliche Bücher, in Bestimmungsbücher. Ich stöbere auch ab und zu mal im botanischen Teil unserer Bibliothek und schau mir dann an, was es da gibt. Ich freue mich immer, dass gerade so Definitionen von Wald und Baum ja relativ offen sind an verschiedenen Stellen. Es gibt eben das, was auch hier so drin steht, wenns dann an die Kinder geht. Das ist übrigens meine große Leidenschaft, meine Fünfjährige, die heute aufgrund von Hitze keine Lust hatte, mitzukommen, als Ausrede zu benutzen, die ganzen schön gestalteten Kinderbücher anzuschaffen. Weil brauch ich natürlich zuhause, ist klar. Naja, aber da steht dann eben drin, dass Bäume dann eben große Pflanzen sind, die einen holzigen Stamm ausbilden und auch Breitenwachstum – äh Dickenwachstum haben usw.,
Aber eben das, was ich gerade meinte, mit dem Willing suspense of disbelief, also diesem Vertrag zwischen Autor:in und Leser:in, wenn in dem Buch steht: „Das ist ein Baum“, dann kann ich damit ja erst mal arbeiten und ab und zu ist dieses „Das“, worum es dann geht, zum Beispiel eine Frau. Das passiert immer mal wieder. Ja, dass es Frauen gibt, die sich in Bäume verwandeln und am Ende des Textes Bäume sind, obwohl alle Beteiligten im Buch und alle, die das Lesen, eigentlich wissen die Menschenform ist nicht verlassen. Trotzdem ist das ein Baum, also d. h. ich komme sozusagen von zwei Seiten. Ich guck mir einerseits an, was in den Texten steht. Also es geht weniger um die Literaturwissenschaft, die das macht. Es gibt natürlich auch viele Untersuchungen gerade zum sogenannten „deutschen Wald“ in der 19.-Jahrhundert-Literatur. Da gibt es relativ viel zum Wald in Märchen, was die unterschiedlich können usw., was die unterschiedlich mit dem jeweiligen Forstwissen angestellt haben. Aber ich kann mir diese Definition sozusagen aus jedem einzelnen Text ziehen. Ich kann gucken auch, wie sich das innerhalb eines Textes verändert, und ich kann das dann abgleichen und finde meistens ähnlich viele Vorstellungen. Da habe ich natürlich auch aufgrund meines Standpunktes den großen Vorteil, dass mich nur bedingt interessieren muss, was sozusagen Lehrmeinung ist, sondern ich mir sozusagen die ganze Breite dessen angucken kann, was so unter dem Label „Wissenschaft“ läuft. Was, das sag ich dazu, nicht heißt, dass ich nicht sehr, sehr genau gucke, an welchen Stellen was publiziert wird. Das ist auch in meiner Dissertation zur Produktion der Katastrophe schon wichtig, dass ich mir angucke, ob jemand - wie schnell jemand zufrieden damit ist, dass es doch die Aliens waren oder dass es doch irgendwie… man das alles so selbst spürt. Und da mache ich natürlich schon Unterscheidung.
Diringer: Sehr spannend auf jeden Fall. Ich hatte auch noch zwei Begriffe aufgeschnappt bei Online-Publikationen, und zwar „Arboreale Poetik“ und „Nature Writing“. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Nitzke: Genau, das ist der Punkt, wo ich so subtil auf meinen eigenen Sammelband hinweisen kann. Also, „arboreale Poetik“ ist sozusagen mein Vorschlag an die Literaturwissenschaft. Das ist dann der Punkt, wo man in der Literaturwissenschaft… Wir sind ja auch nicht arm an Fachbegriffen. Wo es um Poetik geht ist einerseits der Versuch, mir anzuschauen, welchen Einfluss Bäume auf Texte haben. Also das, was ich gerade meinte, ich guck mir das nicht nur als Motiv an, also nicht nur „In soundsoviel Gedichten taucht ein Baum auf“ und dann steht der Kirschbaum für dieses und die Eiche steht wie jenes und so und so. Sondern ich versuche sozusagen mit der Annahme, der Hypothese zu arbeiten, dass wenn man Texte daraufhin liest, dass Bäume für Bäume stehen und nicht immer automatisch für Menschen, dass das etwas mit dem Text macht. Und Poetik heißt dann - also im Grunde hätte man auch Baumpoetik schreiben können, und ich hatte auch am Anfang noch was mit „romantischer Dendrographie“ untendrunter, das habe ich mir dann doch gespart -, also die „aboreale“ wäre dann sozusagen die bäumische oder die Baumpoetik, d. h. Texte, die tatsächlich sozusagen aus den Eigenschaften, die sie Bäumen zuschreiben oder die sie über Bäume erlesen, entwickeln, wie Texte funktionieren.
Hier ist zum Beispiel Esther Kinskys Roman „Hain“. Ein tolles Beispiel. Das ist ein Roman, der heißt auch Geländeroman. Da kann ich auch gleich direkt auf Nature Writing kommen. Wo eine Protagonistin nach Norditalien fährt, um zu trauern um ihren verlorenen Partner. Und sie tut es auf verschiedene Weisen. Einerseits indem sie sich Bäume anguckt, und zwar ganz explizit keine besonderen Bäume, sondern einfach, was da halt so steht und indem sie fotografiert. Und wie das zum Beispiel zusammengebracht wird, wie die Baumfotografie zum Beispiel anders funktioniert und in dem Text beschreibt, wie der Text funktioniert: Das ist das, was ich mir angeguckt habe.
Und was ganz spannend ist, wo das dann mit dem Nature Writing zusammenkommt, ist zum Beispiel hier in dem Buch von Sumana Roy „Wie ich ein Baum wurde“ aus der Reihe Naturkunde. Also auf deutsch ist das bei den Naturkunden bei Matthes & Seitz erschienen. Das ist ja auch so eine Zwischenform zwischen fiktionalen Literatur und Sachtext. Das gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum erst seit Matthes & Seitz diese Reihe haben und einen Preis dafür verleiht. Das ist immer ein ganz guter Weg ein neues Genre einzuführen, indem man einen Preis dafür verleiht. Dann sind die Autor:innen oft selbst überrascht, dass ist diesem Genre zugehören, aber ich meine, wer lehnt schon so einen Preis ab, also funktioniert das ganz gut.
Sumana Roy macht was ganz interessantes. Das ist kein literaturwissenschaftliches Buch, das ist auch kein literarisches im Sinne von fiktionaler Erzählung, sondern so eine Art Selbsterkundung, also eine Autobiografie mit Bäumen. Und am Anfang steht auch da so eine Hypothese: „Ich möchte ein Baum werden“. Sie hat dieses Bild, dieses Begehren ein Baum zu werden, was ich dann zurückbinden kann an die Geschichte von Daphne aus Ovid, die ja auch ein Baum werden will, um Apollon zu entkommen. Und auch hier erzählt eine Frau, die Geschichte davon, wie sie sozusagen zu einer Pflanze, einem Baum werden möchte, um bestimmten menschlichen Erwartungen an ihr Frausein zu entkommen. Das ist schon relativ… ähm ja „innovativ“… das Wort immer so sehr eingebunden in diese ganzen fancy Wissenschaftssprechsachen, ja wenn man irgendwas innovativ, neu macht. Es ist eigentlich sehr alte Weise zu erzählen, ohne notwendigerweise eine geschlossene Geschichte zu erfinden, sondern ein „Ich“ in einen Naturzusammenhang zu setzen und dann zu gucken, was passiert. Das kann man auch als Nature Writing verstehen. Und es ist für mich deswegen so interessant, weil es genauso eine Randform von Erzählen ist. Und was ich mir in diesem „Aboreale Poetik“-Artikel angeguckt habe, ist, dass Menschen, die diese Texte schreiben, dass, was er hier - Peter Wohlleben kennen bestimmt einige - in „Das geheime Leben der Bäume“ tut, nämlich Bäume zu anthropomorphisieren, also in Menschenform zu bringen… Die sind dann befreundet und die sind dann Nachbarn und die passen aufeinander auf und alles solche Sachen… kehren diese Autor:innen, zum Beispiel Robert McFarlane, um und zeigen, wie die Menschen, die in diesen Texten vorkommen, nicht versuchen zu Bäumen zu werden … ähm nein, andersrum: Nicht die Bäume zum Menschen machen, sondern selbst versuchen mehr wie ein Baum zu werden. Das muss dann nicht so weit gehen wie bei Sumana Roy, die diese Grenzen des Baumwerdens auch feststellt, am Ende. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass sie das am Ende wirklich von sich glaubt und man denkst so: „Ja, klar, nein, du bist ein Baum, ja sicher“. Sondern die sozusagen mit diesem Scheitern arbeiten. Das ist was, was ich interessant finde, also das Scheitern, der Versuch, ein Baum zu werden, von dem man weiß, dass er nicht gelingen kann.
Und das ist das, was dann Literatur oder literarisches Schreiben kann, also Nature Writing, weil es das versuchen darf und weil es nicht gelingt. Es ist eben kein wissenschaftlicher Artikel. Da muss am Ende nicht „was rauskommen“, was verallgemeinerbar ist, nachvollziehbar ist, sondern etwas, was für diesen Text funktioniert und was dann vielleicht auch andere anregt.
Diringer: Besonders interessant, ich hatte auch eine Geschichte über meinen Namen „Lilith“ mal gelesen, die auch im Sumerischen mal aus einem Baum herausgewachsen ist, wie auch immer. Also sehr spannend, dass du hier jetzt auch nochmal auf die Götterwelten verwiesen hast, welche alte Tradition es auch dort gibt.
Ihr könnt euch alle schon mal darauf vorbereiten, wenn wir gleich die ersten Fragen entgegennehmen.
Aber davor darfst du noch kurz möglichst prägnant zusammenfassen, was von der einen Seite vielleicht deine hauptsächliche Motivations-, auf der anderen Seite dein größter Demotivationsfaktor innerhalb deiner gesamten Arbeit bisher - vielleicht schon vorausschauend – ist oder sein wird.
Nitzke: Naja, da ich ja noch wissenschaftliche Mitarbeiterin bin und immer mal gucken muss, wie das so weitergeht, ist der Demotivationsfaktor all das, was so zu organisieren ist, damit ich diese Forschung machen kann. Also, gucken, dass man eine Stelle hat. Dass - ich bin mit meiner Familie hierhingezogen - dass auch mein Mann irgendwie unterkommt. Also, dass man all das irgendwie zustandebekommt, was nötig ist, damit man sich in Ruhe hinsetzen und forschen kann. Das war, wie Sie sich denken können, im letzten Jahres super spitze, mit geschlossenen Kitas, hab ich total produktiv gearbeitet, war noch nie so toll. Also, das ist tatsächlich das, was es wirklich frustrierend macht und was es dann auch frustrierend macht, dazu gehört eben auch, dass ich - was auch Spaß machen kann - ständig erklären muss, was ich da eigentlich mit zu schaffen hab. Ich bin weder Botanikerin, noch ist es so „richtige Germanistik“, was ich hier mache. Und wenn ich auf dem Germanistentag sowas vorstelle, dann ist das immer „hübsch“. Die Frau Nitzke, die macht was mit Bäumen, das ist auch schön, das kann die auch gern mal machen, aber es ist immer sehr viel Arbeit, bis die Leute das richtig ernst nehmen. Da kommt dann halt so eine „arboreale Poetik“ mal um die Ecke und dann wissen die Leute schon: „Jaja, die kann die Worte schon schmeißen, wenns sein muss“.
Und der Motivationsfaktor ist… Also erstens hab habe ich noch ein Regal voller so schöner Bücher kaufen „müssen“ und es sind wirklich bemerkenswerte Dinge, die in Texten passieren und die zeigen, was tatsächlich auch eine interdisziplinäre Herangehensweise an Wissen – und jetzt bewusst nicht nur formalisierte „Wissenschaft“ - sondern an Wissen bringen kann. Wo man einfach ein bisschen rührt. Und was gerade im Moment, wo aus verschiedenen Richtungen - auf mir sehr unangenehme Weise -wissenschaftliches Wissen angezweifelt wird, glaube ich auch sehr sehr wichtig ist, dass man gucken kann, welche Weisen gibt es eigentlich, Skepsis zu äußern, zu zweifeln. Alternativen zu erzählen, die eine Berechtigung haben, weil sie eben sozusagen etwas öffnen und nicht immer eindampfen. Das ist für mich - also da erlaube ich mir meine eigene Arbeit tatsächlich wirklich wichtig zu finden.
Diringer: Ja sehr sehr schöne Einordnung und gute Darstellung dann auch dieses Struggles. Aber wir hoffen natürlich, dass solche Veranstaltungen auch ein weiterer Motivationsfaktor sind. Und dementsprechend würde es mich freuen, wenn von eurer Seite aus auch Interesse gezeigt wird, im besten Fall in Form von Fragen. Gibt es denn schon erste Gedanken, Kommentare?
Gast: Bei Ovid sind dass, ich sag jetzt nicht Figuren, Bäume, ja, also Lebewesen außer Menschen, die aber selbstständig handeln, es ist eine reale Situation, die dringt nicht in eine Subebene ein, sondern hat dort ihre eigene Lebenswelt, wie meinetwegen Menschen. Aber was sie hier vorstellen, das ist ja was völlig anderes. Dort lebt ja der Baum oder was weiß ich wer, in der Welt des Menschen, notfalls als Erzählung, als quasi Subebene. Und führt dort ein eigenständiges Leben. Versucht eine Verbindung herzustellen. Mit der andern Hauptebene meinetwegen. Und da sehe ich auch einen ganz gravierenden Unterschied zu Ovid. Bei Ihnen sind das Pflanzen, speziell Bäume.
Wenn man dann mal E.T.A. Hoffmann nimmt, wo das ja fast immer Tiere sind. Also meinetwegen bei „Meister Floh“, da ist es der Floh. Oder duie Schlange hier bei… wie heißt die Geschichte schnell… oder bei Prinzessin Brambilla. Da spielt das ja immer fast in ner zweiten Ebene, in einer dritten Ebene. Der Leser weiß zum Schluss nicht mehr, in welcher Ebene bin ich denn. Er weiß bloß genau, in der Ebene kann die Geschichte nicht enden. Wie macht ers denn, dass es nun wieder in die Realität zurückkommt. Und plötzlich knallt eine Tür und da sagt der Johann, zu dem er die Geschichte erzählt, und plötzlich ist es wieder in der Ebene eins. Wie verhalten Sie sich denn in Ihren Erzählungen oder Geschichten oder Romanen oder was weiß ich?
Nitzke: Also, das ist ein ganz großartiger Strauß von Fragen und genau im Zentrum meines Buchs, weil das eine sehr unterschiedliche Literatur macht. Also bei Ovid würde ich es am besten andersrum sehen. Das Tolle an Ovid ist genau das, was sie beschrieben haben. Da kann eine Figur wie Daphne zu einem Baum werden, da werden die Finger zu Ästen, die Füße zu Wurzeln, die Haare zu Blättern. Das passt und dann ist der Baum sozusagen schon in der Figur angelegt, aber eben tatsächlich sozusagen kontinuierlich, sie muss nicht magisch verwandelt werden, sondern sie kann das sozusagen schon werden. Und ich hab - noch mal zur Motivation - ich hab neulich in einem Kolloquium vorgestellt, was ich da gerade so mache und hab mich anstatt mich mit den Kollegen in meinem Kolloquium sozusagen, in den Medienwissenschaften und Germanistik, habe ich mich bei den Altphilologen mit hineingeschlichen, um mal auszuprobieren, ob das, was ich so zu Ovid zu sagen habe auch hält. Und das, was bei Ovid interessant ist, ist das ja eigentlich umgekehrt ein Schuh draus wird. Ovid erzählt ja fast rückwirkend, weil die Geschichte von Daphne zum Beispiel ist die Frage, warum tragen eigentlich alle Leute Lorbeerkränze, um bis sich besonders zu rühmen. So, und dann fängt man zu erzählen: Ja gut, da war mal der Apollon, und der hat sich verliebt in diese Nymphe, die wollte ihn aber nicht, weil er sich vorher mit Amor angelegt hat und da gibt es diesen Liebespfeil und diesen Entliebenspfeil. Jedenfalls rennt Sie vor ihm weg, er kann sie nicht bekommen. Es ist aber klar, das wird nicht lange gut gehen. Sie bittet ihren Vater, den Flussgott, sie zu retten und dann wird sie zu einem Baum. Und Apollon liebt sie trotzdem noch, weil er ihre menschliche Gestalt in dem Baum noch erkennt. Er hört ihr Herz noch schlagen unter der Rinde. Das ist aus heutiger Perspektive gelesen auch so ein bisschen – nicht so ein bisschen – es ist massiv unangenehm, wenn man das liest, wie er sich dann trotzdem auf dem Baum setzt, obwohl sie gerade dachte entkommen zu sein. Aber es ist genau das, was sie sagen, ja, das ist eine gerade Linie auf der das stattfinden kann. Es gibt einen Roman vom amerikanischen Autor Richard Powers, der heißt in der deutschen Übersetzung „Die Wurzeln des Lebens“. Ich muss immer so lange überlegen, weil es auch einen Pflanzenphilosophen gibt, Emanuele Coccia, da heißt das Buch „Die Wurzeln der Welt“, weil auf Deutsch muss immer alles Wurzeln haben. In diesem Roman jedenfalls wird Ovid als Intertext, also d. h. als Bezugstext genommen, um genau diese Kontinuität wieder zu zeigen. Der macht also nicht nur… da kommt ein ähnliches Buch wie das von Wohlleben vor, also ein Buch im Buch. Womit wir fast schon bei Hoffmann sind, ich komm noch dahin. Der versucht aber sozusagen von diesem antiken Text - 2000 Jahre alt - mitzunehmen, dass es eine Kontinuität gibt, dass es keinen Kategorialen Unterschied gibt zwischen der Welt, in der die Bäume leben und der Welt, in der die Menschen leben. Und da sind wir auch wieder bei der Nachfrage vom Anfang. Wir leben also in einer Baumwelt und nicht nur ist der eine beim anderen zu Gast, sondern man ist eben auch verbunden. In dem Roman von Richard Powers gibt es dann auch eine Wissenschaftlerin, die dann eben sagt, wie viel die Gene identisch sind usw. Das wird dann eben auch in einem anderen Modus gemacht, weil da eben keine Nymphen herumlaufen. Das ist zwar nicht plausibel für den Realismus dieses Textes. Da wird es über andere Sachen hergestellt. Was das bei so Ovid so interessant macht, ist dass Ovid ja nun alles andere als ein altvorderer Mythentext ist, das ist ja hochkomplexe Literatur. Also das ist wirklich, ich meine, wenn man anfängt in Hexametern zu schreiben, dann ist es kein spontanes Erzählen mehr. Und da und da genau zwischen bewegt sich das. Hoffmann ist ein anderes Problem. Denn diese Romantik, die muss damit leben, das eigentlich diese Kontinuität nicht mehr sein darf. Industrialisierung beginnt, Institutionalisierung von Wissenschaften beginnt, oder sowas. Und d. h. jedes Mal, wenn E.T.A Hoffmann erzählt, wie man in … „Die Elixiere des Teufels“ ist das glaube ich mit der Serpentina, oder? Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das gerade durcheinander werfe. Also da, da macht man halt so die Studierzimmer, das sind dann auch oft Gelehrte, die sich dann aber plötzlich, wenn man die richtige Tür zwischen den richtigen Bücherregalen aufmacht, ist das doch schon ein chemisches Ding und sind die doch Zauberer, und doch mit dem Teufel im Bunde und solche Sachen. Und da muss man aber schon am Anfang genau diese … da gibt es eben so Zimmern die gestapelten - apropos Poetik - ja also da ist dann ein Zimmer mit einer Geheimtür hinter der sich ein geheimes Zimmer befindet, das dann noch geheime Tür hat, wo man dann sozusagen beim Teufel ankommt. Ja, aber die genau diese Welten sozusagen übereinander stapeln und die immer wieder damit leben müssen, dass das eben eigentlich nicht sein darf, sondern Kontinuität. Und wie ich damit umgehe, ist erstens: Sehr lange zu erzählen, wie ich gerade wieder feststelle. Und zweitens zu schauen, wo Autor:innen heutzutage in ganz vielen - und es ist wirklich also aus einer Arbeitsperspektive erschreckend, wie viel allein in den letzten zwei Jahren an Baumtexten erschienen ist - wirklich versuchen, sich das Recht auch für die Literatur wieder herauszunehmen, zu sagen, „Da wird jemand ein Baum“. Das ist ein unerhörter Satz. Wir sind absolut bereit, dass bei Ovid zu akzeptieren, weil das ist ja 2000 Jahre alt, was wussten die denn schon. Also, das bisschen Hexameter und römische Kultur - pfff. Aber, das ist eben ein völlig unerhörter Satz und dann realistische Roman draufzuschreiben, das ist eben so eine Art von Störung, an der arbeite ich. Also, Sie haben im Grunde meinen Problemaufriss geschildert.
Gast: Aber was würden Sie sagen, wann der Umschwung vom Tier, bei E.T.A. Hoffmann beispielsweise, zur Pflanze erfolgt.
Nitzke: Das ist eine eher eine Frage, wann Literaturwissenschaften auf was aufmerksam werden. Also die Romantiker arbeiten fast genauso viel mit Pflanzen, wenn Sie an „Das kalte Herz“ denken von Hauff oder an Tieck, „Den Runenberg“. Und die ganzen Wälder, die wieder was können. Das ist eher eine Spezialität der einzelnen Autoren zu der Zeit oder Autorinnen. Bettina von Günderode hat super viel dazu gemacht. Ähm, jetzt habe ich sie durcheinandergebracht: Die Günderode von Bettina von Arnim, so. Ja, die arbeiten mit beidem. In der Literaturwissenschaft kann man das relativ genau sagen, da hat sich die… wo ich ja jetzt auch so dazu gehöre… also einerseits hat sich die ökologisch orientierte Literaturwissenschaft seit den 1990er Jahren institutionalisiert und das Interesse für Pflanzen ist in den letzten zehn Jahren wirklich groß geworden.
Diringer: Also ein ganz aktuelles Thema. Wir hatten hier noch eine weitere Frage.
Gast: Der Unterschied ist aber meines Erachtens doch, dort ist es immer in Form eines Märchens erzählt.
Nitzke: Nicht immer...
Gast: Aber als Realität, weil das bei E.T.A Hoffmann ja völlig anders ist, dort ist es Realität und dort spinnt sich die Realität, in eine immer andere Ebene.Und plötzlich denkt man dann, das kann ja wohl nicht mehr funktionieren. Wie will der das auflösen?
Nitzke: Aber das ist genau die Art von Zuordnung, gegen die ich mich setze, weil das ist wirklich sehr unterschiedlich und mit der Perspektive, aus der ich arbeite, stellt sich das tatsächlich differenzierter noch mal dar. Also das ist auch der Effekt - das, was sie gerade gesagt haben, ist nicht falsch. Aber dass das immer als Märchen erzählt wird, liegt auch daran, dass das in der Schule und in der Universität usw. immer als Märchen unterrichtet wird. Da stehen dann Leute wie ich und sagen ihren Studierenden: „Ja, aber im Endeffekt ist das natürlich ein Märchen“ und die müssen das dann aufschreiben, denn wenn sie es nicht aufschreiben, kriegen sie halt ne Vier. Das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber – Frau Flecks guckt schon - ja aber, das ist eher eine Frage, wie mit diesen Texten gearbeitet wurde, als was in diesen Texten drinsteckt. Weil wenn man die noch mal anguckt und noch mal liest, dann öffnen sich da wirklich noch mal ganz andere Welten. Also, da verweise ich jetzt mal auf mein Buch, das dann irgendwann erscheinen wird.
Diringer: Ich denke auch, dass wir auch im Zuschauerraum alle unsere Bücher nochmal anders reflektieren werden. Noch ein kurzer Hinweis. Wir nehmen das Ganze auch als Audiodatei auf, damit es im Nachhinein auch einem größeren Publikum zugänglich ist. Von daher würde ich euch alle bitten, wenn ihr die Frage formuliert, ganz kurz zu warten auf das Mikrofon und dann haben wir auch die ganze Frage immer schön auf der Aufnahme mit drauf. Denn ich kann auch schwer unterbrechen und die Frage nochmal wiederholen, weil hier ja ein Dialog entstehen soll. Also ganz kurz gedulden und dann kommt das Mikro zu euch geflogen durch unsere Helferin. Jetzt würde ich sagen, die nächste Frage…
Gast: Ja, also du hattest es grad schon angesprochen, dass es mehr und mehr Literatur über Bäume gibt. Was mich interessieren würde: Zum einen, was sagt es aus, dass so viele Bücher über Bäume jetzt entstehen und wie werden Bäume unterschiedlich in unterschiedlichen Zeiten vielleicht verarbeitet, ohne dass es jetzt ein Motiv sein muss, sondern einfach, was heißt das und was sagt das dann, wie der Diskurs der Öffentlichkeit verläuft. Und das ist vielleicht die zweite Frage: Welche öffentlichen Diskurse - oder gibt es öffentliche Diskurse, die gerade diese Baumbücher anstoßen?
Nitzke: Also, wenn ich das aus der Literaturperspektive beantworte, Literatur im engeren Sinne, da sind die Bäume im Moment deswegen auch ein besonders dankbares Sujet, weil sie durch die öffentlichen Diskurse nach, denen du auch fragst, ganz neue Fähigkeiten zur haben scheinen. Ja, also ich hab Alexander Demandt erwähnt, der eben als eines seiner letzten Großwerke als Historiker diese Geschichte des Baums schreibt, weil das so schön ist, weil die Bäume sich nicht verändern. Das ist halt überhaupt nicht mehr der Stand der Dinge. In der öffentlichen Diskussion - dient nicht zuletzt also gerade in Deutschland massiv um Peter Wohlleben kreist und eben dieses „Geheime Leben der Bäume“ - aber eben auch gerade aus den USA und England, aus Italien durch Stefano Mancuso und „Die Intelligenz der Pflanzen“ heißt dessen Buch - massiv in Bewegung geraten ist. Und da ist gar nicht so sehr interessant, ob das jetzt stimmt, was die sagen oder nicht nicht. Das ist für die meisten - also gerade für Literaten ist es voll „Who cares?“, also ganz ehrlich, aber die Vorstellung, das es plausibel genug ist, über Bäume als intelligent, als kommunikativ und als sozial zu sprechen, ist eine Infragestellung dessen, was man meint ja sehen zu können. Die macht es literarisch interessant, und die macht es vor allem literarisch interessant, um Geschichten zu erzählen, von Leuten oder von Figuren, die sonst nicht romanfähig sind. Also warum sollte man - es gibt, das haben wir in dem Metamorphosen-Seminar ja gelesenen, den südkoreanischen Roman „Die Vegetarierin“ von Han Kang. Wo auch eine Frau eben zum Baum wird. Und was daran erzählt wird, an diesem skandalösen Bedürfnis, sich in einen Baum zu verwandeln, ist, wie eingeschränkt ihre Entscheidungsfreiheit ist. Die hört am Anfang auf, Fleisch zu essen und das ist die eigentlich schon vollkommen aus der Gesellschaft ausgestiegen. Ihre Familie versucht, sie dann zu zwingen. Dann geht es um die Frage, ob sie selbst begehren kann. Das kann sie dann erst als Pflanze. Und auch hier, in „Die Betrunkenen Bäume“ ist das, was den Baum so interessant macht, das, was ich Dendromorphisierung nenne. Dass Menschen sich aus ihrer Menschlichkeit heraus begeben können. Und das macht es auch so interessant bei Pflanzen und Bäumen eben im Vergleich zu Tieren, also wenn man das vergleicht. Baum-Mensch, Baum-Tier. Wenn man also einen Hund nimmt. Das ist aus der Perspektive schon fast dasselbe, also ob man jetzt ein Hund ist, oder nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Aber der Weg vom Mensch zum Hund, zum Wolf, zum Affen - das sind ja die typischen Tiere, die vorkommen - aber selbst zum Käfer oder zum Ungeziefer, wenn man an Kafka denkt – ist nicht halb so weit wie der zu einem Baum. Weil da alles anders ist und gerade eben auch eine Form von Hypermoderne-Kritik sich mit verbindet. Ja, also wenn wir über Beschleunigung reden, wenn wir über unsere Vernetzung reden, wenn wir über die Arten und Weisen, wie kommuniziert wird oder nicht sprechen, dann können Bäume sozusagen einen Perspektivenwechsel einläuten, der eben auch für die literarische Form interessant ist. Und da passieren total aufregende Sachen. Wenn man sich die Lyrik von Marion Poschmann anguckt, zum Beispiel, dann ist es Nichts, was jetzt plötzlich ganz neue Formen herausbringt. Sondern gerade da, wo es um Bäume geht - Christian Lehnert ist auch so ein Fall – sind es plötzlich ganz alte Formen. Da gibt es dann Sonettenkränze. Ja, ich dachte, ehrlich gesagt, sowas gibt's nur noch irgendwie im Germanistik-Grundkurs. Ja, aber da werden plötzlich so alte Formen reaktiviert. Oder sowas wie Ovid wird plötzlich wieder ein ganz moderner Text und man kann da ganz anders drüber reden. Das hat mit der Dennis Pausch aus der Latinistik auch erzählt, dass seine Studierenden ganz anders solche Texte noch mal lesen. Und das ist das, was es so interessant macht. Und die öffentlichen Diskurse um die es da geht, sind, welche, die für mich auch so interessant sind, weil sie noch mal neu diskutieren, was Literatur eigentlich kann.
Also die öffentlichen Diskurse sind, ich habe das gerade schon angedeutet… Andreas Roloff, Forstbotaniker hier in Tharandt, da war ich. Der fragte mich auch gleich so: „Na, wie halten Sie’s denn mit dem Wohlleben? Was finden Sie denn?“. Und da saß ich da… Und ich so: „Hm, naja, also mich muss das ja inhaltlich nicht so interessieren, da brauche ich mich ja nicht so zu positionieren.“ Natürlich kann man sich schön ausreden, aber mich interessiert tatsächlich eher die Art und Weise, wie das jemand erzählt und dann hier, so eine wirklich zum Teil auch sehr – man kann jetzt radikal vereinfacht sagen - man kann auch irgendwie „heruntergebrochen“ sagen. Je nach dem wie man das gerade findet. Weil so Sozialleben unter Bäumen zu erzählen, ist einerseits so ein bisschen mit der Brechstange, andererseits aber eben auch was, was - nicht nur bei Wohlleben, sondern auch bei anderen, aus der Verzweiflung gegenüber der Ignoranz von echten Menschen gegenüber wirklichen Bäumen, also im Sinne von, „Wenn ich mit dem Knie dagegen haue, tuts weh“ – das meine ich jetzt mit wirklich. Und da geht es dann tatsächlich auch um die Art und Weise, wie kann man sich eigentlich in einer Welt bewegen – deswegen sag ich das auch immer: „Wir leben in einer Welt der Bäume, nicht umgekehrt“. In der wir - ich hab es als Kind schon ständig gehört: „Der Regenwald, der Regenwald und es gibt bald keinen mehr“ - und das war die große Zeit von saurem Regen und sonstigen Sachen. Und man sitzt da und man schwitzt und es ist das vierte Jahr in dem man denkt: „Ja, gut, also so richtig, mit regnerischem Sommer ham wers nun auch nicht mehr“. Und trotzdem wird wieder eine Fläche freigegeben, wo komplett abgeholzt wird – ich darf gar nicht anfangen - wird ein Wiederaufforstungsprogramm gemacht, wo der komplette im Boden mit allem, was irgendwie abgebrannt ist, abgetragen wird. Mit diesen riesigen Harvestern, um dann neue Pflanzen zu setzen, von der gleichen Art, die vorher schon nicht funktioniert hat. Da geht es dann tatsächlich auch um Ffragen, wo Leute sich bemächtigt fühlen, zu sagen, „Ja, aber ist das nicht so?“. Und das, was mich, interessiert, was mich auch so ein bisschen freut, ist das, weil zum Beispiel jemand wie der Wohlleben, so erzählt, wie er erzählt, spricht der Leute nicht nur an, sondern er gibt den auch was in die Hand, um so richtig zu nerven und so richtig zu stören und so richtig Leute zu zwingen, zu erklären, warum das eigentlich so ist, und nicht anders. Und da ist glaube ich wirklich gerade was in Bewegung.
Diringer: Das ist da auch in den öffentlichen Diskursen. Und „Die Vegetarierin“ zum Beispiel hat meine Mutter mir geschenkt, unter anderem weil ich mich eben auch vegetarisch-vegan ernähre. Wer genau ist denn so das Klientel, die das jetzt in letzten 10 Jahren, wo so viel aufkam, gelesen hat, lesen wird. Studierende? Auch Jugendliche von Fridays for Future? Die Literaten? Die Forstwirtschaftler? Kann man das irgendwie abgrenzen?
Nitzke: Also das kommt auf das Buch an. Ich muss jetzt sagen, wenn man jetzt hier so eine Reihe nimmt, von Matthes und Seitz. Judith Schalansky, die das gestaltet, sagt, das ist so ein doppeltes Biotop. Einerseits ist es sozusagen eine bestimmte Naturauffassung. Das sieht man hier auch, die sind unheimlich schön gestaltet. Die sind illustriert und so ein Ding kostet dann 35 oder 38 €. Das richtet sich jetzt nicht direkt an eine große Öffentlichkeit, muss man mal so sagen. Man könnte auch sagen, das schließt viele Leute aus. Also, viele von den Sachen lesen die Leute, die sowieso lesen und die sich dann auch schöne Bücher in den Schrank stellen. Das gilt im gewissen Maße auch für diese Kinderbücher. Ich hab hier Piotr Sochas „Bäume“ mitgebracht. Der hat auch ein ganz schönes Buch über Bienen, was mit ganz tollen Infografiken gemacht ist. Das ist jetzt für alle Audio-Zuhörer doof. Also, da geht’s dann von Stammbäumen über die Tiere, über Baumhäuser und alles mögliche.
Diringer: Ja die Zuhörer können ja mal vorbeikommen und dein Regal begutachten.
Nitzke: Ja, juhu. Oder mir auf Twitter folgen, da poste ich sowas auch ständig. Also natürlich kaufen nicht alle Eltern ihren Kindern diese Bücher. Andersrum: Nicht alle Eltern machen das so wie ich und kaufen SICH diese Bücher und halten Sie Ihren Kindern vor die Nase, damit sie einen Grund haben, die Bücher zu kaufen. Aber sowas steht dann eben auch in Bibliotheken, also gerade die Bücher, die sich an Kinder richten.
Ich möchte auch nochmal zu Wohllebens Ehrenrettung sagen: Die Wohlleben Kinderbücher sind mit Abstand besser als die, die sich an Erwachsene richten. Offenbar muss man Erwachsenen Sachen – wenn ich das so sagen darf - ein bisschen blöder verkaufen als Kindern. Kindern wird in diesem Sachen mehr zugetraut, auch weil die eben kein Problem damit haben, wenn anthropomorphisiert ist und in echt redet. Also gerade bei den Kinderbüchern habe ich schon den Eindruck, dass das eine große Reichweite hat. Robert McFarlane, hat ein Buch gemacht, das heißt „The lost words“ – „Die verlorenen Wörter“. Das ist hier auch bei Matthes und Seitz erschienen. Aber die haben in England eine ganz große Aktion gemacht, wo sie per Crowdfunding dieses Buch an praktisch alle Schulen in Klassensätzen verteilt haben. Weil das Prinzip dieses Buchs ist, dass sie Worte, die aus dem Oxford English Dictionary gestrichen wurden, weil man sie nicht mehr braucht, sowas wie King Fisher, also der Eisvogel verschwindet dann für sowas wie Smartphone – das geht natürlich gar nicht. Da ist kulturkritisch direkt die Hölle los. Ich freu mich immer über solche Geschichten.
Aber die haben dann eben auch so eine alte Form. ABC Gedichte, die eben früher auch genutzt wurden, um Schülern was beizubringen. Wunderschön illustriert. Und die haben die Bücher einfach verschenkt. Ja, sowas gibt es auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Also dass ist mit den meisten Büchern und Literaturen so: Das lesen die Leute, die eh lesen. Also ich möchte mir jetzt auch nichts vormachen. Ja, das ist jetzt nicht plötzlich, dass alle Leute anfangen und sagen: „Oh, Literatur! Sonettenkranz!. Das ist es doch!“. Aber es bringt auch mehr Leute - und da würde ich mich jetzt mal unbescheiden selber zu zählen - mehr Leute dazu, davon zu erzählen und dann plötzlich anzufangen, Formate zu machen, in denen… Letztes Jahr war im Brechthaus zum Beispiel was… in denen über Ökologie gesprochen wird und ganz selbstverständlich ist dann Literatur dabei, sind dann Wissenschaftsjournalistinnen dabei. Und diese Mischung, die macht’s, glaube ich.
Und dann habe ich noch so ein Buch, das vielleicht auch noch… Ja, also gut, der Wohlleben hat natürliche eine Riesenreichweite, aber hier Caroline Ring hat dieses Buch geschrieben: „Die Botschafter des Lebens. Was Bäume in Städten erzählen“. Und das ist eine Mischung aus Nature Writing und Reiseführer. Die ist mit Bus und Bahn - was ich sehr sympathisch fand, weil sie gesagt hat, sonst kommt man ja doch nicht zu den Sachen - zu verschiedenen Bäumen in Deutschland gefahren, hat deren Geschichten gesammelt. Und wirklich so „Was macht ein Maulbeerbaum? Aber warum steht der auch in dieser und jener Stadt? Und dann gibt’s eben die Mammutbäume in Stuttgart, weil der Stuttgarter Fürst zu der Zeit hat zu viele Samen bestellt und hat die dann all seinen Freunden verschenkt und die wussten nicht, was sie machen, haben die dann einfach in den Garten geworfen und mittlerweile kann man, wenn man an einer bestimmten Stelle steht, in Stuttgart sehen, wenn die dann mal so 200 Jahre wachsen dürfen, sieht man schon die werden höher als so der übliche Baum der da halt rumsteht. Und solche Sachen.
Und diese Sachen haben auch, sozusagen eine Form des Nature Writings, die schon noch mal weiterreicht, weil sie eben nicht mit dem großen Tatatata - Bachmann Preis war ja jetzt gerade – Literaturding. Ganz ehrlich, ich les sowas ja auch nicht so gerne, wenn da groß draufsteht: „Das ist jetzt hier Literatur“ und dann muss man sich anstrengen. Ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt machen muss. Und ich glaube gerade so in diesen Formaten, die von vornherein auf Kommunikation ausgerichtet sind und die auch was über Bäume erzählen wollen, damit die da einfach weiter wachsen dürfen. Da passiert schon viel. Und dann passiert natürlich auch viel darüber, dass wenn jetzt die nächste Diskussion über den Hambacher Forst ist. Leute einfach was machen. Fridays for Future. Was interessanterweise sich gar nicht so sehr sich auf Literaturen bezieht, und das halte ich für sehr kluge Idee, dass man nicht schon wieder irgendwie so intellektuelles Movement macht, wo dann die klugen Leute mit den Büchern kommen und sagen, so jetzt müsst ihr alle mal zuhören. Sondern die das halt auch selber sehen. Aber dieses sehen lernen und hören lernen und auch riechen lernen. Es gibt tolle Bücher über den Geruch von Bäumen. Das ist schon was, was man auch weitererzählen kann.
Diringer: Es ist auch sehr schön, mit allen Sinnen zu erfahren, hier mitten im botanischen Garten, haben wir das natürlich auch. Wir hoffen, die Audio-Zuhörer dann vielleicht auch auf Balkon oder Ähnlichem. Ich möchte gern nochmal in die Runde blicken.
Gast: Ich hab gleich zwei Fragen. Die erste Frage, da möchte ich ein bisschen was vorher sagen. Also ich kann mich gut erinnern, als Kind hatte ich ne besondere Beziehung zu Bäumen. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und da gab es immer so Bäume, wo ich gern hingegangen bin und die so ein bisschen mein Seelentröster und mein Beichtvater waren. Jetzt im Alter fange ich wieder an mich mit Bäumen zu beschäftigen und Wohlleben ist gerade bei mir in meiner aktuellen Bücherliste mit drin, den lese ich gerade. Für mich ist jetzt mal interessant: Wieso haben Sie sich einem solchen Thema verschrieben? Was gab es bei Ihnen für einen Auslöser? Gab es da irgendetwas? Und die zweite Frage, welcher Baum sind Sie?
Nitzke: Bei der zweiten Frage bin ich froh, dass Sie mir nicht als erste die Frage stellen. Als man mir erstmals diese Frage gestellt hat, bin ich beinah vom Stuhl gefallen, weil ich bei allem Reden darüber, wie sehr ich mich gerne an den Grenzen bewege, natürlich schön in meiner Wissenschaftsposition sitzen bleibe.
Also zur ersten Frage. Ich mochte Bäume auch immer schon, aber da bin ich auch nicht alleine, also, das ist auch das Schöne an dem Thema. Die meisten Leute unterhalten sich gerne auch über Bäume und eigentlichem haben fast alle solche Bäume. Ich hatte auch… Also bei uns gabs so eine schöne Buche im sogenannten „Sumpf“, also da war so ein unbebautes Gebiet hinter dem Haus, wo ich aufgewachsen bin - das gibt es jetzt natürlich nicht mehr – und da konnte man ganz gut drauf klettern und lesen und da hab ich immer geschmollt, als ich 13 war. Das war ein guter Baum. Wie das gekommen ist, ist ganz profan. Ich musste mir ein Habilitationsprojekt suchen und meine Chefin damals in Wien hat ganz klar gesagt, „Jetzt kannste nicht wieder sowas abgefahrenes mache. Jetzt musst du dir mal was vernünftiges suchen, was auch nach Germanistik aussieht“. Ja, ist kein Spaß. „Guck doch mal, ob du Klima irgendwie mit Österreich zusammenkriegst, weil wir sind ja in Wien“. Und dann bin ich über die Dorfgeschichten zum Wald gekommen. Und das ist auch ein tolles Thema, ja keine Frage, ich finde dann auch da irgendwie coole Sachen. Und dann sieht das Buch von außen aus wie Germanistik, und da krieg ich schon noch was rein was Spaß macht. So und dann kam eine Kollegin aus Bochum über Facebook - also auch die bösen sozialen Medien – und sagte „Wär doch eigentlich mal witzig, wenn mal einer was über Bäume macht.“ Daraus ist dieses Buch entstanden. Und dann hab ich angefangen zu lesen, konnte echt nicht mehr aufhören. Weil da eben auch solche Sachen kommen… Dann kann ich jetzt noch einen Literaturtipp geben: „Der Gesang der Bäume“ von David G. Haskell. Das wird Ihnen richtig gut gefallen. Kann ich gleich nochmal sagen.... Weil das auch so ein Zwischending ist. Der ist auch Forstökologe und machte diese Sachen.
So und ich muss zugeben, seit ich das mit den Bäumen mache, mach ich auch Sachen im Selbstversuch. Also ich steh viel öfter nah dran und fass auch mal an. Ich gucke immer, dass nicht so viele Leute das sehen, wenn ich allzu umarmig werde. Und auch aus Prinzip. Ja, wenn mich das nächste Mal beim Germanistentag einer fragt „Fängste jetzt auch an, mit dem Bäume umarmen“, sag ich: „Klar, du nicht?“-
So, welcher Baum ich wäre? Also, gestern habe ich behauptet, ich wäre gerne eine Zitterpappel. Weil, wie man in einer völlig windstillen 38°-Hitze stehen kann und trotzdem noch so elegant vor sich hin rauscht…. Das würde ich gern auch können. Also, ich muss gar nicht so ein ganz uralter sein, aber so ne Pappel, das wär schon so ein Ding.
Gast: Sie haben ja nun gesagt, dass Sie ein ganz gut gefülltes Bücherregal mit jeder Menge Baumbüchern haben und haben Sie denn da ein Lieblingsbuch?
Nitzke: Ja jede Woche ein Neues! Also ja, auch so ein Zwischending zwischen Literatur und Nature Writing. Das gibt es jetzt leider noch nicht in deutscher Übersetzung von Fiona Stafford, die ist Literaturwissenschaftlerin in Oxford. „The long long life of Trees“ – Das lange lange Leben der Bäume. Und da geht sie so die Baumarten durch und sammelt eben auch alle Geschichten, die man dazu so finden kann. Das finde ich wirklich, wirklich toll und ansonsten bei den Romanen kann ich mich nicht so festlegen. Also Esther Kinski hat mich schon sehr sehr beeindruckt. Aber das ist jetzt nicht so ein Lieblingsbuch wo ich sagen würde, da setze ich mich mal gemütlich in meinen Sessel. Das ist wirklich eins, das hat mich wirklich beeindruckt, weil es einen auch aufwühlt, auf eine besondere Weise. Und die Haskell-Bücher sind toll. Die sind wirklich toll.
Diringer: Also auch wieder eine breite Empfehlung. Wir setzen uns dann auch die nächsten Tage gleich an den Schreibtisch, um uns eine Prioritätenliste zu schreiben
Gast: Dann vielleicht eine gute Anschlussfrage. Und zwar würde mich interessieren, wie du aussuchst, mit welchen Büchern du dich beschäftigst. Gerade auch, wenn du sagst, dass die Auswahl so groß ist. Und das andere, was ich mit in die Diskussion bringen wollte. In den letzten Tagen hatten wir von der tuuwi aus einen Projekttag zu Wildnispädagogik organisiert. Und da Wahrnehmungsübungen gemacht. Und das rundet das ganze jetzt ganz gut ab. Und ich find das auch ganz spannend, denn ich habe gerade auch Martha Nussbaum gelesen. Und das scheint sich auch so viel auf emotionstheoretischere oder emotionshaftere Forschung zu begeben. Also zu verstehen, dass wir die Sachen rational betrachten können, aber auch Emotionen mit ienbeziehen sollen. Das wollte ich mit anbringen, weil ich glaube, dass das etwas ist, das du auch mit anstoßen möchtest. Aber ansonsten würde mich interessieren, wie du die Auswahl überhaupt triffst.
Nitzke: Also von hinten her beantwortet: Das ist so. Du warst ja bei mir auch schon im Seminar, du weißt das auch. Also, beim ganz schmusigen hör ich auf. Ich mag schon, auch wenn das dann literaturwissenschaftlich fundiert ist, wenn man weiß… Also, es ist für mich schon auch was anderes, wenn ich in so einer Runde hier drüber rede. Also von jetzt aus glaube ich nicht, dass ich sage, welcher Baum ich bin, in dem Buch was ich schreibe. Ich möchte es nicht ausschließen. Aber das ist schon so, dass diese Emotionssachen… und das ist natürlich, wenn man Martha Nussbaum dazu nimmt, hat man eine Gewährsform um diese Sachen. Aber es gibt eben verschiedene Wege, Dinge zu wissen, die auch verschiedene … Also die müssen nicht einfach nur, weil ich das halt so finde, sondern die eben auch bestimmte Sachen auslösen. Und da glaube ich, braucht es tatsächlichen Diskurs, auch zu sagen, dass auch Emotionen nicht total beliebig sind. Also nur weil ich gerade finde „Das und das wirkt bei mir nicht“. Wenn dann 20 Studien zeigen: „Doch“. Dann kann ich das finden, wie ich will, dann ist das Blödsinn. Also, das ist mir wirklich wichtig, dass das dazu kommt.
Aber mit dem Aussuchen... Das ist jetzt gerade die ganz große Aufgabe, vor der ich stehe. Also ich suche natürlich überhaupt nicht aus, wie man auch an meinen langen Antworten merkt. Sondern ich quetschte einfach so viel ich kann in so Sachen rein. Aber ich ordne das systematisch, also ich guck mir zum Beispiel… Hier „Hain“ interessiert mich, weil das um Mediatisierung von Bäumen geht. Ja, das gibt es bei Richard Powers zum Beispiel auch. Und dann suche ich mir einen Vergleichspunkt aus. Also, ich gucke mir zum Beispiel an, in dem Fall ist das „Fotografieren und Bäume“. Welche Medien, welche Techniken, welche Technologien setzen Texte ein, um Bäume oder bestimmte Eigenschaften von Bäumen plausibel zu machen in einem Text. Und hier ist es eben die Kamera, die bestimmte Dinge festhält und da geht es im Trauer, um die Frage eben auch „Kann man Erinnerungen eigentlich festhalten“.
Und interessanterweise, da ist sie nicht die einzige, sind solche Lebensbäume, die man hat, ja, also zu denen man eine Beziehung hat - wahrscheinlich ist der Baum im Garten bei der Oma ein wichtigerer Erinnerungs-Bezugspunkt als die Fotoalben. Bisschen runtergebrochen, aber das… Oder es gibt so eine Szene bei Richard Powers, wo dann jemand ein Daumenkino aus Bäumen macht, irgendwie über sechs Generationen. Ja, und am Ende hat man 1000 Fotos und kann sehen, wie der halt im Zeitraffer wächst. Und sowas guck ich mir eben an. Also ich guck mir Zeit an und ich guck mir Baumverwandlung an. So mach ich das. Also ich bin ja studierte Komparatistin, also vergleichende Literaturwissenschaftlerin. Und Äpfel und Birnen vergleicht man, indem
Man ein Drittes des Vergleichs, ein tertium comparationis, findet. Man sagt, das ist alles Obst und dann kann man diese Dinge alle zusammenbringen. Aber es wird ziemlich… ich fürchte das wird wie bei meinen Vorträgen und solchen Sachen auch… das wird halt ziemlich dicht. Also das wird wirklich sehr viel zusammenziehen und das ist mir auch wichtig. Also ist glaube, es bringt nichts, wenn ich da drei Close Readings mache und drei Romane sehr schön ausinterpretiere. Sondern ich will ja auch zeigen, dass es wirklich eine Literatur ist, die eben auch, sich über die Bäume so verschiedene Texte verbindet, die dann bestimmte Themen sozusagen nach vorne bringen.
Also suche ich nicht aus, und alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich endlich hinsetze und den Mist runterschreibe, kommt halt rein und dann wahrscheinlich noch 20 Sachen. Und dann wird es mir irgendwann ein Lektorin aus den Händen reißen müssen und schnell zum Drucker bringen und dann steht fest, was drin vorkommt. Das sollte ich natürlich jemanden, von dem ich Hausarbeiten einsammle, nicht verraten, dass ich so arbeite.
Diringer: Ein breites Thema. Wir sind auch so langsam gegen Ende der Veranstaltung. Aber ich seh jetzt noch eine Frage und dann hätte ich auch noch ein paar abschließende Worte an dich. Aber wir nehmen gern noch die letzte Wortmeldung.
Gast: Bis jetzt haben Sie ja Literatur vorgestellt. Und das Lesen ist ja eine tolle Unterhaltung. Was erwarten Sie jetzt eigentlich von den Menschen, die ihre Bücher lesen. Was erwarten Sie von den Menschen in Bezug auf die Bäume, auf die Natur und auf die Landschaftsgestaltung. Es muss sich doch auswirken irgendwo?
Nitzke: Also das ist der absolute Traum, dass es das tut. Also eins nochmal: Wenn ich Literatur sage, da meine ich, das sehr breit. Da zähle ich Wohlleben… also alles was zwischen zwei Buchdeckel passt, ist in meiner Welt Literatur erstmal. Ich guck mir auch zum Beispiel Ausstellungen an. Ich guck mir Simulationen - es gibt Computersimulation von Bäumen, wo man selbst sozusagen sich einbringt. Also ich mache das medial schon breiter. Sie trauen sich was vorauszusetzen, was ich nicht voraussetze. Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Wenn ich es richtig gut hinkriege, dann kriege ich das Buch vielleicht bei einem großen Verlag unter. Wo es auch vielleicht mal jemand kauft. Üblicherweise lesen das die drei Leute die es hinterher begutachten müssen. Also, wenn ich wirklich Leute dazu kriege, mein Buch zu lesen, das wär schon spitze. Was ich mit dem Buch mache, aber auch sonst mit meiner Arbeit, dass ich heute hier sitze, auch immerhin am Sonntag, dass ich … ich mach viel bei Twitter. Ich hab die Kinderuni letztes, vorletztes Jahr hier gemacht. Das ist mehr sozusagen die Vermittlungsarbeit, die ich mache. Und das, was ich damit erreichen möchte und was ich - zumindest kriege ich das zurückgespiegelt - auch schon erreicht habe, ist, dass Leute anders hingucken. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist das Schönste, was mir bisher passiert ist in meiner Arbeit. Leute schreiben mir: „Ich gucke mir Bäume anders an, seit ich deinen Vortrag gehört hab.“ Und Leute gucken und lesen noch mal anders, finden in Texten andere Dinge, die sie vorher nicht gelesen haben, kommen da noch mal anders rein und fangen selber an zu erzählen.
Das mit den Landschaftsgestaltern, das gehe ich jetzt einfach direkt an. Ich hab mit einem Kollegen, der auch über Dörfer gearbeitet hat, eine Zusammenarbeit, da bin ich jetzt einmal im Jahr. Der Macht mit seinen Landschaftsarchitekt:innen im Kurs immer so eine Projektpräsentation. Und da bin ich quasi Jurymitglied. Und es ist total super, da bin ich einmal im Wintersemester, in der letzten Woche vor Weihnachten. Und eine total schöne Atmosphäre. Und die sollen halt Geschichten schreiben. Der hat so ein Konzept entwickelt, wo ich ehrlich gesagt auch anfangs dachte: „Oh, das ist neu?“. Der schickt seine Leute immer dahin, wo sie was planen sollen. Ich sagte so: „Habt ihr das vorher nicht gemacht.“ Und er sagte: „Nein, normalerweise kriegen Landschaftsplaner den Flurplan und dann planen was und schicken es zurück und irgendwer muss das pflanzen. Und er schickt die Leute wirklich dahin. Da gibt es dann so Wandersachen und so. Und da komme ich dann mit rein, da geht’s dann wirklich ums Geschichtenerzählen. Und dann sollen die Geschichtenerzählen und dann komm ich halt dazu – und sag ihnen nicht, was sie da eigentlich gemacht haben, sondern guck aus meiner Perspektive dort drauf. Und ich meine, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, und wenn das noch ein paar Jahre sind… Das ist so ein bisschen… Ich mach immer so eine „Schüler:innen-Rechung“. Wenn vor mir Lehramtsstudent:innen sitzen und sagen „Naja, ich mach ja NUR Lehramt“, sage ich: „Sie machen in den nächsten 40 Jahren diesen Job. Das kann ich von mir nicht behaupten. Da haben Sie jedes Jahr 120 Schüler:innen vor der Nase. Denen erzählen Sie über 40 Jahre immer wieder was über Literatur. SIE sind diejenige, die wirklich Einfluss hat. Und das ist bei den Landschaftsplanern auch so. Und da hoffe ich - bilde ich mir in meinen guten Tagen Motivation ein, dass man da auch was machen kann. Und am Ende ist es sonst einfach nur eine Begeisterung für Texte und Offenheit für die Fragen, die man sich damit stellt.
Diringer: Auf jeden Fall ein schönes Abschlussthema und ich würde sagen, die Stunde ist verflogen. Zumindest kam es mir so vor. Es sind auch sehr spannende Themen. Ich denke, du bleibst vielleicht auch noch fünf Minütchen hier an deinem Buchtisch. An sich glaube ich, war es ein schöner Rundumschlag von Ovid über Tiervergleiche mit E.T.A. Hoffmann. Wir haben uns methodischem Vorgehen angenähert, wie du arbeitest. Jetzt nochmal, welchen Impact, welchen Einfluss du dann auch erhoffst, zu haben. Und vielleicht nochmal als allerabschließendes Wort, um dann auch nochmal an dich zu übergeben als Hauptprotagonistin hier, dann noch die Frage: Was steht denn danach an? Gibt es denn Pläne? Du meintest ja schon, dir muss das Manuskript dann aus den Händen gerissen werden, das klang so, als würdest du nicht direkt einen Plan haben? Zumindest vielleicht zukünftige Ideen?
Nitzke: Naja, also, den Plan muss ich natürlich machen. Solange das Projekt noch läuft, bis März 23, kann ich mir ja vorstellen, ich schreib da für immer dran. Ich habe mich neulich auch gefragt, wie ich mich jemals wieder so für irgendwas interessieren soll. Und dann habe ich nächsten Antrag schon wieder in Planung. Also, die wissenschaftliche Antwort ist da ganz klar. Während ich das mache, schreibe ich die Anträge für die nächsten Stellen. Bewerbe mich. Aber ich meine ganz eindeutig, ist das so ein cooles Thema, und das wird ein Spitzen-Buch und da werden mir Professuren nachgeschmissen. Also, da habe ich keine Sorge. (Lacht) Man hört immer, wer die Wissenschaftler sind: Die, die am lautesten lachen. Naja, also, ich muss mir natürlich nen Job suchen weiterhin, aber ich werde, glaube ich, nicht grundsätzlich mehr von den Leitfragestellungen abweichen. Ich hab ein Problem – äh, ein Projekt zur Wissenschaftskommunikation. Und ich werde die Dörfer auch noch mal aufgreifen, da sitze ich an einem größeren Antrag zur prekären Natur in Europa. Und im Moment stimmen mich die Bäume optimistisch - das war sehr schön - das ist ja auch Drittmittel-gefördert von der Fritz-Thyssen-Stiftung – dass es offensichtlich langsam einen Markt gibt. Leider ist es so, als Wissenschaftlerin brauche ich das. Ich brauche einen Markt, auf dem ich mich bewegen kann, mir meine Nische suche und so was. Und ansonsten, wenn es nicht klappt, in der Universität zu bleiben, dann werde ich einfach meine Quasselfähigkeiten in die Welt nehmen und irgendwie selbst gucken, was ich da noch schreiben kann. Gibt noch viel zu tun.
Diringer: Also auf jeden Fall alle bei Twitter, haben wir ja schon gehört, schauen, was du so am treiben bist. Ich wollte dir schon eine rosige Zukunft prophezeihen, aber eine bäumige Zukunft passt da vielleicht doch ein bisschen besser. Ja, mir bleibt nur noch euch zu sagen: Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ihr euch so rege beteiligt habt. Sehr spannende Fragen auf jeden Fall. Auch an den Botanischen Garten für die Organisation, für die Initiative. Und es ist ja nicht die letzte der Veranstaltungen, wie wir ja schon gehört haben. Als nächstes wird Professor Michael Kobel aus der Kern- und Teilchenphysik, auch unter anderem mit spannenden Modellen, wie ich gehört habe, ganz haptisch hier Dinge vorführen und in Diskussion mit uns einsteigen. Also, merkt euch das schon mal vor, meldet euch fleißig an und wir freuen uns, wenn wieder viele Zuschauer da sind. Und insofern wünsche ich noch einen schönen Sonntagnachmittag und bedanke mich.
Nitzke: Ja, vielen, vielen Dank.