P
- Paciliano (Komturei, Italien)
- Pais, Gualdim (Provinzmeister, Protugal)
- Papsttum und Templer
- Paris (Komturei, Frankreich)
- Paris, Matthäus (Chronist)
- Pariser Neutempler (=Chevaliers de l'Ordre du Temple)
- Patenschaften
- Pavia (Komturei, Italien)
- Payens, Hugues de (M)
- Payns (=Payens, Komturei, Frankreich)
- Peñíscola (Komturei und Burg, Spanien)
- Perchois (Komturei, Frankreich)
- Perigord/Pierregort, Armand/Hermant de (M)
- Perpinyà (Komturei, Spanien)
- Pfarreien
- Pferde
- Philipp du Plessis
- Piacenza (Komturei, Italien)
- Pierre de Montaigu
- Pierrevillers (Komturei, Frankreich)
- Pigazzano, Bianco da (Provinzmeister)
- Plessis, Philipp du (M)
- Polen
- Ponferrada (Komturei, Spanien)
- Pombal (Burg, Portugal)
- Portugal
- Prag (=Praha, Komturei, Tschechien)
- Profess
- Prokuratoren
- Provinzen
- Prozess
Paciliano (Komturei, Italien)
Urkundlich erwähnt wird die Niederlassung zum ersten Mal im Jahr 1228, sie ist aber warscheinlich älter. Die genaue Lage kann heute mangels entsprechender Quellen nicht mehr bestimmt werden.
Komture (nach Bellomo):
~1228 Petrus
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 329f.
Pais, Gualdim (Prvinzmeister, Portugal)

Portugiesische Briefmarke von 1928. Vorbild für das Porträt Gualdim Pais‘ war Gameiros Illustration in der História.
Gualdim Pais ist vermutlich der einzige Templer, über dessen Leben außer Urkunden zeitgenössische Inschriften informieren. Auf einer heute in der alten Sakristei von Tomar befindlichen Marmortafel heißt es „Magister Galdinus“ sei aus einem Adelsgeschlecht in Braga gebürtig gewesen, und König Alfons habe ihn zum Ritter geschlagen. Während dessen Regierungszeit habe er die weltliche Ritterschaft verlassen und sei in den Templerorden eingetreten. Für fünf Jahre habe er im Heiligen Land gedient. Nach Portugal zurückgekehrt, sei er “Templi Portugalis Procurator“ geworden. Während seiner Amtszeit seien mehrere Burgen errichtet worden, darunter Tomar, Almourol und Pombal (ed. Barroca, II, Nr. 136).
Die Kommemorationstafel wurde wohl im 16. Jahrhundert von Almourol nach Tomar gebracht, um damit auch die königlichen Ansprüche über den Christusorden historisch zu untermauern. Weitere solcher Tafeln befinden sich noch in Almourol (ed. Barroca, II, Nr. 137 u. 138).
Genealogische Forschungen konnten ihn einer Familie des Landadels aus der Provinz Minho zuordnen. Er wurde vermutlich an der Kathedralschule in Braga unterrichtet. Viterbo (1865) berichtet, Gualdim Pais sei um 1118 geboren worden und 1139 im Heerlager von Ourique zum Ritter geschlagen worden. Aus dem Orient habe er der Überlieferung nach die Reliquie des Heiligen Gregor von Nazianz mitgebracht.
Nach seinem Einsatz im Heiligen Land war er zunächst 1148 Komtur von Braga. Im Juli 1157 urkundete er zum ersten Mal als Provinzmeister von Portugal, ein Amt, dass er bis zu seinem Tod 1195 innehatte. Während dieser langen Amtszeit war er an der Neuerrichtung, bzw. dem Ausbau mehrerer Burgen beteiligt. Im Namen des Ordens nahm er zahlreiche königliche Schenkungen entgegen, darunter die Region Ceras 1159 (ed. Viterbo, S. 238), wo ab 1160 mit dem Bau der Burg von Tomar begonnen wurde. Ab 1170 erfolgte der Ausbau der Burg von Almourol. Mehrere Rechtsstatuten(„Forals“) für die städtischen Siedlungen bei den jeweiligen Burgen gehen auf Gualdim Pais und seinen Konvent zurück. In ihnen werden sowohl die Einwohner auf die Einhaltung der festgelegten Satzung (Verhalten bei Handgreiflichkeiten, bei Verkäufen, Hausrecht, Erbrecht, zu leistende Abgaben…) verpflichtet, als auch im Gegenzug die Templer, denen die Stadt gehört. Sollten Ordensbrüder die Übereinkunft brechen, mögen sie
„die Strafe Gottes erleiden, und zum Teufel und seinen Engeln hinabfahren und in Ewigkeit bestraft werden, wenn er keine ordnungsgemäße und ausreichende Entschädigung leistet (iuxta die ulcionem confringatur et pereat cum diabolo et angelis eisus sine fine puniendus nis digna satis se emendacione correxerit, ed. PMH I/3)“.
1190 gelang Gualdim Pais und seinen Ordensbrüdern die Verteidigung von Tomar – und damit des Königreiches – gegen die Truppen des Almohadenkönigs Jusuf I. Auch Pais‘ Epitaphplatte ist in der Kirche Santa Maria do Olival in der Stadt Tomar erhalten. Auf ihr heisst es:
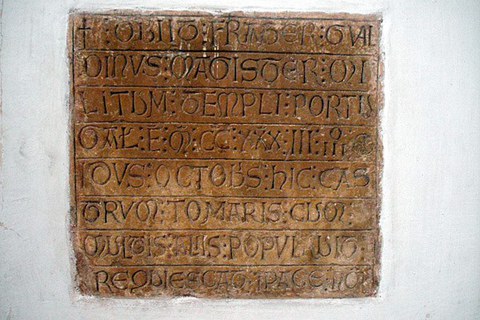
Epitaph von Gualdim Pais. Die Jahreszahl Era 1233 anstatt 1195 erklärt sich aus dem Westgotischen Kalender, den Portugal bis ins 15. Jahrhundert beibehielt.
+ OBIIT : FRATER : GUAL
DINUS : MAGISTER : MI
LITUM : TEMPLI : PORTU
GALIS : ERA : M : CC : XXX : IIIo
IDUS: OCTOBRIS : HIC : CAS
TRUM : TOMARIS : CUM :
MULTIS : ALIIS : POPULAVIT :
REQUIESCAT : IN PACE : AMEN
Die Platte war 1895 zur 700-Jahrfeier feierlich an ihren neuen Platz gesetzt / wieder sichtbar gemacht worden, nachdem sie im 18. Jahrhundert zuletzt in Quellen aufgetaucht war. Eine Inschrift von 1895 informiert zudem, dass dahinter die Urne Gualdim Pais‘ beigesetzt ist – die ursprüngliche Erdbestattung wurde wohl im 16. Jahrhundert beim Umbau der Kirche aufgelöst.
Nachleben
Die Erinnerung an Gualdim Pais als Gründer von Burg und Stadt Tomar wurde nicht zuletzt durch den Christus-Ritterorden aufrechterhalten, deren Sitz die Burg seit 1357 war. Handschriften über Privilegien und Geschichte des Ordens erwähnen den Provinzmeister und seine Großtaten.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, einer Zeit politischer Krisen in Portugal, wurde sich an Gualdim Pais mit romantischer Heldenverehrung erinnert. 1895 erhielt er eine Biographie, der populäre Illustrator Alfredo Roque Gameiro setzte ihn in seiner História de Portugal, popular e ilustrada von 1899 in Szene. Sogar auf einer Briefmarke von 1928 ist Gualdim Pais repräsentiert.
Während der Diktatur von António de Oliveiro Salazar entstandene Statuen (1938 und 1940) kommemorieren ihn als Ritter im Kettenpanzer mit dem Templerkreuz auf Gewand und Schild. Noch heute wird in Tomar der Stadtgründer gefeiert. Touristisch vermarktet beging man in der „Cidade dos Templários“ 2018 den 900sten Geburtstag Gualdim Pais‘, und eine Burgenroute auf seinen Spuren kann auch bereist werden.

Gualdim Pais, Statue von 1938 auf dem Platz der Republik in Tomar, im Hintergrund die Burg. © Filipefirix via Wikimedia, 2011, CC BY-SA-3.0 DEED
Quellen
- Handschrift: Livro das escrituras da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo que El-Rei D. Sebastião Nosso Senhor com administrador perpetuo (e) governador da dita Ordem mandou fazer pelo Dr. Pedro Álvares, do seu Desembargo e cavaleiro professo da dita Ordem, 1560-1568, Lissabon, Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Ordem de Cristo e Convento de Tomar, liv. 234, S. 2v: URL.
- M. J. Barroca, Epigrafia medieval portuguesa, Bd. II, Lissabon 2000, S. 348-361: URL
- Portugaliae Monumenta Historica. Leges et Consuetudines I/3, Lissabon 1863, S. 388f (Foral von Tomar): URL (Bd. 7 der Gesamtausgabe).
Sekundärliteratur
- A. Brandão, Terceira parte da Monarchia lusitana : que contem a historia de Portugal desdo Conde Dom Henrique, até todo o reinado delRey Dom Afonso Henriques..., Lissabon 1632, S. 82 u. 111: URL.
- J. de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram [...], 2. Erweiterte Edition, Porto-Lissabon 1865, Bd. 2, S. 237-240: URL.
- S. Vianna, Gualdim Paes. Seu perfil biographico, synopse e exposição da epoca historica por elle altravessada e dos seus mais importantes factos, Lissabon 1895
Papsttum und Templer
siehe Rom / Templer in päpstlichen Diensten
Paris (Komturei, Frankreich)
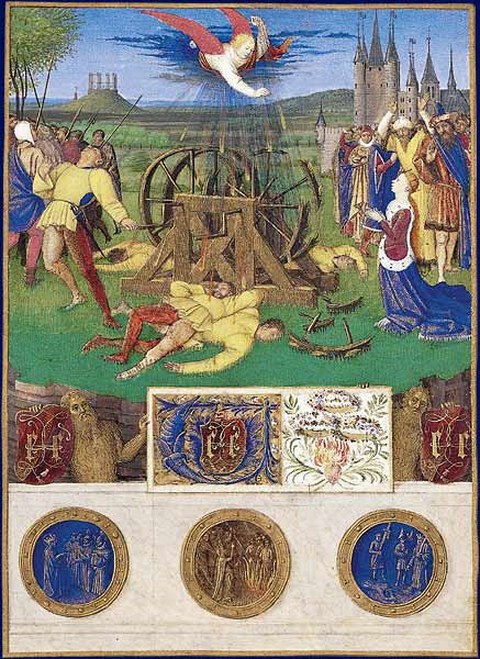
Der „Tour du Temple“ im Hintergrund des Martyriums der Hl. Katharina von Alexandrien, Miniatur von Jean Fouquet, Heures d’Etienne Chevalier. Chantilly, Musée Condé © Wikimedia, Gemeinfrei
Bauliche und territoriale Entwicklung
Genaue Informationen über die Gründung der ersten Niederlassung in Paris fehlen. Fest steht, dass der Orden mehrere Besitzungen in der Stadt hatte. Die älteste erhaltene Urkunde, die den Pariser „Temple“ erwähnt, stammt aus dem Jahr 1146. Im Jahr 1147 fand in Paris ein großes Ordenskapitel mit 300 Brüdern im Beisein Papst Eugens III. und des französischen Königs statt, wie die Schenkungsurkunde Bernard de Balliols verzeichnet. (Lasteyrie, S. 307) Dabei handelt es sich vermutlich um das bei Matthäus Paris vetus Templum und Ende des 13. Jahrhunderts in einer Steuerliste „alter Tempel (viez Temple)“ genannte Haus. Es befand sich in der Nähe der Kirche Saint-Jean-en-Grève am rechten Ufer der Seine, gegenüber der Île de la Cité.
In diesem Bereich befand sich außerdem ein „Kontor“, welches vielleicht zum Lagern der über die Seine transportierten Waren benutzt wurde. Das „Kontor“ geht vermutlich auf die Schenkung von Mathieu de Beaumont im Jahre 1152 zurück. Etwas später verfügten die Templer auch über eine lukrative Mühle, unterhalb der Grand Pont.
Gleichzeitig hatten die Templer Besitz außerhalb der damaligen Stadtmauern, in einem damals teils noch sumpfigen Areal. Die dortige, der Heiligen Maria geweihte, Kirche wurde offenbar nach dem Vorbild der Templerkirche in London, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, errichtet. Sie teilt sich mit diesem Bau zahlreiche Charakteristika. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde der Zentralbau mit einem rechteckigen Chor erweitert, da die Kirche für die Vielzahl der Gottesdienstbesucher zu klein geworden war. Zur Weihe der Kirche 1217 gewährte Papst Honorius den Besuchern eine Indulgenz. Mitte des 13. Jahrhunderts versah man die Kirche mit einem repräsentativen Portalbau, und Ende des 13. Jahrhunderts vergrößerte man den Chor nochmals mit einer Apsis. Als der englische König Henry III. 1254 Paris besuchte, logierte er sowohl im „Alten Temple“ als auch in der Niederlassung „außerhalb von Paris“.
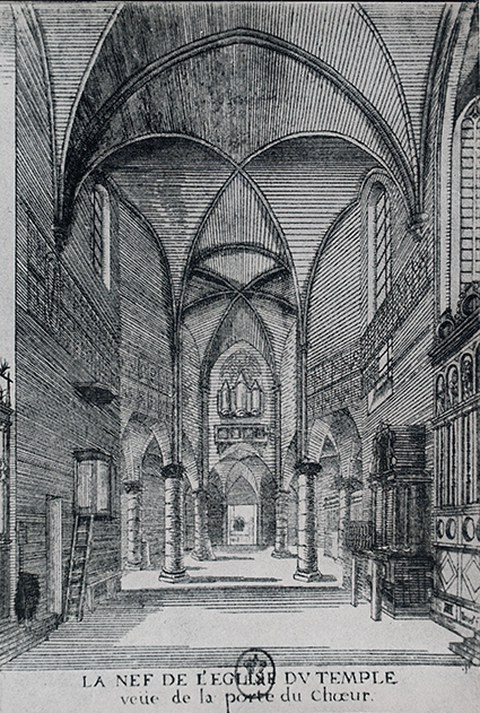
Das Innere der Kirche gen Westen, von der Chorerweiterung des 13. Jahrhunderts aus. Mittig sind die sechs Säulen der alten Rotunde zu erkennen, die in die Anbauten integriert wurde. Stich aus dem 18. Jhd.
Wann genau der berühmte gewaltige „Tour du Temple“ errichtet wurde, ist unklar. Erste Bauvorhaben wurden wohl schon in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts unter Bruder Humbert (gest. 1222) unternommen. Erweiterungen fanden wohl Anfang des 14. Jahrhunderts unter Bruder Jean de la Tour statt. Ein Siegel der Komturei aus dem Jahr 1290 scheint bereits den Donjon zu zeigen. Ein Grund für den massiven Bau - ein von vier Türmen flankierter Donjon von 50 Metern Höhe – könnte die Verwahrung des französischen Kronschatzes sein.
Zur Zeit der Aufhebung des Ordens umfasste der Baukomplex ein großflächiges mauerumschlossenes Areal - den „Enclos du Temple“ -, auf dem sich neben der Kirche ein Friedhof und diverse Handwerksbetriebe, sowie ein Hospital befanden.
Neben dem „Enclos du Temple“ erstreckte sich die „Villeneuve du Temple“, ein zunächst auch landwirtschaftlich genutztes Areal, dass im 13. Jahrhundert aber urbanisiert wurde. Ihre Besitzungen, Einkünfte und Rechte umfassten am Vorabend des Prozesses zahlreiche Geschäfte, Kleinbetriebe und weitere Mühlen.
Beziehungen und Konflikte
Die Niederlassungen des Ordens in Paris dienten nicht nur dem Konvent der Brüder, sondern waren gleichzeitig in das politisch-soziale Leben eingebunden. 1158 wohnte der englische Kanzler Thomas Becket, während seines Besuchs in Paris. 1254 trafen sich dort der englische König Henry III. und Louis IX. von Frankreich. Matthäus Paris berichtet von opulenten Festlichkeiten, aber auch Armenspeisungen, während des Treffens der beiden gekrönten Häupter.
Dass es Konflikte zwischen der Templerniederlassung und den Bürgern Paris gab, beweisen Urkunden aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: 1270 löste die Besteuerung von Pächtern auf Templerland Streit aus, der 1279 in einer Urkunde des Königs geregelt wurde. Das Dokument definiert die Rechte des Königs und seiner Beamten und die der Templer im Pariser Raum genauer: Der Besitz an allen Häusern, sonstigen Liegenschaften und Einkünften innerhalb der Stadtmauern wird bestätigt, hohe und niedere Gerichtsbarkeit reserviert sich hier aber der König. In den Besitzungen außerhalb der Mauern übte der Orden die hohe und niedere Gerichtsbarkeit aus, und die dortigen Pächter sollen von keinen anderen Autoritäten zu Zahlungen oder Leistungen gezwungen werden können. (Curzon, S. 301f).
Wie auch andere Ordenshäuser wurde der „Temple“ von Paris als sicherer Verwahrort für Preziosen und Gelder betrachtet. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts fand sich der Kronschatz nebst den jährlichen Steuergeldern im „Temple“ und wurde von Ordensbrüdern gemeinsam mit königlichen Beamten verwaltet. Die Schatzmeister des Tempels gehörten zu den engen Beratern der Könige. 1281 sollte ein Teil des, vom Zisterzienserorden zu leistenden, päpstlichen Zehnten als Hilfsleistung für das Heilige Land im „Temple“ von Paris eingelagert werden. Eine Aufforderung, der die Zisterzienser nicht nachkamen, wie ein scharf formulierter päpstlicher Brief aus dem Jahr 1281 an den Abt von Cîteaux zeigt. Stattdessen hatten die Weißen Mönche Gelder aus diesen Kreuzzugs-Subsidien König Philipp IV. geliehen. Die Geldknappheit des Königs und die durch ihn durchgeführte Münzabwertung führte 1306 zu einem Volksaufstand, bei welchem Philipp IV. sogar in der Ordensfestung Zuflucht suchen musste.
Für die Annahme, dass der Orden nach dem Verlust Akkons 1291 sein Hauptquartier nach Paris verlegen wollte und die Stadt zur Residenz des Meisters werden sollte, gibt es keine Anhaltspunkte.1307 fand im „Temple“ von Paris noch ein Generalkapitel des Ordens unter Vorsitz von Jacques de Molay statt. Während des Prozesses wurde das Ordenshaus als Verließ für die in Paris und dessen Umland ansässigen Templern genutzt, unter ihnen weilte auch ihr Meister Molay.
Nach dem Prozess kam die Pariser Komturei mit ihren Liegenschaften an die Johanniter und wurde zum Zentrum der Grand Prieuré de France.
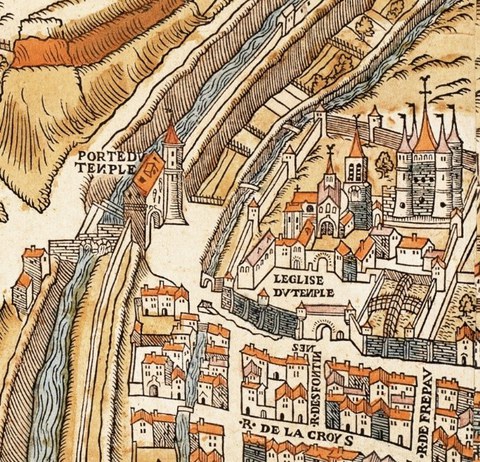
Stadttor, Kirche und Donjon des Temple in Paris, Stadtplan von Truschet/Hoyau (Detail). ©Universitätsbibliothek Basel via Wikimedia
Architektonische Überreste
Der Bauten der Komturei, besonders der prominente Donjon findet sich auf vielen alten Pariser Stadtplänen und Stadtansichten. Die älteste Darstellung ist vermutlich die Miniatur Jean Fouquets im Stundenbuch Etienne Chevaliers aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Teile des „Enclos“ und die Kirche wurden 1796. Viollet-le-Duc rekonstruierte in seinem Architekturlexikon ihr Aussehen anhand der Beschreibungen und Darstellungen Jean Marots und Henri Sauvals. aus dem 17. Jahrhundert. Auf der Grundlage der Pariser Ordenskirche entwickelte Viollet-le-Duc seine Thesen über die „Templerarchitektur“.
Der große Donjon wurde ab 1808 auf Befehl Napoleons abgerissen, um den royalistischen Sammelpunkt (im Temple waren Louis XVII und seine Familie vor der Hinrichtung durch die Revolutionäre inhaftiert) zu beseitigen.
Komture (nach Minnier und Curzon)
~1172 Jean
~1247–1252 Bartholomeus Rufus de Folliaco
~1252–1254 Petrus de Tudela
~1254 Arnaldus Philippus
~1284 Jean de Malay
Quellen
- Chronik des Matthäus Parisiensis, London, Brit. Library MS Royal 14 C VII, fol. 168v–169r: URL.
- Pariser Stadtplan von Olivier Truschet und Germain Hoyau, Universitätsbibliothek Basel, UBH Kartenslg AA 124: URL.
Sekundärliteratur
- H. de Curzon, La maison du Temple à Paris, Paris 1888, S. 301: URL.
- L. Delisle, Mémoire sur les Operations financières des Templiers, (Mémoires de l'Institut national de France, Bd. 33), Paris 1989, Nr. 18. S. 112f (Der päpstliche Brief wegen der Kreuzzugssubsidien der Zisterzienser). Eine Übersetzung findet sich bei: M. Barber / Bate, The Templars. Selected sources translated and annotated, Manchester 2007, S. 208f.
- R. de Lasteyrie (Hg.), Cartulaire general de Paris ou Recueil de documents relatifs à l’histoire et à la topographie de Paris, Bd. 1, Paris 1887, Nr. 334, S. 307.
- G. de la Varende / B. Rascoat, L'enclos du Temple ou: Les Templiers à Paris, Arcy-sur-Lure 1994.
- G. Etienne, Etude topographique sur les possessions de la maison du Temple à Paris, Paris 1974.
- G. Etienne, La Villeneuve du Temple à Paris (100e Congrès national des Societés savantes, Paris 1975), Paris 1977.
- E. Mannier, Les Commanderies du Grand Prieuré de France, Paris 1872, S. 5: URL.
- C. Piton, Une page ignorée de l’histoire du Temple. Le Temple de Paris, Paris 1911: URL.
- H. Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris 1724, Bd. 1, S. 454 (Beschreibung der Kirche).
- E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’Architecture francaise, Bd. IX, Paris 1868, S. 14ff: URL.
Paris, Matthäus (Chronist)

Matthäus von Paris, Selbsbildnis in seiner Historia Anglorum. British Library MS Royal 14 C VII, fol 6v.
Der Chronist wurde um 1200 geboren und starb 1259 in der Benediktinerabtei S. Albans in England. Er verfasste (und illustrierte) die Chronica Maiora, der jedoch keine weite Verbreitung beschieden war, die Historia Anglorum, die Flores Historiarum (=kürzere „Florilegien“ der Chronik), sowie als letztes Werk die Abbreviatio Chronicorum Angliae. Letztere erlangten große Berühmtheit in englischen Kirchenkreisen. Er zählte zu den Partisanen Friedrichs II. und war somit gegen den englischen König und den Papst eingestellt sowie dessen Verbündeten, unter ihnen die Templer (die als Steuereintreiber sowohl für den Papst als auch für den englischen Monarchen eingesetzt waren) und auch die Johanniter. Als Verbündeter von Friedrich II. lobte er den Deutschen Orden, kritisierte jedoch die Bettelorden.
Seine Werke zeigen ihn als einen traditionsbewussten, sehr konservativen Menschen, der in religiösen Belangen jegliches Neue verabscheut, insbesondere die neuen, nicht-benediktinischen Orden mit ihren zahlreichen Privilegien und Exemtionen. Für Matthäus sind die Templer und Johanniter geizig, hinterhältig, stolz, übel beleumdet und ihre Taten schädlich für das Heilige Land. Unter anderem berichtet er, wie die Templer den Staufer Friedrich II. während dessen Kreuzzugsunternehmens 1229 verrieten und ihren Feinden zur Ermordung preisgeben wollten – womit sie Sultan Al-Kamil erst recht die Unwürdigkeit und Hinterhältigkeit der Christen, und insbesondere der Orden mit dem Kreuz auf dem Habit bewiesen: „Quod cum audiret Soldanus […] detestatus est Christianorum versutiam, invidiam, et proditionem, et maxime eorum qui videbantur habitum religionis cum crucis charactere bajulare.“ (ed. Luard, Chronica III, S. 178) Der Sultan wiederum übersendet den kompromittierenden Brief der Ritterorden an den Kaiser, der somit der Falle entkam.
Zuletzt sieht sich der Chronist aber zu einer redaktionellen Richtigstellung veranlasst und gibt zu, dass diese Geschichten nicht der Wahrheit entsprechen. Denn in der Abbreviatio Chronicorum, die wiederum die Verschwörung gegen Friedrich II. im Jahr 1229 erzählt, heißt es: „Qui autem honorem Templi et Hospitalis minime diligunt, haec illis imponunt mentientes. Non enim credibile, ut a viris religiosis tantum nefas scaturiret. (=Jene, die das Ansehen der Templer und Johanniter nicht lieben und sie dieser Taten beschuldigen, lügen. Denn es ist nicht glaubhaft, dass Angehörige eines Ordens solch großer Bosheit fähig sein sollen)” (ed. Madden III, S. 259).
Matthäus berichtet von Querelen und blutigen Kämpfen („inhonesta guerra et infami discordia“) zwischen Templern und Johannitern „worüber sich die Feinde des Kreuzes freuten“ (ed. Luard Chronica IV, S. 167f, S. 256). Auch einen gefälschten Brief, den die Verschwörer Patriarch, Templer und Johanniter über die Lage im Heiligen Land verschickten gibt der Chronist wieder (ed. Luard Chronica III, S. 179–184).
Während des Fünften Kreuzzuges nach Damietta hätten die Templer weise, mutig und diszipliniert auch in verzweifelten Situationen gehandelt, so Matthäus. Im Bericht über die Schlacht von Mansurah während des Sechsten Kreuzzuges lässt er Robert von Artois den Templern vorwerfen, die christliche Sache verraten zu haben, als diese für ein vernünftigeres Vorgehen plädieren. Denn schließlich würden sie ihre lukrative Existenz verlieren, sollte der Feind vollständig besiegt sein: “[…] Timent enim Templarii et formidant Hospitalarii et eorum complices, quod si terra juribus subdatur Christianis, ipsorum expirabit […] dominatio” (ed. Luard Chronica V, S. 149).
Matthäus erwähnt außerdem den Bau von Château de Pélérin und gibt noch einige Einzelheiten über die Geschichte des Ordens in England. In seiner Historia Anglorum berichtet er von der Gründung des Ordens und interpretiert er das Siegel des Meisters, welches zwei auf einem Pferd reitende Ritter zeigt, als Symbol für das Gelübde der Armut und Demut der Templer (ed. Madden I, S. 223)
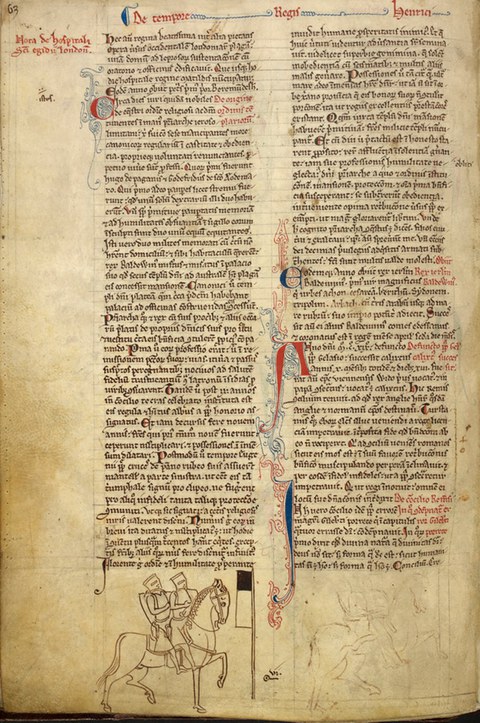
Die Gründung der Templer, Historia Anglorum des Matthäus von Paris, MS Royal 14 C. VII, f.42v
Quellen
- Historia Anglorum des Matthäus Parisiensis, London, Brit. Library MS Royal 14 C VII, fol 42v.
- Chronica Maiora des Matthäus Parisiensis, Cambridge, Corpus Christi College, MS 026: URL.
- Matthew Paris, Chronica Maiora, ed. H. R. Luard, 7 Bde., Rolls Series 57, London 1872–1883, hier Bd. III (URL), S. 46–50 u. S. 177–18, Bd. IV (URL), S. 167f u. S. 197., Bd. V (URL). S. 149, S. 478 u. S. 745
- Matthew Paris, Flores historiarum, ed. H. R. Luard, 3 Bde., Rolls Series 95, London 1890, hier Bd. II, S. 195f, S. 250, S. 264, S. 272.
- Matthew Paris, Historia Anglorum, ed. F. Madden, 3 Bde., Rolls Series 44, London 1860–1869, hier Bd. I (URL), S.222-224, Bd. II (URL), S. 313f, Bd. III (URL), S. 229.
Sekundärliteratur
- A. Demurger, Les Templiers, Matthieu Paris et les sept peches capitaux, in: G. Minucci / F. Sardi (Hg.), I Templari. Mito e storia. Atti del Convegno internazionale di studi alla magione Templare di Poggibonsi-Siena, Siena 1989, S. 153–168.
- H. Nicholson, Templars, Hospitallers and Teutonic Knights. Images of the Military Orders 1128–1291, London 1993, S. 46–48.
- R. Vaughan, Matthew Paris, Cambridge 1958.
Pariser Neutempler (=Chevaliers de l'Ordre du Temple)

Großmeister der Pariser Neutempler
Die Pariser Neutempler erklärten, authentische Nachfolger des mittelalterlichen Ordens zu sein. Als Beweis diente ihnen die Charta Transmissionis, die eine Organisation des Ordens nach der päpstlichen Aufhebung und eine Liste von Meistern bis ins beginnende 19. Jahrhundert enthält. Die Statuten trügen das Datum 1705 und seien von Philippe d'Orleans unterzeichnet. Die veröffentlichte Version der Charta hat allerdings das Datum 1811, woraus Wilcke schließt, dass sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden (Wilcke 1860, II, S. 370). Vermutlich wurden die Dokumente von einem gewissen Ledru gefälscht, einem Arzt der Familie Cossé-Brissac.
Die Wurzeln der Neutempler sind wahrscheinlich bei den Freimaurern der Hochgradsysteme, insbesondere dem „Kapitel von Clermont“ zu suchen. Sie tauchten erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit auf; ihr 1804 amtierender Großmeister Raymond Fabré-Palaprat wirkte als Arzt am Hof Napoleons, der die Templer sehr schätzte.
In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es sowohl zu Streitigkeiten zwischen dem Großmeister und seinen Vikariaten über die religiöse Ausrichtung, als auch zu Unstimmigkeiten zwischen englischen und französischen Mitgliedern, die in die großpolitischen Entwicklungen der Jahre involviert waren. Fabré-Palaprat propagierte ein „johanneisches Christentum“. Die katholische Kirche betrachtete die Neutempler mit Argwohn, da ihre Lehre nicht der katholischen Doktrin entsprach, jedoch pseudo-katholisches Zeremoniell verwendet wurde. 1833 forderte der Papst die „Unterdrückung der Sekte“.
Einige Ordensmitglieder nahmen am griechischen Freiheitskampf gegen die Türken teil und suchten damit Anschluss an die mittelalterlichen Ideale. Ungeachtet voriger Differenzen bat 1850 der damalige Großmeister den nach Frankreich geflüchteten Papst Pius IX. um offizielle Anerkennung des Ordens und sagte ihm dafür Schutz und Hilfe zu. Das Anerbieten blieb folgenlos. Zwischen 1870 und 1871 löste sich die Gemeinschaft auf (Dohrmann, S. 308). Die Regalien (z.B. die Großmeisterkrone) und die Dokumente wurden den Archives nationales übergeben.
Die Pariser Neutempler verfügten über eine ausgefeilte Organisation, Rituale und fürstliche Insignien. Sie behaupteten, die Asche und das Schwert Jacques de Molays zu besitzen. Zum Ort des Martyriums des letzten Meisters wurden „Pilgerfahrten“ organisiert. Großveranstaltungen in Paris wurden mit Pomp inszeniert, so etwa 1808 der Gedenktag Molays in der Kirche Saint-Paul & Saint-Antoine. Die Ordensführung grenzte sich scharf von den Freimaurern und den dort zum Teil geübten Templergraden ab, erlaubte aber in ihren Reihen nicht nur Katholiken, sondern auch Protestanten und Deisten. Mitglieder konnten über neun Grade vom „Leviten“ bis zum „Bischof“ aufsteigen. Glaubensgrundlage der Initiierten war das sogenannte „Levitikon“, in dem sich ein pantheistisches Gottesverständnis zeigt, das von den ägyptischen Mysterien über Moses als eingeweihten Ägypter eine Linie bis zu Jesus und dem Christentum zieht. Jesus habe dem Evangelisten Johannes, nicht Petrus, die Leitung seiner Kirche übertragen.
verwandte Gemeinschaften:
- Ordo Novi Templi (=ONT, Neotemplergemeinschaft)
- Ordo Militiae Crucis Templi (=OMCT, =Deutscher Tempelherren-Orden, Neotemplergemeinschaft)
- Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (=OSMTH)
- Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (=OSMTJ)
- Ordo Templi Orientis (=OTO)
- Templari Cattolici d‘Italia
Quelle
- Paris, Archives nationales, 3AS/1-3AS/38 und AE/VI/a89
Sekundärliteratur
- J. Burnes, Sketch of the History of the Knights Templars, 2. Aufl. Edinburgh 1840, S. 39–53: URL.
- N. Dohrmann, Katalogbeitrag in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann (Hgg.), Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 308 u. 310.
- H. Grégoire, Histoire des sectes religieuses: qui sont nées, se sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes contrées du globe, depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle, Bd. 2, Paris 1828, S. 392–428.
- P. Partner, The Murdered Magicians. The Templars and their Myth, Oxford 1982.
- W. F. Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherren, 2. umgearbeitete und verbesserte Auflage, Halle 1860, Bd. 2, S. 363–402: URL.
Patenschaften
Laut der Regel (§ 71 bzw. 72) war den Brüdern des Templerordens untersagt, Taufpate zu werden. Das im entsprechenden Paragraphen genannte Problem war nicht das Sakrament an sich, sondern die dabei gegebene Nähe zu Frauen, oder sogar mit ihnen getauschte Küsse:
„Omnibus quidem tam militibus quam clientibus generaliter precipimus, ut nullus amodo infantes levare a fonte presumat, et non sit ei pudor iin tali sacramento compatres et commatres refutare, quia talis pudor magis adducit gloriam quam peccatum et proculdubio non parat femineum osculum“ (ed. Schnürer, S. 153). Ausnahmen oder Strafen bei Zuwiderhandlungen werden nicht genannt.
Das Verbot war einer der Anklagepunkte, die in der Chronique de Saint Denis als Beweis für eine Häresie der Templer aufgeführt werden. Es handelte sich jedoch um ein in der monastischen Welt übliches, kirchenrechtlich fundiertes Verbot. Die Synode von Poitiers hatte 1109 deutlich formuliert, dass kein Mönch sich irgendwelche Pfarrhandlungen anmaßen dürfe, die dem Regularklerus vorbehalten waren. Darunter fielen taufen, predigen und das Bußsakrament spenden. Hintergrund war nicht nur, dass die Mönche sich von der Welt fernhalten sollten, sondern auch die Frage etwaiger mit der Sakramentenspendung verbundener Einkünfte.
Man findet das Taufverbot ausdrücklich bei den Zisterziensern (Statuten der Generalkapitel von 1157, 1185 und 1186). Hier betrifft es den Abt, der bei Zuwiderhandlung drei Tage in „leichter Buße“ (=Fasten bei Wasser und Brot) zu verharren hat, falls er das Kind aus dem Taufbecken gehoben hat. Falls er – da er im Gegensatz zu den angesprochen Templerbrüdern die geistlichen Weihen besaß - die Taufe selbst vorgenommen oder das Wasser gesegnet hat, standen sechs Tage in „leichter Buße“ an. Außerdem durfte nicht im Abtsplatz des Chorgestühls gestanden werden. Das Gleiche galt für Mönche, auch wenn sie mit Erlaubnis des Abtes gehandelt hatten. Dass das Verbot nicht eingehalten wurde, zeigt seine Wiederholung im folgenden Jahr, wo ein Generalkapitelbeschluss nochmals präzisiert, dass Beteiligung an Kindstaufen „contra Canones et instituta Ordinis“, also gegen das Kirchenrecht und die Ordensbestimmungen sei. Das Strafmaß bei Zuwiderhandlung wird noch einmal erhöht. Die Regula Bullata der Franziskaner (Cap. XI) kennt daher das Verbot ebenfalls. Auch im Deutschen Orden war es untersagt, als Pate zu fungieren – mit der Ausnahme allerdings, dass Todesgefahr für den Täufling bestanden hätte.
Trotz des Verbotes wurde Meister Reynaud de Vichiers für den Sohn des französischen Königs Louis IX. Pate. Dort wo der Orden Pfarreien bediente, hatten die dort tätigen Pfarrer (die nicht unbedingt Kapläne der Templer waren) selbstverständlich das Recht, Kinder zu taufen.
Anke Napp
Quellen:
- H. de Curzon, La règle du Temple, Paris 1886, § 72, S. 70: URL
- L. Holst (Hg.), Codex Regularum monasticarum et canonicarum Bd. II, Augsburg 1759, S. 397 (Zisterzienser-Generalkapitel 1157) und S. 404 (Zisterzienser-Generalkapitel 1185 und 1186): URL
- J. D. Mansi (Hg.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Bd. 20, Venedig 1775, Sp. 1124.
- M. Perlbach, Die Statuten des Deutschen Ordens, Halle 1890, § 28, S. 51: URL
- G. Schnürer, Die ursprüngliche Templerregel, Freiburg 1903, § 71, S. 153: URL
- Chronik von St. Denis, Handschrift BNF Ms fr. 2608, fol. 387v.: URL.
Paulhac (Komturei, Frankreich)

Außenansicht der Templerkapelle St. Jean
Die Komturei von Paulhac wird 1189 im Kartular des Prioräts von St. Barthelemy erwähnt. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden hier mehrere Provinzialkapitel abgehalten. Paulhac hatte Besitzungen in Fursac, Bourget, Mas, Coutures, und verfügte auch über drei Mühlen. Während des Prozesses wurden mehrere Brüder aus Paulhac verhört, darunter der letzte Komtur Humbert de Comborn. 1312 kam die Niederlassung an die Johanniter.
Im 15. Jahrhundert fanden einige Umbauten im Ensemble der Komturei statt; auch die Kapelle war davon betroffen. In ihr finden sich Reste der ursprünglichen Ausmalung: Kreuze, Lilien aus dem 12. Jahrhundert, zu denen in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts die Apostelmartyrien und eine Madonna traten.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Aubarbier, J.-L., Binet, M.: Les Sites Templiers de France, Rennes 1995, S. 84.
- Krüger, A.: Schuld oder Präjudizierung. Die Protokolle des Templerprozesses im Textvergleich, in: Hjb 117 (1997), 340-377.
- Voyer, C.: Orner la maison de Dieu. Les décors de quelques églises Templières et Hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem au XIIIe siècle, in: Carraz, Damien / Dehoux, Esther (Hrsg.): Images et ornements autour des ordres militaires au Moyen Âge, Toulouse 2016, S. 85-101, bes. S. 88 u. 95.
Pavia (Komturei, Italien)
In Pavia besaß der Orden mehrere Liegenschaften, darunter das Hospital Sant'Eustachio, die Kirche San Guglielmo und die Kirche San Damiano in Linarolo. Das älteste Dokument, das möglicherweise eine Anwesenheit der Templer in der Stadt bestätigt, stammt jedoch erst aus dem Jahr 1181. Einen sicheren Nachweis gibt es erst 1201, mit der Übereignung des Hospitals Sant-Eustachio durch Bischof Bernardo. Die Templer vertrat hierbei Provinzmeister Barozio. Interessanterweise bezahlten der Orden dem Bischof eine jährliche Pacht für das Hospital. Casei war eine Dependance von Pavia. Das Haus erhielt offenbar gegen 1270 des 13. Jh. einen eigenen Komtur, wurde aber in späteren Jahren wieder in Personalunion mit Pavia verwaltet.
Während des Prozesses gegen den Orden wurden die Besitzungen von Pavia zunächst durch den Inquisitor Filippo de Cumis verwaltet, ab 1309 von den Vikaren der Erzbischöfe von Ravenna und Pisa. Schließlich wurde ein Kleriker aus Pavia, Rogerio da Milano, Rektor von Sa. Maria della Scaletta, mit der schwierigen Aufgabe betraut. Zum einen hatte er den Plünderungen und Zerstörungen von Templereigentum Einhalt zu gebieten, zum anderen sich den Forderungen der Kommunen von Pavia und Tortona zur Freilassung der Ordensbrüder zu stellen. Dieser Einsatz der städtischen Autoritäten zeigt einmal mehr das gute Einvernehmen zwischen diesen und dem Templerorden. In den Prozessunterlagen tauchen vier Ordensbrüder aus Pavia auf, darunter ein Kaplan.
Sant'Eustachio befand sich außerhalb der Stadtmauern, im Osten, an der Straße nach Cremona und in der Nähe der Kirche San Guglielmo, die 1201 bereits den Templern gehörte. Die Straße wurde stark von Pilgern frequentiert. Die Inventare aus der Inquisitionsverwaltung geben ein genaues Bild von den Besitzungen und Einkünften der Komturei. Das zugehörige Haus S. Damiano, gelegen an der Straße nach Casalpusterlengo, ungefähr 10 km von Pavia entfernt, war Sammelpunkt für die Produkte aus den Landgütern (Getreide, Wein, Heu). Außerdem gab es eine Schweinezucht. Die Haupteinkunftsquelle waren aber die Mieten und Pachten, die für die etwa 100 (!) im Besitz des Ordens befindlichen Häuser gezahlt wurden. Auch in Monticello und Castagneto hatten die Templer Landbesitz.
Nach dem Ende des Prozesses kam der Besitz an die Johanniter. Die Kirche S. Guglielmo wurde während der Belagerung der Stadt 1525 stark beschädigt und nicht erneut repariert.
Komture (nach Bellomo):
~1228 Bonifacio
~1252 Enrico di Ponzone
~1268 - 1271 Niccolò Barachino
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 294ff.
Payens, Hugues de (M)
Er war der Gründer des Templerordens und sein erster Meister. Um 1070 geboren - ein Datum, das man aus den Nennungen in Urkunden am Hof des Grafen Hugues de Champagne errechnen kann - wurde er um 1085/90 vermutlich zum Ritter geschlagen, denn in einer Urkunde taucht er als Herr von Montigny auf. Zwischen 1108 und 1114 heiratete er Elisabeth de Chappes. Das Paar hatte vermutlich drei Kinder: Gibuin, Isabelle und Thibaud. Letzterer wurde Abt von Saint-Colombe. Möglicherweise war Hugues verwandt mit dem Grafen der Champagne. Mit ihm kam er jedenfalls ins Heilige Land, zum ersten Mal vermutlich im Jahre 1104. 1113 wird er in der Urkunde einer Schenkung Hugues de Champagne an die Abtei von Montiéramey zum ersten und einzigen Mal als 'Herr von Payens' bezeichnet. Im selben Jahr aufs Neue in Palästina, begann er einige Gefährten um sich zu sammeln, um die durch moslemische Überfälle immer noch bedrohten Pilger zu beschützen und legte so den Grundstein für den späteren Templerorden. Laut der Chronik von Ernoul lebten er und seine Gefährten unter der Obödienz der Kanoniker vom Heiligen Grab. 1119 legten Hugues und seine Gefährten die monastischen Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut in die Hände des Patriarchen von Jerusalem ab und verpflichteten sich mit einem vierten Gelübde, die Pilger und die Heiligen Stätten zu schützen. Dass er und seine Gefährten geschätzte Personen waren, zeigt sich in ihrem Auftauchen als Zeugen in Urkunden König Balduins II. von Jerusalem. Iin einer von ihnen wird er 1125 "magister militum templi" genannt. Hugues arbeitete selbst die wichtigsten Punkte der Regel aus, die er auf dem Konzil zu Troyes 1129 erläuterte. Er kümmerte sich sowohl um das spirituelle Wachstum seiner Gemeinschaft (durch seinen Kontakt zu Bernhard von Clairvaux, der in der Schrift De laude novae militia' gipfelte), als auch um das materielle, und reiste mehrere Monate durch Frankreich, England und Schottland, um für Nachwuchs und Schenkungen zu werben. Um 1129 kehrte er ins Heilige Land zurück und im selben Jahr führte er seine Brüder in die erste Schlacht, in welcher fast alle umkamen. Hugues starb 1136 oder 1137.
Urkunden, in denen Hugues de Payens genannt wird (pdf-Liste, auf Französisch. Quelle: Leroy)
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Bulst-Thiele, M. L.: Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S.19-29.
- Leroy, T.: Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.
- Leroy, T.: Les fondateurs de l'Ordre du Temple, in: Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne (Ausstellungskatalog), Paris 2012, S. 35-39.
- Phillips, J.: Hugh of Payns and the 1129 Damascus crusade, dans: The Military Orders, 141-147.
- www.huguesdepayns.fr = das Museum in Payns
Payns (=Payens, Komturei, Frankreich)
Das Dorf Payns, welches nach dem der Gründer des Ordens benannt wird, liegt heute etwa 12 km von Troyes entfernt im sumpfigen Seinetal. Etwa 27 verschiedene Schreibweisen können über das gesamte Mittelalter für den Ort festgestellt werden. Dass der Name auf antikes Heidentum (=„paganis“) zurückgeht, ist erst eine spätere mündliche Tradition.
Bauliche und territoriale Entwicklung
Die Grundsteinlegung des Besitzes der Komturei erfolgte sehr wahrscheinlich durch eine Schenkung von Hugues de Payens selbst, vielleicht während des Aufenthaltes des Ordensgründers anlässlich des Konzils von Troyes 1129. Eine Urkunde diesbezüglich ist nicht mehr vorhanden. Bis in das 14. Jahrhundert hinein erfolgten weitere Schenkungen durch den lokalen Adel: 1153 übergab Humbert de Caie die Hälfte seines Großen Zehnten des Lehens von Savières. 1181 übereignete Maria, Witwe des damaligen Grafen der Champagne, „zur Erlangung ihres Seelenheils und des ihres verstorbenen Gemahls“, einen festgesetzten Teil der jährlichen Ernte ihrer Besitzungen in Payns. Auch via Kauf vermehrte sich der Besitz: 1209 verkaufte der Prior der Heilig-Grab-Niederlassung von La Charité-sur-Loire der Komturei von Payns die Mühlen von Espincey, sowie die Rechte des Priorats in Trouan, Chapelle-Vallon, Belleville und anderen Lokalitäten außerhalb der Diözese von Troyes, alles für 8000 Livres.
Nicht nur Güter, sondern auch Menschen wechselten als Leibeigene den Besitzer. So schenkte 1225 Pierre de Précy der Komturei einen Mann namens Etienne le Roux, seine zwei Söhne, und deren Güter. Die Templer zahlten 20 Livres als „Anerkennung“. 1234 gingen Güter und Rechte der Abtei Saint-Benoît-sur-Loire in das Eigentum der Komturei von Payns über, gegen die jährliche Zahlung von 15 Sester Getreide und 30 Sous, die am Allerheiligen-Vorabend zu leisten war.
Den Höhepunkt ihrer territorialen Expansion erlebte die Komturei im 13. Jahrhundert. Am Ende der Entwicklung stand eine bedeutende landwirtschaftliche Niederlassung, die in der gesamten Region Besitzungen und Rechte besaß, sowie eine abhängige Komturei in Belleville.
Am 13. Oktober 1307, kurz nach der Verhaftung der Ordensbrüder in den französischen Kronlanden, stellte ein königlicher Beamter das Inventar der in Payns gefundenen beweglichen Güter auf. Es sind Dinge des täglichen Bedarfs, wie Schüsseln und Kessel in der Küche und Bettzeug. Im Zimmer des Komturs befand sich eine Truhe mit den Pretiosen der Kapelle des Ordenshauses: zum Beispiel ein Kelch aus vergoldetem Silber, Wasserkännchen aus Kupfer, Kerzenständer aus Eisen und zwei emaillierte Kreuze sowie liturgische Bücher: ein Missale, ein Ordinarium, ein Brevier und einen Psalter, sowie ein Antiphonar.
Zur Komturei gehörten neben den Ordensbrüdern (zur Zeit des Prozesses vielleicht 6–10) auch bezahlte Knechte, insgesamt 27 Personen. Im Bedarfsfall (zur Erntezeit beispielsweise, oder wenn ein Gebäude errichtet werden musste) wurden die entsprechenden zusätzlichen Fachkräfte angeheuert. In einem Jahr beliefen sich die Einkünfte der Komturei auf 250 Livres und die Ausgaben - zumeist Abgaben für die Verteidigungsaufgaben im Orient - auf 189 Livres. Die Komturei ging nach dem Ende des Ordens an die Johanniter, die sie im 14. Jahrhundert mit der Komturei von Troyes zusammen legten. Bis in das 17. Jahrhundert behielten sie Teile der Güter.
Beziehungen und Konflikte
Die Schenkungsurkunden zeigen, dass die Komturei in die Region fest integriert war. Nicht nur Mitglieder des Adels und des Klerus schenkten oder verkauften der Niederlassung Rechte und Güter. 1265 übereigneten zwei Einwohner des Dorfes Payns der Komturei den Teil eines Weinberges und ein kleines Stück Land, Arbeitstiere, sowie Bettzeug und Federbetten, um später auf dem Friedhof der Komturei bestattet zu werden.
Eine Urkunde gibt auch Auskunft über die Tätigkeit der Templer im mittelalterlichen Geldwesen: Um seine Teilnahme an einem Kreuzzugsunternehmen finanzieren zu können, lieh sich Henri de Saint-Mesmin 200 Livres von den Templern in Payns. Sozusagen als Zinszahlung autorisierte er die Ordensbrüder, die Einkünfte aus den Gütern von Fontaine und Saint-Mesmin zu behalten, bis die 200 Livres zurück gezahlt seien. Auch nach Abgeltung der Schuld sollten die Templer die Einkünfte weiter erhalten, diesmal jedoch, um sie für den Tag der Rückkehr Henrys vom Kreuzzug sicher zu stellen. Diese Übereinkunft wurde 1218 von der Witwe des Grafen Thibaud III. ratifiziert.
Architektonische Überreste
Bauliche Überreste sind bis auf die bei einer archäologischen Sondierung 1998 freigelegten Grundmauern der Kapelle, die der Heiligen Maria Magdalena geweiht war, heute keine mehr vorhanden. Die Kapelle war ein einfaches Gebäude auf rechteckigem Grundriss (wie man sie auch in Avalleur und Fresnoy findet), mit drei Jochen, insgesamt mit einer Länge von 20 m und 9 m Breite.
Heute ist am Ort ein Templermuseum eingerichtet und der Verein L’association Culturelle Hugues de Payns bemüht sich um Wiederbelebung des Ortes durch Reenactment und weitere Aktivitäten.
Komture:
~1262 André de Joigny
~1307 Ponsard de Gizy
Sekundärliteratur
- Th. Leroy, Les fondateurs de l’ordre du Temple, in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann, (Hgg.), Les Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 35–39.
- Th. Leroy, 1127–1143. L’organisation du réseau templier en Champagne, in: A. Baudin / G. Brunel / N. Dohrmann, (Hgg.), Les Templiers. De Jérusalem aux commanderies de Champagne, Paris 2012, S. 117–122.
- Th. Leroy, Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.
- E. Mannier, Ordre de Malte. Les commanderies du Grand-prieuré de France, d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris, Paris 1872, S. 309f.
- Webseite des Vereins L’association Culturelle Hugues de Payns: URL.
Peñíscola (Komturei und Burg, Spanien)
Der Ort wurde erst im Jahre 1294 zusammen mit Tortosa von König Jayme II. dem Orden übertragen, der den Ausbau der Burganlage auf der Felseninsel in Angriff nahm. Über dem Eingang zur Kapelle findet sich noch das Wappen des damaligen Provinzmeisters, Berengar de Cardona. Bekannt ist die Burganlage weniger durch das kurze Intermezzo der Templer, als die Tatsache, dass sie im 15. Jahrhundert Residenz des abgesetzten Papstes Pedro de Luna wurde, für den auch einige der alten Gemächer umgebaut wurden.
Trotz späterer Beschädigungen und baulicher Veränderungen ist die Burg weitgehend in ihrem Zustand vom Ende des 13. Jahrhunderts erhalten: mehrere tonnengewölbte Hallen umgeben den polygonalen Hof. Zwei der vier Türme sind allerdings nur noch im Unterbau zu erahnen. Auch ein rippengewölbter Saal an der Ostseite ist zerstört. Die Kapelle (rechteckig ummantelter Saalbau mit halbrunder Apsis)- sehr wahrscheinlich aus dem Ursprungsbau, also älter als die Übereignung an den Orden -, Loggia, Küchenbereich und Refektorium sind erhalten. Inventare des liturgischen Geräts, der Reliquien und Bücher zeigen, dass die Kapelle sehr reich ausgestattet war.

Peñiscola von der Seeseite
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Plaza Arqué, Carme: Dos castillos templarios en el norte del reino de Valencia: Xivert y Peñíscola, in: Castelos das ordens militares, Lissabon 2014, S. 45-62.
- Salvadó, Sebastián: Icons, Crosses and the Liturgical Objects of Templar Chapels in the Crown of Aragon, in: Nicholson, H., Crawford, Paul F., Burgtorf, J. (Hrsg.): The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314), Aldershot 2010, S. 183-189 (mit Archivangaben zu allen bisher gefundenen Inventaren der Ordenshäuser!)
Perchois (Komturei, Frankreich)
Die Niederlassung befand sich in der heutigen Gemeinde Saint-Phal. Ihre Existenz ist seit 1254 bezeugt. Perchois verfügte über eine Ziegelei, einen Weiher, Waldparzellen, eine eigene Kapelle und ein abhängiges Haus und weiteren Landbesitz in Bouilly. Heute sind nur noch die Grundmauern zu sehen.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Leroy, Thierry: Hugues de Payns, chevalier Champenois, Fondateur de l'Ordre des Templiers, Troyes 2001.
Périgord/Pierregort, Armand/Hermant de (M)
Die Familie und das Heimatland dieses Meisters sind nicht bekannt. 1229 urkundete er als Provinzmeister von Sizilien und Kalabrien. 1232 wurde Armand de Périgord zum Meister gewählt, möglicherweise, weil man einen Mann an der Spitze haben wollte, der das Wohlwollen Friedrichs II. genoss. Wohl noch im Jahr seiner Wahl kam er in die Kreuzfahrerstaaten, wo er mit seinen Templern, den Johannitern und den einheimischen Franken an Kämpfen in Syrien teilnahm.
1233 begleitete Armand de Périgord Bohemond V. von Antiochia in dessen Feldzug gegen den Konnetabel von Armenien Konstantin de Lampron, der die Templer angegriffen hatte. Die Auseinandersetzung wurde noch vor einer Schlacht auf vertraglichem Weg geregelt. In diesem Fall standen die Johanniter auf Seiten Konstantins, zwei Jahre später hatten sich Templer und Johanniter mit den Assassinen gegen Bohemond V. verbündet. Papst Gregor IX. sah sich zu einem Mahnschreiben an die Bischöfe der Kreuzfahrerstaaten veranlasst, sie mögen dringlich auf den Meister der Templer einwirken, um diese Allianz mit den „Feinden Gottes und des Christentums“ zu beenden. Sollten die Templer sich weigern, konnten die Prälaten Kirchenstrafen einsetzen (ed. Auvray, Sp. 464). Ein gleichlautendes Schreiben betraf die Johanniter.
Nach einem Vertrag mit Sultan as-Salih Ismail von Damaskus 1240, der zu einem gemeinsamen Kriegszug der Christen und ihrer muslimischen Bündnispartner gegen Ägypten führen sollte, erhielten die Templer die Burg Safed zurück. Unter großem finanziellem Aufwand wurde die Anlage wieder aufgebaut. Der geplante Kriegszug gegen Kairo fand indessen nicht statt.
In der Auseinandersetzung mit den Statthaltern des Römisch-Deutschen Kaiserreiches in Akkon um die Herrschaft im (Rest-)königreich Jerusalem unterstützten die Templer die Partei des einheimischen Adels und der Stadtkommunen zugunsten der Königin Alice. 1243 schloss Armand de Périgord in Übereinstimmung mit Vertretern der Kirche und den mächtigsten Baronen des Heiligen Landes einen weiteren Vertrag mit Ismail, dem Herrscher von Damaskus gegen dessen Neffen as-Salih Ayyub. Die Vereinbarung restituierte den Christen Jerusalem, Bethlehem und einige andere Städte. Erst 1244 kam es jedoch wohl zur Rückgabe des Tempelberges und damit des alten Hauptsitzes des Ordens. Matthäus Paris gibt in seiner Chronica Maiora einen Brief wieder, in dem „Hermannus Petragoricensis […] Militiae Templi minister humilis“ dem Provinzmeister von England über die Ereignisse berichtet. „Engel und Menschen freuen sich,“ so der Ordensmeister in seinem Brief laut der Chronica, „dass die Heilige Stadt Jerusalem nunmehr nur noch von Christen bewohnt werde, und alle Sarazenen vertrieben. Alle heiligen Stätten, in denen seit 56 Jahren der Name Gottes nicht angerufen worden war, sind durch die Prälaten gereinigt und neu geweiht worden; die Heiligen Geheimnisse werden dort wieder gefeiert. Jeder kann diese Orte wieder frei und sicher besuchen.“ (ed. Luard 4, S. 290).
Der in diesem Brief ausgedrückte Wunsch, dieser Zustand möge lange anhalten, erfüllte sich nicht. Bereits ein Jahr später wurde Jerusalem von den Choresmiern erobert, die Einwohner massakriert und die Stadt schwer zerstört. Muslimische Quellen, darunter Ibn al-Furat, berichten von einem Plan der „Franken“ und ihrer muslimischen Verbündeten aus Syrien, in Ägypten einzufallen. Die noch verbleibenden militärischen Kräfte sammelten sich mit ihren moslemischen Alliierten bei La Forbie. Während der für die Christen katastrophalen Schlacht fiel Armand de Périgord oder wurde gefangengenommen.
Anke Napp
Quellen
- L. Auvray (Hg.), Les Registres de Grégoire IX, Bd. II, Paris 1907, Nr. 3294, Sp. 464f.
- Matthew Paris, Chronica Maiora, ed. H. R. Luard, 7 Bde., Rolls Series 57, London 1872–1883, hier Bd. IV, S. 288-291: URL.
Sekundärliteratur
- I. Berkovich, Templars, Franks, Syrians and the Double Pact of 1244, in: P. Edbury (Hg.), The Military Orders 5: Politics and Power, Aldershot 2012, S. 83-94.
- M. L. Bulst-Thiele: Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, S. 189-210.
Perpignan (Komturei, Frankreich)
Architektonische und territoriale Entwicklung
Perpignan/Perpinyà, Hauptstadt des Roussillon, war Teil der Ordensprovinz Aragon/Katalonien und gehörte zunächst im Königreich Aragon, ab dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts bis Mitte des 14. Jahrhunderts im Königreich Mallorca. In den folgenden Jahrhunderten wechselte die Stadt häufig zwischen spanischer und französischer Herrschaft. Erst seit Mitte des 17. Jahrhunderts gehört sie zu Frankreich.
Bereits 1139 werden erstmalig Templer in Perpignan erwähnt. Erst 1204 ist jedoch ein Komtur urkundlich belegt. Die Komturei blieb in einem engen administrativen Verbund mit Mas-Dieu/Masdéu. Sie befand sich zunächst außerhalb der Stadtmauern, nach neueren Forschungen zwischen den heutigen Straßen Mailly, Angel und Campana d'Or und nahm etwa eine Fläche von 7500 m² ein. Zur Niederlassung gehörte eine der Heiligen Maria geweihte Kirche.
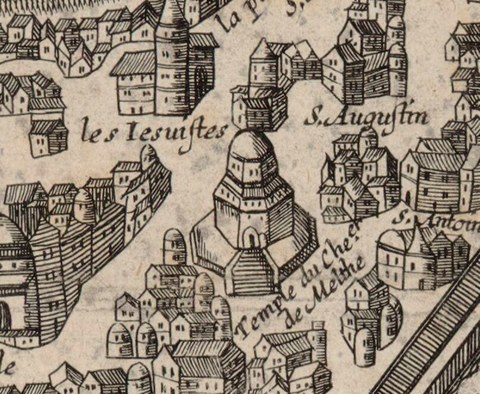
Beteille/Classun: Plan de la ville et citadelle de Perpignan avec l'estat de l'armée du Roy et les lignes de circonvalation faites par Sa Majesté. Detail: Kirche/Komturei der Malteserritter. Gesamter Stadtplan © gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Ab etwa 1230 erschlossen die Templer außerdem ein Areal vor den Stadtmauern für die Urbanisierung, das heutige Viertel Saint-Mathieu. Die dortigen Häuser und Werkstätten wurden vermietet und sorgten für stetige Einnahmen.
Kurioserweise gibt der 1642 gezeichnete Stadtplan Perpignans den „Temple des Chevaliers de Melthe (=Malthe)“ als Zentralbau wieder, dessen Aussehen an zeitgenössische Darstellungen des Jerusalemer Felsendoms erinnert. Es handelt sich um eine Fiktion, die von den übrigen Dokumenten nicht bestätigt wird. Aus Beschreibungen bei Visitationen der Johanniter aus dem 16. bis 18. Jahrhundert kann die imposante Anlage, die einer kleinen Festung glich, rekonstruiert werden. Allerdings hatten seit der Templerzeit mit Sicherheit einige bauliche Veränderungen stattgefunden.
Die Komturei war eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt verbunden. Die Grafen von Roussillon unterstützten den Orden: mehrfach sind Schenkungen dokumentiert, aber auch Verkäufe. Darunter 1146 auch die ersten zwei Mühlen und Landbesitz im Umland der Stadt. In den Mühlen wurde nicht nur das auf dem eigenen Land produzierte Getreide gemahlen – entsprechende Privilegien verpflichteten die Einwohner, ihr Getreide an den jeweiligen Mühlen gegen Gebühr mahlen zu lassen.
1172 erhielt die Niederlassung von Perpignan mit dem Testament von Graf Girard II. das Backhausprivileg und das Recht auf Verwendung des Getreidemaßes, das benutzt werden musste, ehe Getreide auf den Markt kommen durfte.
Die Mühlen und das für ihren Betrieb notwendige begrenzte Wasser stellten immer wieder Konfliktgründe dar: zwischen den Templern und Bürgern der Stadt, sowie der Stadt und außerstädtischen Herrschaftsträgern. Bereits 1149 wurde ein Vergleich geschlossen, der Stadt und Templer zu einem Beitrag zum Unterhalt des Wasserkanals und der Schleuse verpflichtet. Der Kauf von fünf Mühlen durch die Johanniter 1167 in einem Mühlenbezirk, in dem die Templer schon drei hatten, führte ebenfalls zu langwierigen Auseinandersetzungen. Noch im Jahr 1300 muss geregelt werden, wer sich mit wie viel am Bau einer Brücke zu den Mühlen beteiligt. Nach einem königlichen Privileg 1262, das die Templer zur Nutzung von Wasser aus einem Kanal ermächtigte, gab es Streit mit dessen Besitzer und seinen Erben, die dort ebenfalls Mühlen betrieben.
Auch das Backhausprivileg führte zu Konflikten, zum Beispiel mit der Zisterzienserabtei von Fontfroide, die laut gräflicher Urkunde von 1166 von den Backhäusern in Perpignan eine Naturalienabgabe in Form von Brot erhalten sollte. Die Templer argumentierten Anfang des 13. Jahrhunderts, dass die unterdessen sehr große Zahl von Mönchen in der Abtei und die resultierende umfangreiche Abgabe ihre Privilegien erodiere. Der Streit ging vor den Bischof von Elne und den König und endete 1205 mit einem Verzicht der Zisterzienser auf das Brot. Stattdessen sollten die Templer ihnen eine jährliche Summe Geldes zahlen.
1287 wurde die Größe der verwendeten Maße in Perpignan in einer Übereinkunft von Vertretern der Universität, Templern und Konsuln der Stadt 1287 verbindlich geregelt. Auch an der baulichen Einrichtung des 1293 durch König Jayme II. begründeten Getreidemarktes war die Komturei finanziell beteiligt – als Dank erhielten die Templer auch dort das Maßrecht. Betrugsversuche konnten die Templer dem Bürgermeister oder Vertretern des Königs mitteilen.
1241 gaben die Templer den Franziskanern Land zur Einrichtung ihres Konvents. Zur Zeit des Königsreichs von Mallorca war in der Komturei von Perpignan der Kronschatz und das königliche Archiv untergebracht. Der Komtur fungierte als königlicher Prokurator, eine Art Finanzminister. Nach der Aufhebung des Templerordens gelangte die Komturei an die Johanniter.
Architektonische Überreste
Kriege, Belagerungen und der Ausbau Perpignans zur Festung haben alle Überreste der Komturei selbst vernichtet. Vorhanden ist noch die Kirche Saint-Marie-des-Anges im „Templerviertel“ Saint-Mathieu, ein einschiffiger Bau mit planem Chorschluss.
Komture (nach Tretón, Bd. 5):
~1209-1213 Balaguer
~1214- 222 Pere Guillem
~1229 Cabot
~1230 Pere
~1232 Guillem de Gavaudan
~1233-1234 Cabot
~1235-1238 Guillem Garsó
~1239-1240 Guillem de Sant Esteve
~ 1241 Joan de Sacirera
~1243-1244 Pere de Sant Romà
~1244-1245Guillem de Castellnou
~1245-Januar 1246 Bernat de Montsó
Juli-Nov. 1246 Pere d'Aspà
~1247-Sept. 1248 Bernat de Montsó
Okt. 1248-Febr. 1249 Cabot
Mai 1249 Guillem de Castellnou
Dez. 1249 Joan de Sacirera
~1252 Guillem de Sant Esteve
~1255 Bernat de Montsó
~1255 Pere de Cànoes
Nov. 1255-März 1257 Ramon de Vilanova
August 1257 Pere Sabater
Januar 1258 Pere de Palafrugell
~1258-1259 Pere Sabater
1260-1262 Jaume de Vallcarca
1262-Mai 1273 Pere Sabater
Mai 1273 Joan Grony
Juni 1273 Pere Sabater
Sept. 1273-1275 Joan Grony
1275-März 1288 Pere de Camprodon
Dez. 1289-1307 Jaume d'Ollers (gleichzeitig Komtur von Masdéu)
Quelle
- R. Tretón: Diplomatari del Masdéu, 5 Bde., Barcelona 2010.
Sekundärliteratur
- J. Fuguet Sans: El patrimonio monumental y artístico de los Templarios en la corona de Aragón, in: Arte y patrimonio de las órdenes militares de Jerusalén en Espana: hacia un estado de la cuestión, Saragossa/Madrid 2010, S. 22f.
- J. Fuguet Sans: L’Arquitectura dels Templers a Catalunya, Barcelona 1995, S. 346-355.
- R. Tretón: Diplomatari del Masdéu, 5 Bde., Barcelona 2010, Bd. 1, S. 101–142.
- P. Vidal: Histoire de la ville de Perpignan depuis les origines jusqu'au traité des Pyrénées, Paris 1897, S. 33: URL.
- R. Vinas: Coup d’oeil sur l’histoire de l’Ordre du Temple dans les pays catalans au nord des pyrénées, in: R. Vinas / L. Verdon (Hg.), Les Templiers en pays catalan, Canet 1998, S. 17–37, hier S. 23f.
Pfarreien
Der Templerorden bekam Pfarreien mit Pfarrkirchen durch Schenkungen übereignet, gründete aber auch selbst welche. Die dort generierten Einkünfte (Zahlungen bei Eheschließungen, Taufen und Begräbnissen, Spenden) gingen der Ortskirche verloren. Die Ernennung der zuständigen Pfarrer - die nicht dem Orden angehören mussten - führte des öfteren zu Streitigkeiten mit den Ortsbischöfen, da diese ein Mitspracherecht verlangten, der Orden jedoch auf seine Exemtion pochte. Auch Kirchen wurden zum Teil ohne Zustimmung des Ortsbischofs geweiht, da die Templer hierfür auch an auswärtige Bischöfe herantreten durften - wiederum ein Streitpunkt. Oft wurden detaillierte Regelungen von Fall zu Fall geschlossen, die auch Treueeide eines Templerkomturs an einen Abt oder Bischof beinhalten konnten. Dies widersprach jedoch ebenfalls der Ordensregel und den päpstlichen Verfügungen seit Omne Datum Optimum 1139. Andere Übereinkünfte regelten, zu welchen Festtagen auch die Gemeinde der Templerpfarrkirche an Prozessionen (bei denen Spenden anfielen) der anderen Kirchen der Diözese teilzunehmen hatten. Im Hinblick auf die späteren Anklagepunkte und den Prozess sei angemerkt, dass in den Streitigkeiten der Templer mit der Ortsgeistlichkeit Häresie keine Rolle spielte.
s. auch Patenschaften, Friedhöfe und Kritik
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Allard, Jean-Marie: Le contrôle des paroisses, un enjeu entre les ordres militaires et l'épiscopat: Le cas aquitain, in: Bucheit, Nicholas (Hg.): Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècle), Cahiers des Fanjeaux 41, Toulouse 2006, S. 21-52.
- Carraz, Damien: Eglises et cimitières des ordres militaires: Contrôle des lieux sacrés et dominium ecclésiastique en Provence (XII-XIIIe siècle), in: Théry, Julien (Hg.): Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux 46, Toulouse 2011, S. 277-312.
- Salvadó, Sebastián: Templar liturgy and devotion in the Crown of Aragon, in: Nicholson, Helen J.: On the margins of Crusading: The Military Orders, the Papacy and the Christian World, Farnham 2011, S. 31-44.
- Schenk, Jochen: Aspects and problems of the Templars' religious presence in medieval Europe from the 12th to the early 14th century, in: Traditio 71 (2016), S. 273-302.
Pferde
Pferde hatten sowohl als Schlachtrösser der Ritter, als auch Pack- und Arbeitstiere große Bedeutung im Orden. Die Regel legt genau fest, auf wie viele Pferde ein Ordensbruder bestimmten Ranges ein Anrecht hatte: so durfte der Meister über vier Reitpferde und zwei bis vier Packtiere verfügen, die Mitglieder seines Stabes insgesamt über nochmals fünf Pferde. Ein Ritterbruder hatte Anrecht auf drei Pferde, ein bewaffneter Servient auf ein Pferd.
Die Regel enthält auch zahlreiche Anordnungen für den Umgang mit den wertvollen Pferden. Nach ihnen zu sehen, war eine der ersten Aufgaben des Tages. Nachlässigkeiten und Verfehlungen, die eine Verletzung oder gar den Tod eines Pferdes zur Folge hatten, wurden streng geahndet und konnten den Verlust des Ordensgewandes nach sich ziehen. Das angebliche Geheimalphabet, das einige Templer-Esoteriker in der Handschrift der Ordensregel aus der Bibliothèque Nationale gefunden haben wollten, konnte durch die Historikerin Simonetta Cerrini als Heil-Zauber für Pferde entziffert werden.
Pferde und Maultiere wurden ebenso wie Getreide aus Europa (insbesondere Spanien) in den Orient importiert (zu einem Hauptumschlagsplatz wurden Sizilien und Apulien unter den Anjou) und befanden sich zunächst in der Obhut des Marschalls, bis der Meister weitere Verfügungen traf.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Hill, Paul: The Knights Templar at War. 1120-1314, Barnsley 2017.
Philipp du Plessis
Siehe Plessis, Philipp du
Piacenza (Komturei, Italien)
Bauliche und territoriale Entwicklung
Santa Maria de Tempio, gelegen an der Pilgerstraße nach Rom Via Francigena, sowie der alten Handelsstraße Via Emilia und dem Wasserweg des Po, war die bedeutendste Komturei im norditalienischen Raum. Informationen über die hier gehaltene Provinzialkapitel des Ordens sind aus den Jahren 1244, 1268 und 1271 erhalten.
Die Niederlassung befand sich nicht – wie von Lokalhistorikern früher vermutet – im Hospital Sant’Egidio, sondern bei der heutigen Kirche San Giovanni in Canale, an der Via Croce. Die früheste urkundliche Erwähnung datiert das Jahr 1172 und hat eine Regelung über Reparaturarbeiten an der nahegelegenen Brücke zum Inhalt. 1179 wird die Kirche erstmalig erwähnt. Spätestens Anfang des 13. Jahrhunderts hatte sie den Rang einer Komturei. 1279 erhielt die Kirche einen imposanten Glockenturm. Ein innerstädtisches Hospital taucht 1195 auf und scheint zumindest einige Zeit zum Orden gehört zu haben. Für einen oft angenommen Besitz der Elenakirche gibt es keine Nachweise.
In Dokumenten des 13. Jahrhunderts wird ein „comitatus“ beschrieben, welches Land und Güter mit entsprechenden Freiheiten beschreibt und dem Orden unterstand. Ebenfalls zur Komturei von Piacenza gehörten, spätestens ab 1210, Haus und Margheritenkirche in Fiorenzuola, sowie ein Landgut in Cotrebbia, das im Inquisitionsinventar von 1308 auftaucht. Erst im Jahr 1280 übergab der Bischof von Turin der Komturei die Kirche Sant‘ Egidio mit ihrem zugehörigen Hospital, gelegen vor dem Santa Brigida-Stadttor. Die bereits im 12. Jahrhundert dokumentierte Existenz des Hospitals unter einem Rektor „Ugo“ führte einige Forscher zur Frühdatierung der gesamten Templerniederlassung – anhand der Gleichsetzung von „Ugo“ mit Hugues de Payens (Campi I, S. 396). Dort waren möglicherweise Donaten oder eine Hospitalbruderschaft tätig, nicht unbedingt Templer. Die Wahl von Raimondo Fontana als „Rector“ von S. Egidio wurde vom Bischof bestätigt.
1304 schenkten die Templer den Komplex von Santa Maria de Tempio mit Garten, Mühle, Wasserlauf und zugehörigen Rechten an die benachbarten Dominikaner von San Giovanni. Von da an übernahm die Niederlassung von Sant‘ Egidio mit ihrem Hospital die Funktionen der Templerkomturei und des regionalen Zentrums. 1305 fand dort ein Provinzkapitel statt.
Beziehungen und Konflikte
Die Niederlassungen waren in das städtische Leben gut integriert. Schon Ende des 12. Jahrhunderts gibt es ein „consorcium Templi“, dem wohl Donaten und Wohltäter angehörten. Schenkungen durch die Stadtbevölkerung und Ordenseintritte von Bürgern sind belegt. Die Familien der Fontana und Pigazzano stellten mehrfach Ordensmitglieder, auch in hohen Funktionen: Raimondo Fontana amtiert Anfang des 14. Jahrhunderts als Komtur von Piacenza, Giacomo Fontana als Komtur von Cabriolo. Bianco da Pigazzano ist 1267 und 1271 als Provinzmeister der Lombardei vermerkt. Während des Prozesses tauchen vier Mitglieder der Pigazzano-Familie als Templer in den Protokollen auf.
Einige Male finden wichtige stadtpolitische Ereignisse im Ordenshaus bzw. seiner Kirche statt: so zum Beispiel 1187 eine Sitzung zur Wahl des Gremiums, das später den Podestà bestimmen sollte. Die personelle Verzahnung mit den wichtigen Familien der Stadt hatte allerdings auch eine Einbindung in die Wechselfälle innerstädtischer Politik zur Folge. Über Wasserrechte gab es 1253 mit den benachbarten Dominikanern Streit. Ende des 13. Jahrhunderts scheint es erneut Konflikte gegeben zu haben, die die Templer involvierten – Genaueres ist nicht bekannt. Doch ermahnte der Papst den Bischof von Piacenza, Rechte und Eigentum der Templer zu schützen.
Im Zuge des Prozesses wurde das Ordenseigentum im August 1308 auch in Piacenza konfisziert. Einige Brüder wurden in Sant’Egidio inhaftiert, darunter Raimondo Fontana und Giacomo Fontana. 1311 wurden sieben Templer aus Piacenza dem Erzbischof von Ravenna, Rainaldo da Concorezzo vorgeführt. Sie galten jedoch als unschuldig und leisteten bei ihrer Rückkehr in Piacenza den Reinigungseid mit Bürgen. Raimondo Fontana ereilte dennoch ein gewaltsames Ende – er wurde im Auftrag einer mit den Fontanas verfeindeten Familie 1314 ermordet.
Nachleben
Der Glockenturm von S. Maria stürzte im 16. Jahrhundert ein. Eine Zeichnung Antonio da Sangallos – heute in den Uffizien in Florenz – ist das einzige Zeugnis seines Aussehens in dieser Periode. Die Kirche wich im 18. Jahrhundert einem Neubau, der im 19. Jahrhundert teilweise abgerissen und überbaut wurde. Letzte Spuren aus mittelalterlicher Zeit gingen bei der Bombardierung im II. Weltkrieg verloren. Fotos von Giulio Milani vom Ende des 19. Jahrhunderts dokumentieren als letzte den Zustand.
Das Haus und Hospital von Sant‘ Egidio wurde an die Johanniter übergeben. Es wurde im 15. Jahrhundert umgebaut und im späten 16. Jahrhundert dem Neubau der noch heute dort befindlichen Kirche San Giuseppe geopfert. Heute sind dort die „Templari di San Bernardo“, eine katholischen Laienorganisation aktiv. Auch der Neutemplerorden „Templari Cattolici“ nutzte die Kulisse von Piacenza bereits für eine Zusammenkunft. Obwohl es keine sichtbaren architektonischen Reste mehr gibt, werben touristische Webseiten mit den Spuren des „esoterico ordine monastico cavalleresco custode del Santo Graal“.
Komture (nach Bramato/Bellomo)
~1172 - Ottone “minister” von Piacenza
~1172/1176 - Rainerio “minister” von Piacenza
~1214 - Ottone Barba Scovata
~1244 - Nicola da Celari/Celori (aus Piacenza)
~1271 - Bianco da Pigazzano (auch Komtur von Mailand / Provinzmeister Lombardei
~1271 - Guglielmo de Bicocha
~1286 - Alberico
~1304 - Tommasino
~1307 - Raimondo Fontana
Sekundärliteratur
- E. Bellomo, The Templar Order in North‐West Italy, 2007, S. 24, 127, 162–276.
- F. Bramato, Storia dell‘Ordine Templari in Italia. Le fondazioni, Rom 1991, S. 60, 90ff.
- P. M. Campi, Historia ecclesiastica di Piacenza, Piacenza 1615, 3 Bd., hier Bd. I, S. 396 (Niederlassung in Piacenza): URL; Bd. II, S. 178 (Provinzialkapitel 1244): URL; Bd. III, S. 6f (Glockenturmbau 1279 und Übergabe von Sant‘Egidio), S. 41 (Prozess in Ravenna).
- G. Cattivelli (Hg.): Giulio Milani, fotografo in Piacenza, Piacenza 1984.
- E. Nasalli Rocca, Della introduzione dei Templari a Piacenza, in: Bollettino Storico Piacentino, XXVI (1941), S. 97–102 und XXVII (1942), S. 16–20.
- P. Schenoni Visconti, I beni della commenda giovannita di Sant'Egidio di Piacenza in età moderna, 2013.
- Zu den Templari Cattolici: 5. März 1922, Artikel und Fotostrecke in der Zeitschrift Libertà: “Un centinaio di templari tra le vie del centro di Piacenza. ‘Portiamo messaggi di pace’: URL.
- N. de Stefano, Blog Piacenza Antica: URL.
Pierre de Montaigu
Siehe Montaigu, Pierre de
Pierrevillers (Komturei, Frankreich)
Pierrevillers (auch Pierevillers) liegt in der Nähe von Metz im Département Moselle in Frankreich. Der Ort wurde im Jahre 960 erstmalig als Petraevillare erwähnt und gehörte in der Templerzeit lange zum Römischen Reich.
Bauliche und territoriale Entwicklung
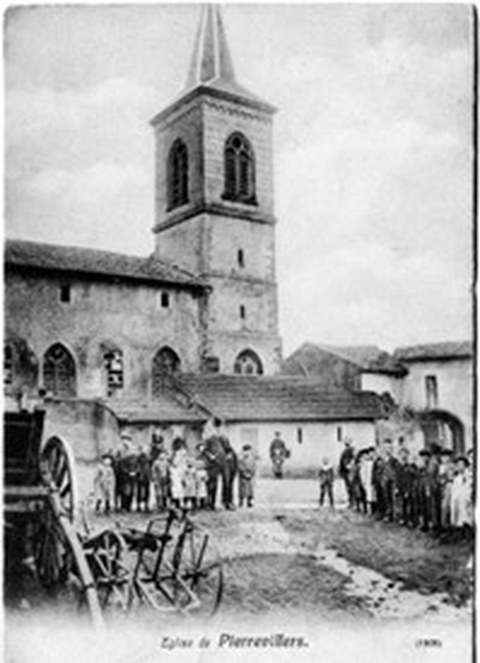
Kirche und Gebäude der Komturei (rechts) 1905. Postkarte
Hauptquelle der Informationen über die Niederlassung von Pierrevillers ist das Inventaire mit dem Verzeichnis aller zum Zeitpunkt seiner Niederschrift 1736 im Archiv der Johanniterkomturei in Metz befindlichen Urkunden. Originalurkunden sind ebenfalls noch vorhanden.
Das Templerhaus wurde wahrscheinlich von Thibaut, Graf von Bar und Luxemburg, gestiftet, der im November 1213 fast seine gesamten Güter, Herrschaftsrechte und Leibeigenen in Pierrevillers dem Orden vermachte. Ausgenommen waren die Güter, die der Zuständigkeit von Maranges unterstanden, sowie Herrschaftsrechte und Gerichtsbarkeit in den Waldstücken.
Möglicherweise ist die Anwesenheit der Templer in Pierrevillers sogar noch früher zu datieren. Laut einer angeblich während der Predigt des Heiligen Bernard de Clairvaux für den II. Kreuzzuges entstandenen Urkunde („Abbate Bernardo Clare Vallis predicante exercitum Xpristi“) übertrugen die Brüder Gerard und Guarin de Bousonville für die Dauer ihrer Abwesenheit auf dem Kreuzzug ihre Güter in Rispe und Bousonville an „den Herrn [Christus] und die Ritter vom Tempel (=Domino militibusque Templi domus Hierusalem“, ed. D’Albon, S. 249). Falls sie beide nicht zurückkehrten, sollten die Liegenschaften als Schenkung dem Orden zufallen. Die Urkunde führt nicht nur den Landbesitz, sondern auch detailliert die Leistungen, die Abgaben der darauf Wohnenden, sowie die Fälligkeitstermine an. Die Authentizität der nur in einer Abschrift des 13./14. Jahrhunderts erhaltenen Urkunde ist allerdings umstritten, da sie nicht dem üblichen Aufbau eines solchen Schriftdokuments folgt. Die Reise Bernard de Clairvaux‘ durch Lothringen und die Tätigkeit als Kreuzprediger sind durch seinen Biographen in der ersten Vita des Heiligen belegt.
Im Inventaire sind für den Zeitraum 1243 bis 1303 diverse Schenkungen zugunsten von Pierrevillers vermerkt, darunter Übereignungen seitens des lokalen Adels, aber auch eine Zuwendung der Äbtissin von Saint-Pierre-aux-Nonnains in Metz. Andere Immobilien und Rechte werden von den Templern durch Kauf erworben, wie 1251 Einkünfte in Pierrevillers, die zuvor Saint-Pierre-aux-Nonnains gehört hatten. Der erste Komtur von Pierrevillers findet 1253 Erwähnung.
Beziehungen und Konflikte
Zwei Einträge im Inventaire zeugen von Unstimmigkeiten, zwischen den Leuten aus Marange (unterstanden dem Grafen) und den Templer-Untertanen aus Pierrevillers über die Nutzung des Waldstückes entstanden waren. 1243 wird der Wald infolge des Schiedsspruchs zwischen Graf und Komturei geteilt, Grenzsteine werden gesetzt. Keine Partei soll von dem Gebiet der anderen von nun an mehr etwas zu beanspruchen haben.
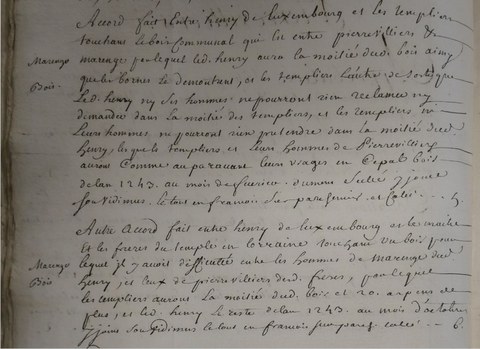
Inventaire, S. 82 mit den beiden französischen Urkundenregesten zum Streitfall des Waldstückes.
Einblick in Geldgeschäfte und Wege der Besitzakquise bietet ein Fall aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: 1253 verpfändete ein Mann, der den Templern 23 Pfund schuldete, seinen Besitz in Pierrevillers an die Komturei. Bis zur Begleichung der Schuld sollten alle Einkünfte aus diesem Besitz an den Orden gehen. Die zugehörigen herrschaftlichen Rechte übereignete der Schuldner ebenso. Da er 1262 die endgültige Übertragung des gesamten Erbes an die Templer als deren Eigentum finalisierte, scheint ihm eine Zahlung seiner Schulden nicht möglich gewesen zu sein.
Nach der Aufhebung des Ordens wurde die Komturei von Pierrevillers den Johannitern übereignet. 1314 ließ der deren Komtur ein Güterverzeichnis aufstellen.
Architektonische Überreste
Die Bausubstanz der Komturei wurde während des Hundertjährigen Krieges fast komplett zerstört, überbaute Reste der Hofanlage, die noch heute die Bezeichnung „La Commanderie“ trägt, sind jedoch noch vorhanden. Bei Sondierungsgrabungen im Jahr 2013 wurden keine Objekte oder baulichen Artefakte gefunden, die mit der Templerzeit in Verbindung gebracht werden können. In der mehrfach (im 15., 16. und 18. Jahrhundert) umgebauten Kirche unter dem Patrozinium des Hl. Martin sind noch Teile aus dem 12. Jahrhundert erhalten. Im Chor findet sich eine interessante französische Inschrift, die das Ende des Templerordens kommemoriert: Fin des Templiers l’an mil trois cent quatorze.
Komture von Pierrevillers (nach Hammerstein/Schüpferling):
~ 1253 Unbekannter Komtur
~ 1275, 1283, 1295, 1296 Renaud (dieselbe Person?)
Anke Napp
Quellen:
- Inventaire de titres de la Commanderie magistrale du petit St-Jean de Metz, qui se trouvent dèposès dans les archives du Grand-Prieurè de Champagne au Chàteau de Voulaine en l`annèe 1736, Archives départementales de la Moselle, H 4601, S. 81–83 (Urkundenregeste 1213, 1243, 1253).
- G. A. M. J. A. d’Albon (Hg.), Cartulaire général de l'Ordre du Temple, 1119?–1150, Paris 1913, S. 259, Nr. 396: URL. (Urkunde von 1146/7)
- H. von Hammerstein, Der Besitz der Tempelherren in Lothringen, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde, VII. Jahrgang Band I. Teil 1895, S. 1-29, hier S. 22-24, Regesten Nr. 56–71: URL.
Sekundärliteratur:
- J.-C. Jacoby, Pierrevillers : l’héritage du mystérieux Ordre des Templiers, auf Le Républicain Lorrain, 25. Januar 2017: URL.
- J. B. Kirch-Escheringen: St. Bernhard in Lothringen, Teil II, in: Historisches Jahrbuch 29 (1908), S. 264–303.
- M. Schüpferling, Der Tempelherren- Orden in Deutschland, Bamberg 1915, S. 17-19: URL.
- L. Bourada, Pierrevillers (Moselle). La Cour des Templiers, in: Archéologie médiévale 44 (2014), S. 204: URL
Pigazzano, Bianco da (Provinzmeister)
Bianco da Pigazzano stammte vermutlich aus dem Gebiet von Piacenza. 1244 amtierte er als Komtur von Asti und nahm an einem in Piacenza abgehaltenen Provinzialkapitel der Provinz Italien-Zentrum/Nord teil. 1267 taucht er in Urkunden als Komtur von Piacenza und Provinzmeister der Unterprovinz Lombardei/Norditalien auf (preceptor mansionis Placentie et rector et minister pro Templo in Lombardia). 1268 wurde er auf einem Provinzialkapitel zum Syndikus und Prokurator des Ordens ernannt. In dieser Eigenschaft entsandte er den Komtur von Modena, Guglielmo di Allessandria, als Unterhändler im Streit mit der Stadt Modena um das Hospital Sant'Ambrogio. Die bei den Verhandlungen erreichte Übereinkunft des Ordens mit der Kommuni wurde 1271 durch das Provinzialkapitel ratifiziert. Im gleichen Jahr amtiert Bianco da Pigazzano als Komtur von Piacenza und Mailand und Stellvertreter des Provinzmeisters der Lombardei. 1276 und 1278 erscheint er in den Quellen als Provinzmeister von (Nord)Italien (domorum milicie Temply in Ytalia generalis preceptor), ein Amt, das er bis in die 80er Jahre innehatte. Er starb vermutlich 1284/5.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Bellomo, Elena: The Templar Order in North-West Italy, 2007, S. 98-100.
Plessis, Philipp du (M)
Er wurde 1201 zum Meister gewählt. Im Juni 1202 schrieb er einen noch erhaltenen Brief an den Abt von Cîteaux, damals Arnaud Amaury, später päpstlicher Legat während der Albigenserkreuzzüge und Erzbischof von Narbonne. Hierin beklagt er die verzweifelte Situation der christlichen Staaten im Orient, die Verwüstung weiter Gebiete durch Krieg und das Problem der Flüchtlinge. Zudem habe man mit einer Trockenperiode und daraus folgenden Ernteeinbußen zu kämpfen, und ein Erdbeben habe Tyrus, Tripolis und Akkon heimgesucht und schwere Zerstörungen hervorgerufen - wenigstens aber sei die Niederlassung des Ordens unbeschädigt geblieben. Philipp du Plessis bittet den Abt von Cîteaux innigst um seine Gebete und betont, daß der Orden der Templer seine Wurzeln in den Cisterciensern habe und daß eine besondere Zuneigung beide verbinde.
Wie sein Amtsvorgänger war er im Konflikt mit dem armenischen König Leon II. wegen der Nachfolge im Fürstentum Antiochia und der Burg Gaston. Der angebliche "Krieg zwischen Johannitern und Templern" zu dieser Zeit fand niemals statt. Philipp de Plessis starb 1209, vermutlich während des Feldzuges gegen Al-Adil.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Bulst-Thiele, M-L.:Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani Magistri, Göttingen 1974, der Brief an den Abt von Cîteaux findet sich hier im Anhang unter Nr. 2.
Polen
Auf dem Gebiet des heutigen Polen befanden sich im Mittelalter mehrere unabhängige und einander zum Teil feindlich gesinnte Herrschaftsgebilde: Pommern, Schlesien (unter deutscher Oberhoheit), das Land Lebus, Großpolen, Masowien und das Fürstentum Sandomir. Die Templerprovinz gehörte zur deutschen Provinz und einige der in den mittelalterlichen Schenkungen genannten Besitzungen befinden sich heute in Deutschland. (Karte der Komtureien im Gebiet Deutschland-Polen-Tschechien) Ende des 13. Jahrhunderts war die Unterprovinz Polen dabei, eine eigene Provinz zu formen - die Auflösung des Ordens beendete diese Entwicklung. Das Haupthaus befand sich ab etwa 1288 in Lietzen, ab 1291 in Quartschen.
Schenkungen und Privilegien
Die älteste Niederlassung entstand in Klein-Öls (=Olesnica Mala). 1229 wurde (=Brandenburg=Deutschland) im Lebuser Land gegründet, mit Unterstützung von Herzog Heinrich I. Brodaty von Schlesien und dem Bischof von Lebus. Für beide Niederlassungen kamen die Ordensbrüder vermutlich aus Tempelhof bei Berlin. Der Fürst von Großpolen, Ladislaus Odoniz, war ebenfalls einer der ersten Wohltäter des Ordens. 1232 übereignete er den Templern einige Dörfer und Güter rings um Quartschen und Krotoszyn. Zur Schenkung des Herzogs gehörte auch ein Hospital in Gniezno - von dem der Orden sich allerdings bald wieder trennte, denn 1243 wurde die Immobilie den Rittern vom Heiligen Grab übergeben. (ed. Lüpke/Irgang, S. 12).
Im 13. Jahrhundert erlangten die Templer Schenkungen und Privilegierungen durch die Herzöge von Großpolen, Schlesien und Pommern sowie die Markgrafen von Brandenburg und die Bischöfe von Poznán, Cammin und Lebus. Insbesondere die Bischöfe von Lebus unterstützten den Orden: Lorenz II. überließ den Templern 1229 den Zehnten von 250 Hufen, und 1232 von 1000 Hufen Land. Lorenz‘ II. Amtsnachfolger Heinrich I. fügte weitere Zehntüberlassungen, unter anderem in der Nähe von Quartschen und Königsberg hinzu. Im Gegenzug unterhielten die Templer einen Kanoniker an der Domkirche in Lebus.
1234 verlieh Herzog Barnim I. von Pommern dem Orden das Land Bahn (=Polen). Dort wurde die Komturei Rörchen eingerichtet. Der Orden bekam ganze Dörfer geschenkt, wie etwa Darrmietzel. Er gründete aber auch neue Ansiedlungen, die mit deutschen Kolonisten besiedelt wurden - sahen es bereits die Schenkungsurkunden vor. Zum Beispiel gestattete Herzog Odoniz von Großpolen 1232 den Templern, das Dorf Koschmin nicht nur mit Deutschen zu besiedeln, sondern diese auch in Zukunft nach deutschem Recht leben zu lassen (ed. Lüpke/Irgang S. 13f). 1286 wurde die Komturei Tempelburg (=Polen) nahe der Salzstraße gegründet. Auch dort entstand eine kleine Stadt, besiedelt mit deutschen Kolonisten. 1303 schließt Bischof Andreas von Poznán mit der Komturei Grossendorf einen Vertrag, der ebenfalls nach deutschem Recht besiedelte Dörfer in seiner Diözese betrifft und für die er sechzehn Jahre Zehntfreiheit gewährt (ed. Lüpke/Irgang, S. 75).
Die Niederlassungen waren - wie zumeist auch im übrigen Europa - klein. Oft waren nicht mehr als drei bis vier Brüder anwesend. Für das gesamte polnische Gebiet lässt sich nur mit etwa 40 bis 50 Ordensbrüdern rechnen. Die meisten Templer (soweit dies anhand der wenigen erhaltenen Namen zu rekonstruieren ist) stammten aus Familien des nordöstlichen Deutschlands oder aus deutschen Familien, die nach Schlesien ausgewandert waren. Nur selten taucht auch ein polnischer Name auf.
Beziehungen und Konflikte
Die Rezeption der Kreuzzugsidee in Polen war nicht sehr ausgeprägt; wo sie stattfand, hing dies offenbar mit familiären Beziehungen in die weiter westlich gelegenen (deutschen) Gebiete zusammen. Die Niederlassung in Klein-Öls wurde der Überlieferung nach auf Veranlassung der Heiligen Hedwig gegründet - sie stammte aus der Familie Andechs-Meranien. In der Legende der Heiligen, entstanden vor 1300, wird auch berichtet, wie ihr ein Templer einen Bußgürtel schenkt. Auf die daraufhin geäußerte Verärgerung ihrer Schwiegertochter habe Hedwig den Ordensbruder und ihre eigene strenge Buße verteidigt.
Die Rivalitäten der lokalen Mächte auf dem Gebiet des heutigen Polen begünstigten die Ansiedlung der Templer im Sinne einer Landkultivierung, aber auch als „geistliche Pufferzone“ gegen den jeweiligen politischen Gegner. Nicht immer erfolgreich: Im Jahre 1291 griff der Fürst von Pommern die Templer an und plünderte deren Güter, eine Tat, für die ihn die Exkommunikation traf.
Auch die Schenkungen mit ihren zugehörigen Rechten blieben nicht unbestritten. Die Besitzungen und Rechte im Land Lebus, das sich zu beiden Seiten der Oder erstreckte, führten zu Unstimmigkeiten mit dem Erzbischof von Magdeburg, die 1253 durch einen Schiedspruch des Bischofs von Meißen geklärt werden mussten (ed. Lüpke/Irgang, S. 40). Auf etwaige Konkurrenten sollte Rücksicht genommen und so Streit im Vornherein vermieden werden: 1257 bestätigte eine päpstliche Bulle die Übereignung der Burg Luckow „an der Grenze zu den Litauern und anderen Ungläubigen“ durch Herzog Boleslaw V. von Krakau an den Orden. Dort sollte ein neuer Bischofssitz eingerichtet und mit einem Franziskanerbruder besetzt werden - doch nur, falls dem Deutschen Orden keine Nachteile entstünden (ed. Lüpke/Irgang, S. 42).
Im Austausch gegen ihre Schenkungen erwarteten die polnischen Magnaten konkrete Hilfe der Templer, sowohl gegen die heidnischen Pruzzen, als auch gegen die Markgrafen von Brandenburg. Doch sind keine Parteinahmen der Templer in den lokalen politischen Auseinandersetzungen überliefert. Die Ordensbrüder lavierten eher zwischen den Parteien.
Auch wollten sie sich nicht an einer weiteren Front im Heidenkampf (zusätzlich zum Orient und Spanien) engagieren. Zwar nahmen die Templer 1241 an der großen Schlacht gegen die Mongolen bei Liegnitz teil, wohl aber nur mit wenigen Vertretern. Ein Brief des französischen Provinzmeisters Pons d'Albon berichtet, in den Auseinandersetzungen seien 6 Brüder gefallen, darunter 3 Ritter und zwei Servienten. Die Entscheidung, keine weiteren Kräfte im Nordosten Europas zu binden, führte letztlich sogar zu einer Aufgabe von Besitzungen im Fürstentum Sandomir und in Masowien.
Bischof Hermann von Cammin lobte im Jahre 1261 den Orden wegen seiner Verdienste für die Verteidigung der Kirche im Orient, für die viele Brüder ihr Leben gelassen hatten, sehr enthusiastisch (ed. Lüpke/Irgang, S. 46f). 1285 gewährte er dem Orden weitgehende Abgabenfreiheit in seiner Diözese.
Das Ende des Ordens verlief in Polen unblutig. Noch im September 1308 urkunden Templer bei Verkäufen. Ehemalige Templer befanden sich nach Ende des Ordens teilweise noch weiterhin in geistlichen oder weltlichen Diensten oder traten in andere Orden über. Die meisten Güter wie auch die Ordensbrüder wurden von den Johannitern übernommen. Streitigkeiten gab es lediglich im Land Lebus, weil dort die Markgrafen von Brandenburg Anspruch auf die Besitzungen anmeldeten.
Quellen
- H. Lüpke / W. Irgang (Hg.), Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin und der Kirchenprovinz Gnesen, Köln 1988.
- S. Seelbach (Hg.), Die Legende der heiligen Hedwig. In der Übersetzung des Kilian von Meiningen, Münster 2016, Kap. III, S. 51 u. Kap. VI, S. 77.
Sekundärliteratur
- G. J. Brzustowicz, Die Aufhebung des Templerordens in der Neumark und in Pommern, in: Chr. Gahlbeck / H.-D. Heimann / D. Schumann (Hg.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin 2014, S. 155–170.
- M. Golinski, Templariusze a bitwa pod Legnica, proba rewizji pogladow, in: Kwartalnik Historiyczny 98, 3 (1991), S. 3–15.
- M. Golinski, Uposazenie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 roku, in: Kwartalnik Historyczny 98, 1 (1991), S. 3–20.
- H. Lüpke, Das Land Tempelburg. Eine historisch-geographische Untersuchung, in: Baltische Studien, neue Folge 35 (1933), S. 42–97.
- M. Przybyt, Die Herzöge von Großpolen und Schlesien und die Templer im Raum an der mittleren Oder und unteren Warthe, in: Chr. Gahlbeck / H.-D. Heimann / D. Schumann (Hg.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin 2014, S. 140–154.
- J. Spors, Poczatki i stan poziadanica templariuszy w ziemi Kostrzynskiej w latach 1232–1261, in: Studia i Materialy do Dziejow Wielkopolski i Pomorza 16, 2, 32 (1987), S. 111–128.
- M. Starnawska, Notizie sulla composizione e sulla struttura dell’ordine del Tempio in Polonia, in: F. Sarda / G. Minnucci (Hgg.): I Templari, Mito e Storia, Siena 1989, S. 142–151.
- M. Starnawska, Zur Geschichte der Templer in Polen, in: Chr. Gahlbeck / H.-D. Heimann / D. Schumann (Hg.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin 2014, S. 47–62.
- M. Starnawska, The Commanderies of the Templars in the Polish Lands and Their History after the End of the Order, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 301–316.
Ponferrada (Komturei, Spanien)
Ponferrada liegt sich im Norden Spaniens, an der Pilgerstraße nach Santiago de Compostela, auf einem Hochplateau am Fluss Sil. In Mittelalter gehörte die Region zum Königreich Kastilien-Léon.
Bauliche und territoriale Entwicklung
Urkundliche Quellen für die Gründung der Niederlassung sind nicht bekannt. Im Februar 1178 war Ponferrada jedenfalls im Besitz des Templerordens, wie eine Verkaufsurkunde des Klosters San Pedro de Montes beweist, in der als Zeugen der Provinzmeister Gui de Guarda und sein Amtswalter in Ponferrada als Zeugen genannt sind: „magistro Guidone tenente Pontem Ferratum, de sua manu Fratre Helia“ (ed. Quintana Prieto, S. 319f). Zur Befestigungsanlage gehörte eine kleine Siedlung; beides war von einer äußeren Mauer umschlossen. Ponferrada wurde zum Teil mit den Niederlassungen von Rabanal und Pieros zusammen verwaltet, wie Amtsbezeichnungen des Komturs zeigen.
Beziehungen und Konflikte
1204 scheint es einen Konflikt mit König Alfonso IX. gegeben zu haben und der Orden verlor seine Besitzungen in Léon. Ponferrada ist daraufhin einige Jahre in säkularer Hand dokumentiert. Vom 29. April 1211 datiert eine Urkunde König Alfonsos IX., mit der er den Templern neben weiterem umfangreichen Landbesitz Ponferrada mit seinen zughörigen Ländereien und Rechten restituiert: „do eis Pontem ferratum integre cum omnibus suis alfozes, et cum omni suo portatico, et cum omnibus directuris et pertinencis“. Im Gegenzug verspricht Provinzmeister Gomez Ramirez für den Orden, von der Geltendmachung von Anrechten auf die Burgen von Portozolo und Mascora, sowie weiteren Streitfragen und Forderungen („questionibus sive demandis“) abzusehen. Der König verspricht, den Vertrag immer einzuhalten und die Ordensbrüder mit allen jetzt restituierten Besitzungen zu verteidigen. Sollte jemals ein Provinzmeister von Léon gegen den Vertrag verstoßen, sollen dem Orden die Besitzungen wieder entzogen werden. Bricht ein König den Vertrag, sollen die Templer neben ihren Besitzungen auch wieder die Anrechte auf die strittigen Burgen erhalten. Darüber hinaus soll der Orden noch zwei weitere Burgen (St. Petro de Taraze und Alva de Aliste) übernehmen, falls sie erobert werden können (ed. González, S. 370-372).
1218 kam es zu einem Streit mit San Pedro de Montes über einen größeren Landbesitz, der von beiden Parteien aufgrund königlicher Schenkung beansprucht wurde. Die Kontrahenten ernannten Anwälte, Richter wurden eingesetzt und vom König bestätigt. San Pedro de Montes konnte seine auf König Ordoño aus dem 10. Jahrhundert zurück reichenden Ansprüche mit einer Urkunde belegen, woraufhin Alfonso IX. seine eigene Schenkung an die Templer für nichtig erklärte und dem Kloster die strittige Immobilie zusprach (ed. Quintana Prieto, S. 385f).
Laut der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstandenen Crónica de Fernando IV stellte der damalige Provinzmeister von Kastilien-Léon während des Prozesses 1308 die Besitzungen des Ordens inklusive Ponferradas unter den Schutz des Infanten Don Felipe. Nach Aufhebung des Templerordens 1312 befand sich Ponferrada zunächst im Besitz der Adelsfamilie der Osorio, um schließlich endgültig an die Krone zu fallen.
Architektonische Überreste
Im 15. Jahrhundert wurden weitgreifende Um- und Neubauten wurden vorgenommen, die aus der ursprünglich moderaten Anlage das große Ensemble formten, das man heute - inklusiver mehrfacher Restaurierungen - zu sehen bekommt. 1879 wurde Ponferrada zum Monumento Nacional erklärt. Aller touristischer Vermarktung der „Templerburg“ zum Trotz stammt nur ein kleiner Teil der alten Ringmauer noch aus Templerzeit. Die zwei innerhalb befindlichen Burgen inklusive des fotogenen turmbewehrten Portals sind jüngeren Datums.
Populärkultur
El señor de Bembibre
Die Renaissance Ponferradas als Templerburg begann im 19. Jahrhundert. Enrique Gil y Carrasco ließ seinen 1844 erschienenen Roman El señor de Bembibre zum Teil in Ponferrada spielen, wo in der Geschichte der Provinzmeister der Templer residiert. Der vielfach neu aufgelegte und adaptierte Klassiker erzählt ein höfisches Liebesdrama vor dem Hintergrund des Templerprozesses. Anders als bei Walter Scott haben die Templer bei Carrasco jedoch eine positive Rolle.

Der Templer findet die Marienstatute. Skulptur von Venancio Blanco, 2003
Virgen de la Encina
Als Patronin von Stadt und Umland gilt eine hölzerne Madonnenstatue, die „Virgen de la Encina“, die laut der Legende im 5. Jahrhundert aus Jerusalem nach Spanien gebracht worden war. Während der muslimischen Eroberung sei sie im Inneren einer Eiche (=Encina) versteckt worden – wo sie Anfang des 13. Jahrhunderts ein Templer entdeckt habe, der Bauholz für die Errichtung der Burg von Ponferrada suchte. Vollplastische Figuren waren – aufgrund ihrer Nähe zu heidnischen Statuen - in der Kirche jedoch bis ins 9./10. Jahrhundert nicht üblich. Überdies zeigt die fragliche Madonnenstatue bereits auf den ersten Blick ihre Entstehungszeit mit dem 16. Jahrhundert an. Die überlieferten Wunder der Statue trugen sich im 17. und 18. Jahrhundert zu. Die Legende der „Virgen de la Encina“ scheint relativ spät entstanden zu sein. 1850 wurde die Legende erstmalig schriftlich festgehalten. Der heutige Kirchenbau der Basílica de la Encina ersetzte im 16. und 17. Jahrhundert eine aus dem 12. Jahrhundert stammende Kirche. An den Wänden befinden sich Tafeln, die die Hauptpunkte der Legende widergeben, so zum Beispiel „13. Jahrhundert: Auffindung [der Statue] durch die Templer im Stamm einer Eiche“. Der Kult der Regionalpatronin ist sehr lebendig und wird jährlich im September mit Prozessionen und großem Festprogramm begangen. Mit dabei ist stets die Folkloregruppe „Templarios del Oza“. 2003 schuf der Bildhauer Venancio Blanco die heute vor der Kirche befindliche Statue, die die Auffindung der Marienstatue durch einen Templer verbildlicht.

Noche Templaria
Noche Templaria
Seit 1999 werden in Ponferrada außerdem die Noche Templaria gefeiert, ein großes Mittelalter-Fantasyspektakel, das mit allen Templerklischees der Populärkultur aufwartet. Inszeniert wird die Ankunft des Templer-Provinzmeisters Gui de Guarda, der mit der Stadt einen ewigen Pakt schließt, und in ihr die Bundeslade und den Gral in Sicherheit bringt. Die „Templer“ ziehen in weißer Gewandung durch die Stadt, wobei Gral und Bundeslade in Prozession getragen werden. Neumitglieder werden mit Ritterschlag in die „Bruderschaft“ aufgenommen.
Komture von Ponferrada (nach Luengo y Martinez):
~ 1178 Helias
~ 1185 Fr. Terrenjor ?
~ 1198 Pedro
~ 1202 Fernande Tagaio
~ 1210 Rodrigo Fernández
~ 1211 / 1218 Diego Manso
~ 1225 Martinez Fernández
~ 1226 Diego Manso
~ 1230 Rodrigo Fernández
~ 1232 Diego Manso
~ 1240 / 1246 Juan
~ 1249 Juan Fernández, el Viejo
~ 1251 Pedro Ares Gómez
~ 1252 Didacos Moreno
~ 1254 Arias Gomez
~ 1259 Pedro Rodriguez
~ 1260 Lope Sánchez
~ 1266 Rodrigo Yánez / Ibán Sagerado
~ 1271 Lorenzo Martinez
~ 1272 Gil Gato
~ 1275 Juan Galván
~ 1280 Ruy Garcia
~ 1293 Fernande Themes
~ 1294 Diego Perez
~ 1307 Ferrand Moniz
Komture (nach Quintana Prieto)
~ 1224 Domingo Fernández (“Pieros”)
~ 1225 Martin Fernández
~ 1230 Rodrigo Fernández
~ 1232 Diego Manso
~ 1235 Miguel („Rabanal, el Bierzo“)
~ 1240 / 1246 / 1249 Juan Fernández („Ponferrada, Rabanal, Pieros”)
~ 1254 Arias Eanes
~ 1257 Juan Galván
~ 1259 Pedro Rodríguez
~ 1260 Lope Sánchez
~ 1261 Pedro Ares Gómez
~ 1271 Lorenzo Martínez
~ 1272 Gil Gato
~ 1280 Ruy García
~ 1307 Fernando Muniz
Anke Napp
Quellen
- C. Bénitez Guerrero (Hg.), Crónica de Fernando IV, Sevilla 2017.
- J. Gonzalez (Hg.), Alfonso IX, Bd. II, Madrid 1944, Nr. 274, S. 370-372.
- M. González del Valle, Historia de la milagrosa imagen Ntra. Sra. de la Encina, Ponferrada 1850: URL.
- Quintana Prieto, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, Leon 1971, S. 319f., 385f.
Sekundärliteratur
- Th. Biller, Templerburgen, Mainz 2014, S. 137f.
- F. Cobos Guerra / J. J. de Castro Fernández, Castillo de Ponferrada, Leon 2002 (Archäologische Untersuchungen)
- González Díaz / A. Balado Pachón, u.a. (Hgg.), Fortificationes de los siglos XII y XIII en las fronteras del reino de León, Léon 2012, S. 227-233.
- G. Martinez Diez, Los Templarios en la Corona de Castilla, Burgos 1993, S. 85-89.
- J. M. Luengo y Martínez, El Castillo de Ponferrada y los Templarios, Léon 1929.
Populärkultur
- C. Cárcamo Villar, Ponferrada / La Noche Templaria, Bericht auf espanafascinante.com vom 19. Juni 2023: URL.
- E. Gil y Carrasco, El señor de Bembibre, Madrid 1844: URL.
- La Noche Templaria, Bericht auf castillodelostemplarios.com: URL.
Pombal (Burg, Portugal)
Eine auf einem Hügel über der gleichnamigen Stadt gelegene Befestigung wurde den Templern um 1128 übereignet. Wann die heute noch sichtbare Burg mit ihrer von acht Türmen flankierten Mauer entstand, ist in der Forschung allerdings umstritten. Die Meinungen schwanken zwischen 1156 und 1171. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Außenmauern restauriert. Die Reste der Innenbebauung stammt laut Biller wohl größtenteils aus dem 15. und 16. Jahrhundert, ebenso wie Vorburg und Zwinger. Unter dem Innenhof befindet sich eine gewölbte Zisterne.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Biller, T.: Templerburgen, Darmstadt 2014, S. 126f.
Portugal
Die Grafschaft „Portucale“ wurde im 9. Jahrhundert auf dem Gebiet des Königreiches Asturien-Léon errichtet. 1095 wurde Heinrich von Burgund durch den König von Léon mit der Grafschaft belehnt. Der Sieg Graf Alfonsos gegen die Almoraviden in der Schlacht von Ourique 1139 stärkte dessen Prestige so, dass er schließlich den Königstitel annahm. 1166 erlangte Portugal die rechtliche Unabhängigkeit von Léon.
Schenkungen und Privilegien
Da die Territorien von Portugal, Léon und Kastilien bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts vereinigt waren (bzw. Kastilien und Léon seit 1230 erneut dauerhaft), umfasste auch die Templerprovinz teilweise alle „drei Königreiche“. Die Provinzmeister tragen in den Urkunden zum Teil den Titel „Meister/Präzeptor/Komtur in Portugal“, zum Teil „Meister in den drei Königreichen Portugal, Léon und Kastilien“.
Noch im gleichen Jahr, in dem das Konzil von Troyes den neuen Templerorden bestätigt hatte, reiste ein Bruder namens Raimond Bernard über die iberische Halbinsel und knüpfte erste Beziehungen. Die älteste erhaltene Urkunde stammt vom 19. März 1128: mit ihr übereignet die damalige Regentin von Portugal, Teresa de Léon, dem Orden die strategisch bedeutsame Burg Soure im Süden von Coimbra. Im Gegenzug versprachen Vertreter des Ordens bei der Reconquista des Landes von den Mauren zu helfen.
Bis in die 1160er Jahre war Soure das Zentrum des Ordens in Portugal, anschließend wechselte der Sitz nach Tomar. In den folgenden Jahren wurde von den Templern eine regelrechte Verteidigungslinie errichtet, die die Burgen von Almourol, Tomar und Pombal einschloss.
1190 versuchte der König von Marokko, Tomar zu erobern und sich so ein Einfallstor in das christliche Portugal zu eröffnen. Der Versuch scheiterte und trug weiter zum hervorragenden Ruf der Templer bei. Es gelang ihnen, um Tomar und Coimbra ein Territorium zu sichern, in dem sie alle Herrschaftsrechte innehatten. Mit letztlich dreizehn Burgen im Besitz des Ordens stellten die Templer ab den 1170er Jahren - gemeinsam mit den anderen in der Region aktiven Ritterorden – einen wichtigen Faktor in der Verteidigung des christlichen Gebietes dar. Auch in der Gründung neuer Dörfer waren die Templer aktiv.
Beziehungen und Konflikte
Auf dem Engagement bei der Reconquista wuchs eine gute Zusammenarbeit zwischen Krone und Orden. Alfonso I. war vermutlich Donat des Ordens. Auch der Hochadel unterstütze die Templer, unter ihnen Fernão Mendes de Bragança, der den Templern 1145 weitere Burgen übereignete, darunter auch die an der Grenze zu den christlichen Königreichen Léon-Kastilien gelegenen Mogadouro und Penas Róias - letztere wurden allerdings später gegen andere Besitzungen getauscht.
1147, nachdem die Templer bei der Eroberung von Santarem und der Belagerung von Lissabon Unterstützung geleistet hatten, übergab der König dem Orden die Rechte an den Kirchen von Santarem. Nach der Gründung des Bistums Lissabon im selben Jahr führte dieses Privileg zu einem längeren Streit, der erst nach zehn Jahren beigelegt werden konnte. 1159 einigte sich der damalige Provinzmeister Gualdim Pais mit dem Bischof von Lissabon und übertrug ihm die Rechte an den Kirchen von Santarem. Als Ausgleich erhielten die Templer die Burg und Territorium von Ceras durch den König. Mit dem Bau von Tomar ab 1160 avancierte die Region zum neuen Zentrum. 1169 offerierte der König den Prokuratoren des Ordens Geoffroi Foucher, Gualdim Pais und Garcia Romeo ein Drittel des (noch zu erobernden) Landes südlich des Tejo: „pactum donationis, et firmitudinis de omni tertia parte, quam per Dei gratiam acquirere, et populare potuero a flumine Tago, et ultra“ (ed. Viterbo II, S. 239f). Das Schenkungsversprechen schloss nicht nur den König selbst, sondern auch seine Nachkommen ein, solang der Krieg gegen die „Sarazenen“ dauere. Trotz Teilnahme von Ordensbrüdern an den weiteren Kampfhandlungen wurde diese Möglichkeit zum Landausbau aber nicht genutzt. Im Zuge des Prozesses und der Bemühungen des portugiesischen Königs um die Templerbesitzungen wurde ein Dokument verfasst, dass den Lehenseid des Provinzmeisters an den König (wie er später im Christus-Ritterorden üblich wurde) beweisen sollte. Die ältere Forschung ging davon aus, dass diese Lehensabhängigkeit bereits in der Periode der Templer existiert hatte. Im Licht neuerer Urkundenstudien ist dies jedoch nicht haltbar. Ab 1172 waren zudem weitere Ritterorden aktiv, die von königlichen Schenkungen profitierten.
Unter König Alfonso III., in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, verringerte sich das Wohlwollen der portugiesischen Könige gegenüber dem Orden. Dennoch erfolgten noch immer Schenkungen, wie 1299 das Patronatsrecht an der Marienkirche in Portalegre und 1303 die Burg von Pena-Garcia beweist.
Während des Prozesses erwies sich König Dinis I. keineswegs als selbstloser Retter der Templer, der für sie einen neuen Orden einrichtet. Zwar erhob er keine Vorwürfe der Ketzerei gegen den Orden. Er strengte jedoch Gerichtsverfahren an, um zu beweisen, dass die an den Orden einst übertragenen Güter diesem nur zur Verwaltung übertragen worden waren, solange eine Hilfe bei der Reconquista erfolge. Nunmehr müssten sie an die Krone zurückfallen. 1318 gründete Dinis I. einen neuen Orden, den sogenannten Christus-Ritter-Orden, der die Güter des aufgelösten Templerordens übernahm, jedoch nicht alle Mitglieder. Die Christus-Ritter erhielten auch eine modifizierte Verfassung: als ihr spirituelles Oberhaupt sollte der Zisterzienserabt von Alcobaça fungieren, weltliches Oberhaupt war - durch Lehenseid des Meisters - der König. Die Pensionen für die ehemaligen Templer sollten von den Johannitern in der Provinz Aragon-Katalonien gezahlt werden, was zu langen Streitigkeiten führte.
Nachleben
Die Archive des portugiesischen Zweiges des Ordens gingen zum Teil ebenfalls in den Besitz des Christusordens über; einige Dokumente gelangten jedoch in das Kronarchiv. Nach der Auflösung des Christusordens 1833 kamen auch die dort gelagerten Archivalien in das Kronarchiv von Torre do Tombo. Im 15. Jahrhundert nannte der Verfasser der Gesetzessammlung der Ordenações Afonsinas die „Sodomie“ als Grund für den Untergang der Templer und meinte, der Orden sei zu Recht vernichtet worden. Die Ansicht blieb allerdings in der portugiesischen Geschichtsschreibung eine Ausnahme. Generell ließe sich die Haltung den Templern gegenüber als neutral bis wohlgesonnen beschreiben.
Während der Diktatur von António de Oliveira Salazar (1932-1968) wurde das Erbe der Templer nationalpolitisch instrumentalisiert. Burgen wurden restauriert, jedoch auch inszeniert. Im heutigen Portugal werden der Templerorden und seine Burgen vor allem touristisch vermarktet. Es gibt eine Reise- und Wanderrouten auf den Spuren der Templer, Feste und Kinderbücher zum Thema.
In der modernen Populärliteratur wird zuweilen die Aktivität Portugals und Heinrichs des Seefahrers als Administrator des Christus-Ritterordens benutzt, um auf mögliche geheime Kenntnisse zu verweisen, die von den Templern „geerbt“ worden seien. So behauptete die populäre Sendung Terra X von 1999:
„In Portugal erlebte der verbotene Orden ein erstaunliches Comeback. Hinter dem Coup steckte ein schlauer König, der zu einem Etikettenschwindel griff: Unter dem neuen Namen Christusritter wandelte sich die kriminelle Vereinigung ab 1319 zur staatstragenden Elitetruppe Portugals.“ (Terra X – Der Templer-Coup von Portugal, auf: ZDF online, Zugriff 15.8.2000)
Im Making of der Sendung wird berichtet, wie dem Team von Terra X in Tomar die Drehgenehmigung verweigert wird. Dem Geheimnis der Schätze und okkulten Praktiken konnte man so leider nicht auf die Spur kommen.
Andere Autoren bringen „Portugal“ mit dem Heiligen Gral in Verbindung und sehen im königlichen Signum auf der Schenkungsurkunde der Region Ceras einen Geheimauftrag an die Templer. Tourismus - und Esoterikseiten berichten, dass in Tomar der Gral vermutet werde. Auch die zeitliche Nähe der Gründung des Templerordens und der Formierung Portugals als unabhängiges Königreich führte Autoren dazu, eine Verbindung zu ziehen und Portugal als „Templerstaat“ zu stilisieren. In diesen Fällen wird Alfonso I. als Professmitglied der Templer vorgestellt.
Provinzmeister (nach dem Elucidario):
~1128 Guilherme Ricardo
~1128 Raimundo Bernardo
~1140 Pedro Froilaz („Procurador“)
~1143 Ugo de Martonio (“Procurador”)
~1145 Sueiro (“Ministro da Ordem de Templo nos tres Reinos de Hespanha”)
~1157 Pedro Arnaldo (“Procurador / Mestre”)
~1157 Gualdim Pais (“Mestre em Portugal”
~1197 Lopo Fernandez
~1206 Fernando Dias
~1208 Jodo Domingues (?)
~1210 – 1212 Gomes Ramirez
~1214 Pedro Alvitis (“Magister Templi in quibusdam partibus Yspaniae”/ “Portugal, Léon, Castilia”)
~1223 Pedro Annes
1228 Martim Sanches (“Mestre nos tres reinos”)
~1229 Estevao de Bel-Monte (“Mestre nos tres reinos”)
~1239 Guilherme Fulcon (“Preceptor DOmorum Militiae Templi in tribus Regnis Hispaniae”)
~1242 Rodrigo Dias (?)
1242 Joao Escriptor (? “Magister Templi”)
1242 Martim Martins (“Magister in tres Regnos de Hispania”)
~1247 Pedro Gomes (“In tribus Regnis Hispaniae Magister”)
~1250 Payo Gomes (“Mestre nos tres Reinos”)
~1253 Martinho Nunes (“Mestre nos tres Reinos”)
~1265 Gonzalo Martins
~1271 Joao Annes (?)
~1272 Beltram de Valverde
~1283 Joao Fernandes (“Mestre nos tres Reinos
~1289 Afonso Gomes (“Mestre do que a Ordem do Templo ha en Portugal”)
~1291 Lourenzo Martins
~1293-1311 Vasco Fernandes
Quellen
- Originalurkunde der Schenkung von Soure, Arquivo Nacional Torre de Tombo, Ordem de Cristo e Convento de Tomar, Documentos régios, mç. 1, n.º 1: URL.
- Publica Forma der Gründungsbulle der Christusritter 1320, Arquivo Nacional Torre de Tombo Gav. 7, mç. 8, n.º 5: URL.
- A. Ferreira, Supplemento historico ou memorias, e noticias da celebre Ordem dos Templarios, para a Historia da admiravel Ordem de Nosso Senhor Jesu Christo, Lissabon 1735, 2 Bde. URL (Bd. 1,1), URL (Bd. 1,2).
- J. de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram [...], 2. Erweiterte Edition, Porto-Lissabon 1865, Bd. 2, S. 231-248 (Urkunden zu den Templern aus den kgl. Archiven, Provinzmeister): URL.
Sekundärliteratur
- M. J. Barocca, Os castelos templários em Portugal e a organizacao da defesa do reino no séc. XII, in: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 22/2 (1999–2001), S. 213–227: URL.
- J. M. Capelo, Portugal templario, Lissabon 2003.
- J. Fuguet / C. Plaza, Los templarios en la Península Ibérica, Barcelona 2005.
- J. Gaio, Quando Salazar ofereceu uma festa ao corpo diplomático no castelo de Almourol, Artikel vom 1. Dezember 2018, auf Mediotejo.net: URL.
- N. V. Oliveira, Castelos Templários em Portugal (1120–1314), Lissabon 2010.
- K. Toomaspoeg, Historiographie de l'Ordre du Temple au Portugal: status quaestionis, in: I Colóquio Internacional. Cister, os Templários e a Ordem de Cristo, Actas, Tomar 2012, S. 171–191.
- J. M. Valente, The New Frontier. The Role of the Knights Templar in the Establishment of Portugal as an Independent Kingdom, in: Mediterranean Studies 7 (1998), S. 49–65.
Populärliteratur
- G. Kirchner, Schwertbrüder. Der Templer-Coup von Portugal, in: G. Kirchner (Hg.), Terra X – Von Babylon zum Bernsteinwald, 2. Aufl., München 1999, S. 54–105.
- F. Silva, First Templar Nation. How the Knights Templar created Europe’s first nation-state and a refuge for the Grail, Rochester 2017.
Prag (=Praha, Komturei, Tschechien)
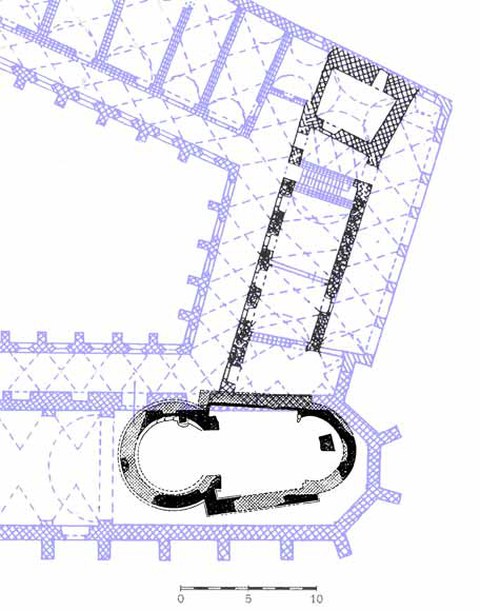
Komturei und umgebaute St.-Laurentiuskirche. Die Vorgänger-Rotunde (li.) wurde als Abschluss in den Langhausbau integriert.
Prag gehörte zur Deutschen Ordensprovinz. Die Prager Templerkomturei St. Laurentius wurde wahrscheinlich zwischen 1230 und 1238 gegründet. Erwähnt wird sie in mehreren Urkunden, sowie im Dresdener Manuskript der Zweiten Fortsetzung der Chronik des Kosmas von 1340 und der Chronik Neplachov's von 1371. Laut der 1718 erschienenen Böhmischen Chronik Wenceslaus Hájeks war es König Wenzel I., der 1249 dem Orden die St. Laurentiuskirche schenkte.
Das vorhandene Gotteshaus (der Legende nach eine vom Heiligen Wenzel errichtete Rotunde) wurde umgebaut, damit es den neuen liturgischen Erfordernissen und einer größeren Zahl Gottesdienstbesucher gerecht wurde, und außerdem eine Klosteranlage für die Ordensbrüder errichtet. Diese Arbeiten dauerten bis in das Jahr 1253. Die Böhmische Chronik nennt als Verantwortlichen für die Bauarbeiten einen „Obersten Meister des Ordens“ namens Peter Ostrew. Möglicherweise handelt es sich um den Komtur der Prager Niederlassung. Unter dem folgenden Meister der Unterprovinz Peter Berka seien die Klostergebäude errichtet und der Komplex „Jerusalemkloster“ genannt worden.
Erst auf das 18. Jahrhundert geht die Annahme zurück, dass sich weitere Besitzungen mit „kapellenähnlichen Kellerstrukturen“ in der Langen Straße befunden haben könnten. (Jaroslaus Schaller) Ein „Zum Templ“ genanntes Haus in der Templerstraße, in dessen Keller sich die Templer nach Auflösung des Ordens versammelt haben sollen, wird in der Geschichte Prags von E. Ruth (1922) erwähnt. Die Bezeichnung „in templo“ taucht bereits 1363 in einer Urkunde auf. Anfang des 18. Jahrhunderts vermuteten Forscher hier die erste Prager Niederlassung mit Kirche St. Paul und einem Krankenhaus. Gesicherte Nachweise über Ordensbesitz an dieser Stelle gibt es jedoch nicht. Einer angeblichen Niederlassung am Altstädter Ring, zugeschrieben aufgrund eines „Templergemäldes“, ist jegliches historische Fundament abzusprechen.
Am 7. September 1294 gab König Wenzel seine Einwilligung zum Verkauf des Gutes Wodochot (= Odolena Voda) an den Erzbischof von Prag. Über den Erhalt der Kaufsumme wurde dem Erzbischof eine Quittung ausgehändigt, die der Provinzmeister für Deutschland, Slavien, Böhmen und Mähren, zu dieser Zeit Bertram von Esbek, am 25. Mai 1295 ausstellte. In ihr wird Bruder Ekko, amtierender Komtur von Scheikwitz und Aurschinewes, als durchführender Verkäufer und Geldempfänger benannt. Zur Niederlassung in Prag gehörte ein Hof im damaligen Dorf Rudgerslag (= Riegerschlag, tsch. Lodherov), der den Templern von Ritter Ulrich II. von Neuhaus 1297 geschenkt worden war.
Architektonische Überreste
Nach der Aufhebung des Templerordens fiel auch die Prager Komturei an die Johanniter, wo der Besitz jedoch nur kurz verblieb. Bereits am 9. Mai 1313 verkaufte der Johannitermeister Berthold den Templerhof an die Dominikanerinnen, die bisher bei St. Anna gewohnt hatten. Anfang 1321 begannen die Dominikaner mit dem Umbau der Templerkirche, den sie nach 1339 vollendet hatten. Die Templerkirche wurde abgerissen und an ihrer Stelle die große gotische Kathedrale St. Anna erbaut. Von den Vorgängerbauten legen nur archäologische Funde aus den Jahren 1956/57 noch Zeugnis ab.
Populärkultur
Laut Karl Gottlieb Anton retteten die böhmischen Templer während des Prozesses ihr Leben, indem sie ihren Habit ablegten und ihre Festungen dem König übergaben „einige wenige in Prag ausgenommen, welche ihre Wohnungen nicht verlassen wollten, und daher ermordet wurden“ (Anton, S. 142)
Im 19. Jahrhundert gab der „böhmische Walter Scott“ Prokop Chocholoušek in seinem Roman Die Templer in Böhmen eine fantasievolle Beschreibung des längst nicht mehr existierenden Prager Templersitzes:
,,Es war ein großes Haus, quadratisch, auf den ersten Blick ein wunderschöner Palast, aber wer sein Äußeres genau betrachtet, wird bald erkannt haben, dass es eine extrem starke Festung ist, eine fast uneinnehmbare. Alles, was als Dekoration diente, war in der Hauptsache zum besseren Schutz des Palastes; zahlreichen Türmchen, sehr schön gebaut, waren Aufenthaltsorte für Bewaffnete, von dort aus könnten sie mit Waffen den Feind bekämpfen; selbst der große Turm mit der großen goldenen Kuppel hatte den Zweck, dass von der Höhe die Umgebung beobachtet werden konnte, und wenn erforderlich, könnten militärische Mittel zum Einsatz mit zusätzlichem Vorteil kommen. Das Dach war flach, mit einem hohen festen Geländer, hinter ihm patrouillierten Wachen, die nur vom Kopf bis zur Brust gesehen werden konnten. […] Über dem Tor schmückte eine Reihe von Marmorsäulen, in ein Wandschild waren zwei Ritter auf einem Pferd reitend eingeschnitzt, und oben auf dem Hauptturm wogten im Winde schwarz-weiße Banner, auf denen in der Sonne die goldene Inschrift funkelte: „Nicht uns, oh Herr! Nicht uns, sondern zur Ehre Deines Namens!" Das war Jerusalem, der Haupthof der Templer, der Sitz des Böhmisch-Mährischen Großmeisters […] Das Burgtor führte auf einen großen quadratischen Vorhof, von dort begann ein niedriger gewölbter Durchgang, der in einem kleineren Hof endete. An allen Seiten des großen Vorhofs waren breite Steintreppen, die in die große Halle mündeten, rund um das Haus verliefen, sich auf den Vorhof öffneten und mit niedrigem Gitterwerk mit Spalten in römischem Stil ausgestattet waren, auf ihnen ruhte ein zweiter Himmel, von da führte eine Tür in die Haupthalle und zu den Kammern des Großmeisters."
Die angeblichen Templer/Freimaurergemälde mit geheimen Symbolen, die im 19. und 20. Jahrhundert für einige Aufregung sorgten, waren um 1810 nach den Entwürfen des letzten Besitzers des Gebäudes angefertigt worden, der dieses dadurch touristisch aufzuwerten gedachte.
Anke Napp, mit F. Sengstock und H. Paulus
Komture:
1249–53 Peter Ostrew (?)
~1267 Sulizlaus (?)
~1294 Ekko
Quellen
- V. Hájek z Libočan, Wenceslai Hagecii von Libotschan, Böhmische Chronik, vom Ursprung der Böhmen, von ihrer Hertzogen und Könige, Grafen und Adels Ankunfft, ed. J. Sandel, Leipzig 1718, S. 422: URL.
- F. M. Pelzel, Beiträge zur Geschichte der Tempelherren in Böhmen und Mähren, Prag 1798, Nr. V und VI, S. 227f (Urkunden zum Verkauf von Wodochot): URL.
Sekundärliteratur
- K. G. Anton, Versuch einer Geschichte des Tempelherrenordens, Leipzig 1779, S. 142: URL.
- J. E. Horky, Die Tempelherren in Mähren. Sagen, Untersuchungen, Geschichte, Znaim 1845.
- M. Schüpferling, Die Templerherren-Orden in Deutschland, Bamberg 1915, S. 161–165.
Belletristik
- P. Chocholoušek, Templari V Cechach, historicky roman ve trech dilech, 3 Bde. Prag 1843.
Profess
Siehe Ordensaufnahme.
Prokuratoren
Ein Prokurator (actor, sindicus, nuntius) war ein eigens bestellter Rechtsvertreter, der die Anliegen eines Ordenshauses oder einer Provinz gegenüber einer anderen Instanz vor Gericht vertrat. Ein Prokurator wurde mit einem schriftlichen Mandat (cum litteris procuratoris), durch den Provinzmeister oder den Visitator ernannt. Es gab Ordensbrüder, die zu Prokuratoren ernannt wurden, aber auch externe Personen. Besondere Berühmtheit erlangten die während des Prozesses bestellten Prokuratoren.
Anke Napp
Quellen für diesen Artikel und weiterführende Literatur:
- Die Ausführungen beziehen sich auf einen Vortrag, gehalten von Christian Vogel "Prokuratoren der Templer: Diplomatische und rechtliche Aspekte ihrer Einstzung und ihrer Aufgaben", am 26. 2. 2014 auf der Internationalen Konferenz "Die Templer (1119-1314). Bilanz und Perspektiven der Forschung.
Provinzen
In den ersten Jahren der Existenz des Ordens gab es keine Provinzen in Europa. Erste Schenkungen in den europäischen Königreichen zeigten aber sehr bald die Notwendigkeit einer administrativen Gliederung abseits der Hierarchie in den Kreuzfahrerstaaten.
Urkunden zeigen, dass es bereits in den 1130er Jahren gab es eine spanische Provinz der „drei Königreiche“ (=Léon, Kastilien und Portugal) und eine weitere in Westspanien/Südfrankreich (Aragon, Katalonien, Provence), wenig später auch eine Provinz in England.
Die Retrais der Regel, redigiert um 1165, zählen bereits sieben Provinzen des Ordens auf: Frankreich, England, Poitou, Aragon, Portugal, Apulien und Ungarn („France, Engleterre, Peito, Aragon, Portegal, Puille, Hongrie“, ed. Curzon § 87, S. 80). Gemäß der politischen Teilung der 60er Jahre des 12. Jahrhunderts umfassten diese Provinzen folgende Regionen: Frankreich: Ile de France, Champagne, Burgund. Poitou: Poitou und Aquitanien. England: England, Schottland, Normandie. Apulien: Apulien und Sizilien.
Änderungen in der politischen Landschaft – wie die Errichtung des Königreiches Portugal oder die Neuordnung im französischen Süden infolge des Albigenserkreuzzuges - und die Ausweitung der Niederlassungen des Ordens machten die Ordensprovinzen zu fluiden Einheiten. Bestehende Provinzen konnten geteilt, und neue Provinzen oder Unterprovinzen geschaffen werden, wie die „Provence“ 1239 oder „Böhmen und Mähren“ Ende des 13. Jahrhunderts. Es wurden auch gänzlich neue Ordensprovinzen eingerichtet, wie „Romania“ (auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands und der Türkei) nach der Gründung des Lateinischen Kaiserreiches von Byzanz.
Urkunden und die Akten aus dem Prozess gegen den Orden, in denen Provinzmeister namentlich genannt werden, zeigen den Stand in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts bis ins 14. Jahrhundert. Damals existierten demnach folgende Provinzen: Frankreich, Provence, Aquitanien und Poitou (unter einem Provinzmeister ab 1301), Normandie, Auvergne, Aragon/Katalonien einschließlich Mallorcas, Kastilien/Léon, Portugal, England mit der Unterprovinz Irland, Deutschland mit der (Unter-)Provinz Böhmen und Mähren und der (Unter-)Provinz Polen, Norditalien mit Rom, Apulien und Sizilien, Ungarn (einschließlich Kroatien), Romania, Armenia.
Die Insel Zypern war der Hauptsitz des Ordens nach dem Verlust des Heiligen Landes und besaß keinen eigenen Provinzmeister. Welche Niederlassungen als Zentrum einer Provinz angesehen wurden, blieb nicht immer konstant. Insbesondere auf der iberischen Halbinsel änderte sich dies im Zuge politischer Neuordnungen. Gewöhnlich fanden in den Provinzhaupthäusern die jährlichen Provinzialkapitel statt, zu denen die Komture der einzelnen Häuser zu erscheinen hatten. Die Haupthäuser dienten aufgrund ihrer Lage und Befestigung in vielen Fällen auch als Sammelort für Steuern des Landesfürsten oder sicherer Verwahrort für den Kronschatz, wie in London und Paris.
Laut der Ordensregel, § 87, sollten die Provinzmeister durch den Meister und das Generalkapitel ernannt werden. Anfang des 14. Jahrhunderts scheinen auch die Visitatoren als Stellvertreter des Meisters im Westen diesbezügliche Autorität gewonnen zu haben. Gewöhnlich wurden Provinzmeister aller vier Jahre zur Rechenschaftslegung vor das Generalkapitel beordert. Die in den Quellen für die Provinzmeister auftauchenden Bezeichnungen variieren. Man findet magister, preceptor, magister et procurator, aber auch eher überraschende rector et minister oder prior. Eine seiner Aufgaben war die Sammlung der schuldigen Responsiones, der Gelder, die jedes Ordenshaus für den Unterhalt der Brüder und Häuser im Orient zu leisten hatte.
Provinzmeister hatten oft eine bedeutende Stellung am Hof det Landesfürsten, fungierten als Berater, Diplomaten in Gesandtschaften und unterstützten die Finanzverwaltung der Königreiche. Versuchte oder tatsächliche Einflussnahmen der Kronen auf die Ernennung ihr genehmer Provinzmeister sind zu Beispiel aus Aragon, Kastilien und Frankreich bekannt.
Anke Napp
Quellen:
- H. de Curzon, La règle du Temple, Paris 1886. S. 80: URL.
Sekundärliteratur:
- E. Bellomo, The Templar Order in North-West Italy, Leiden 2007, S. 107.
- Ch. Vogel, Das Recht der Templer: ausgewählte Aspekte des Templerrechts unter besonderer Berücksichtigung der Statutenhandschriften aus Paris, Rom, Baltimore und Barcelona, Münster 2007, S. 240-245.
Prozess
Der Prozess wegen Häresie gegen den Templerorden als Institution und seine Mitglieder wurde 1307 mit dem Verhaftungsbefehl des französischen Königs eingeleitet. Geführt in mehreren Einzelverfahren in fast allen Ländern der westeuropäischen Christenheiten dauerte er mehrere Jahre an und wurde schließlich auf dem Konzil zu Vienne 1311–1312 verhandelt. Er endete ohne abschließende Urteilsverkündung mit der Aufhebung des Ordens durch päpstliche Verfügung. Der Prozess gilt bis heute als einer der größten Justizskandale und stellt das Fundament zahlreicher Mythen um den Templerorden dar.
Aufarbeitung des Prozesses / Edition der Akten
Die Prozessakten mit ihren Verhörprotokollen wurden erstmalig in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Pierre Dupuy, Bibliothekar an der an der königlichen Bibliothek in Paris und damit einer der höchsten Beamten der Krone, gesichtet. Sein Werk Traittez concernant l’Histoire de France, savoir la condamnation des Templiers, das Auszüge aus Verhörprotokollen und anderen Quellen enthielt, wurde mehrfach unter wechselnden Titeln neu herausgegeben: 1685, 1713 und 1751. 1813 erschien Raynouards Monumens historiques über den Templerprozess mit einem Überblick über die damals noch in den Archiven vorhandenen Quellen. 1841 publizierte Michelet die in Paris im Nationalarchiv befindlichen Protokolle aus den Verhören von 1307 und der päpstlichen Generalkommission gegen den Orden als Institution 1309–1311. 1887 folgte Schottmüllers Der Untergang des Templer-Ordens mit Edition der Protokolle aus einzelnen Provinzialkommissionen und dem Verfahren von Poitiers, 1907 Finkes Papsttum und Untergang des Templerordens mit weiteren Quellenmaterialen.
Einzelne Teile der von den genannten Forschern zugänglich gemachten Protokolle wurden unterdessen neu und nach wissenschaftlichen Maßstäben ediert, darunter die Akten der Provinzialkommissionen von Clermont (ed. Sève), Zypern (ed. Gilmour-Bryson), England (ed. Nicholson), und die Protokolle der Generalkommission in Paris (ed. Satora). Eine moderne Edition der auf der iberischen Halbinsel und in Italien entstandenen Prozessdokumente ist ebenso desiderat wie eine Komplettedition aller noch erhaltenen Aktenstücke zum Prozess.
Fundierte Darstellungen zu den Verfahren in einzelnen Ländern und/oder dem gesamten Prozess sind unter anderem: Malcom Barber The Trial of the Templars, 1978; Alan J. Forey The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, 2001; H. Nicholson The Knights Templar on Trial. The Trial oft he Templars in the British Isles, 2009; Alain Demurger Die Verfolgung der Templer. Chronik einer Vernichtung, 2017.
Vorgeschichte
Unspezifische inkriminierende Gerüchte über den Templerorden scheinen bereits vor dem Prozess in Umlauf gewesen zu sein. Ein Brief des aragonesischen Gesandten an der damals in Poitiers residierenden Kurie erzählt von „Maulwürfen“, die der König von Frankreich, bzw. seine Berater, in den Templerorden eingeschleust hätten. Außerdem scheinen aus dem Orden ausgeschlossene ehemalige Brüder als Zeugen der Anklage benutzt worden zu sein, wie ein Verteidigungsschreiben der Templer von 1310 nahelegt. Unter den Anklägern, die bei König Philippe IV. vorstellig geworden waren, befand sich auch ein Mann namens Esquieu de Floyran. Er stellt sich 1308 in einem Brief an den König von Aragon als derjenige vor, der die „Templersache“ ins Rollen gebracht habe. 1309 nennt ein von dem Templer Ponsard de Gizy den päpstlichen Kommissaren übergebenes Schriftstück weitere „Verleumder des Ordens“: Bernard Pelet, Prior von Mas d’Agen, den Ritter Gérard Boyzol und einen Mönch namens Guillaume Robert. Letzterer konnte als Bruder der Abtei Sant-Martin de Bergerac identifiziert werden. Drei dieser Personen stammten aus dem Grenzgebiet des französischen Aquitanien zur englischen Guyenne.
Papst Clemens V. berichtet 1307 in einem Schreiben, dass er bereits bei der Papstkrönung in Lyon am 14. November 1305 durch den französischen König Philippe IV. von Gerüchten in Kenntnis gesetzt worden sei. Philippe IV. erwähnt die diesbezügliche Unterredung mit dem künftigen Papst in einem Brief an den König von Aragon vom 16. Oktober 1307.
Erste Verfahren in Frankreich
Erstes Verfahren
Der Prozess gegen die Templer nahm seinen Anfang im Königreich Frankreich. Der französische König, Philippe IV., hatte die Verhaftung der Templer in seinem Reich in Übereinstimmung mit seinem Rat am 14. September 1307 beschlossen. Zwei Schriftstücke wurden an alle Vasallen und Beamten des Königreichs gesandt: ein Arrestationsbefehl auf Latein mit den Anklagepunkten, begleitet von einer genauen Anordnung des Vorgehens. König Philippe IV. erklärte hierin, durch die Gerüchte habe er sich gezwungen gesehen zu reagieren. Das Schreiben spricht von einem „vehementen Verdacht der Häresie“. Die Erklärung des vehementen Verdachtes und die damit ausgesprochene Infamie rechtfertigte seit dem 13. Jahrhundert die Eröffnung eines kanonischen Verfahrens. Das so veröffentlichte Faktum der Infamie („publica fama“) beinhaltete gleichzeitig die Exkommunikation des Beschuldigten. Damit schuf der König ein Präjudiz noch vor der eigentlichen Prozesseröffnung.
Informiert war auch Guillaume de Paris, königlicher Beichtvater und Inquisitor: Er sandte am 22. September 1307 einen Brief an seine Ordensbrüder in Frankreich, sie bei den kommenden Verhören zu unterstützen.
Das Datum der geplanten Überraschungsaktion gegen die Templer wird in den überlieferten Handschriften nicht genannt. Am 13. Oktober wurde der Befehl umgesetzt und (fast alle) Templer im französischen Herrschaftsgebiet verhaftet. Gleichzeitig wurden noch im Beisein von (einigen) Templern die Besitzungen der Niederlassungen inventarisiert. Wie vielen die Flucht glückte, ist nicht bekannt. In den erhaltenen Quellen sind einige Namen verzeichnet, andere Brüder wurden später noch aufgegriffen.
Gegen die Privilegien des Ordens und auch gegen das Kirchenrecht verstoßend, fanden die ersten Verhöre der Ordensbrüder vor und durch Beamte des Königs statt. Die Anwendung der Folter bis zum Bekenntnis wenigstens der Hauptanklagepunkte war ausdrücklich in den Anweisungen des Arrestationsbefehls befohlen.
Gleichzeitig – noch vor den Verhören – startete König Philippe eine Rechtfertigungskampagne, die sein Vorgehen rechtlich und theologisch untermauern sollte, und führte die Diffamierungskampagne gegen den Orden fort Der Chronist Guillaume de Nangis berichtet:
„Et haec omnia (=die Anklagepunkte gingen voraus) de quibus vehementer habebantur suspecti, fecit rex Franciae dominica sequenti, in [Lücke im Text] regalis palatii, coram clero et populo palam et publice proclamari. (Und all diese Dinge, derer sie höchst verdächtig waren, ließ der König von Frankreich am folgenden Sonntag im […] des königlichen Palastes vor Klerus und Volk öffentlich verkünden)“ (ed. Géraud, S. 361)
Zweites Verfahren
In einem zweiten, nicht immer klar vom ersten getrennten Verfahrensgang, wurde ab dem 19. Oktober 1307 die Inquisition hinzugezogen, deren Vertreter dann gemeinsam mit den Beamten des Königs bei der Protokollaufnahme anwesend waren. Die 138 Gefangenen im Temple von Paris gestanden mit Ausnahme von fünf Brüdern die ihnen vorgeworfenen Verbrechen. Am 24. Oktober fand das erste Verhör des Meisters Jacques de Molay durch den dominikanischen Inquisitor Guillaume Imbert in Paris statt. Zwei zeitgenössische Briefe – darunter ein Schreiben eines dominikanischen Lehrers an der Pariser Universität – berichten davon, dass Jacques getrennt von seinen Brüdern gefangen gehalten und auch gefoltert wurde.
Aus diesen ersten beiden Verfahren sind Protokolle aus Beaucaire, Bigorre, Caen (ed. Field), Cahors, Carcassonne (ed. Nicolotti) und Nîmes, sowie aus Paris (ed. Michelet) erhalten. Im Fall von Caen existieren sogar eine französische und eine lateinische Fassung der Protokolle – beide formell ausgefertigt –, die signifikante Unterschiede aufweisen. Nur die französische Version enthält die Androhung von Strafen bei weiterer Behauptung der Unschuld, woraufhin ein Geständnis erfolgt sei. Bei der bloßen Androhung blieb es nicht immer: Im Fall des Zeugen Guy Panaye, verhört in Caen, ist die Folter im Protokoll vermerkt. Die lateinische Version wurde dem Anschein nach im Hinblick auf ein künftiges Inquistionsgericht ausgefertigt (Field, S. 311ff).
Während dieser ersten beiden Verfahren wurde eine Verfahrensweise angewendet, die noch nicht genau definiert war und die später „summarisches Verfahren“ genannt werden sollte. In diesem waren die Rechte des Angeklagten im Vergleich zu traditionellen Prozessformen stark eingeschränkt. Die noch existierenden Protokolle aus dem zweiten Verfahren des Templerprozesses weisen starke Parallelen zwischen den einzelnen Geständnissen auf, jedoch nur im Rahmen einer lokalen Protokollserie. Ursache dieser Parallelen ist die Praxis der Verhörführung und die Formalisierung der Protokolle. Auffällig ist, dass in diesen Verfahren das Protokoll des zuerst vernommenen und geständige Zeugen als Leitprotokoll verwendet wurde: es ist besonders ausführlich. Nachfolgend verhörte Zeugen werden oft nur noch mit „sagte das Gleiche aus“ vermerkt.
Am 25. und 26. Oktober bestätigten Jacques de Molay und andere Brüder ihre abgelegten Geständnisse vor Guillaume Imbert und einem einberufenen Gremium aus Theologen und Juristen der Universität von Paris. Guillaume de Nangis berichtet, Jacques habe sogar ein Schreiben verfasst, mit dem er alle Templer aufforderte zu gestehen. Möglicherweise wollte der Ordensmeister seine Mitbrüder vor weiterer Folter schützen, darauf vertrauend, dass der Papst das unrechtmäßige Verfahren für null und nichtig erklären würde.
Am 27. Oktober 1307 protestierte Papst Clemens bei Philippe IV. gegen die Verhaftung der Templer, die angewandte Folter und die Einziehung der Güter. Um die Angelegenheit erneut in die Verfügungsgewalt der Kirche zu stellen, veröffentlichte er am 22. November die Bulle Pastoralis Praeeminentiae. Sie ordnete die Verhaftung der Templer nunmehr in allen Ländern der Christenheit und ein Verfahren gemäß der kirchenrechtlichen Bestimmungen an. Der Papst sandte zwei Kardinäle nach Paris, damit sie das Verfahren neu aufrollten. Vor ihnen widerriefen sowohl Jacques de Molay, als auch die übrigen Großwürdenträger – Hugues de Pairaud, Visitator von Frankreich; Geoffroi de Charny, Provinzmeister der Normandie und Godefrois de Gonneville, Provinzmeister von Aquitanien/Poitou – ihre vorigen Geständnisse. In einem späteren Protokoll eines verhörten Templers heißt es, Jacques de Molay habe auch die anderen bis dahin geständigen Brüder zum Widerruf aufgefordert (ed. Schottmüller 2, S. 37).
Zu Beginn des Jahres 1308 suspendierte Papst Clemens die Gewalt der Inquisitoren in der Templerangelegenheit, aufgrund ihres voreiligen Eingreifens. König Philippe versuchte daraufhin, sein Handeln von den Doktoren der Pariser Universität theologisch rechtfertigen zu lassen. Eine Reihe von Fragen erörtert die Möglichkeit des Königs, kraft der ihm übertragenen Amtsgewalt auch ohne Befehl der Kirche gegen Häretiker vorgehen zu dürfen, falls deren bereits erfolgte Geständnisse ihre Schuld erweisen. Auch in Betracht gezogen ist die Internationalität der vorgeblichen Ketzergruppe: So wurde etwa die Frage aufgeworfen, ob der König tätig werden dürfe, ehe belastendes Material aus allen Ländern vorliegt, in denen sich Templerniederlassungen befinden? Diskutiert wurde zudem, ob die gestandenen Verbrechen die Angeklagten per se außerhalb der Kirche und ihrer von der Kirche gewährten Privilegien positionierten (eine Ipse facto-Exkommunikation), und was mit den Besitzungen des Ordens geschehen sollte. Sollten sie an die Kirche oder an die jeweiligen Landesherrn zurückfallen? (frz. übers. Lizerand, S. 63–66)
Das Gutachtergremium der Universität antwortete, dass der König keinesfalls ohne kirchliche Autorisation tätig werden dürfe, da die Templer ein dem Papst unterstehender Orden seien. Und ob sie Ketzer seien, habe allein die Kirche zu entscheiden. Auch die Güter müssten im Einklang mit ihrem von den Stiftern jeweils vorgesehenen Zweck verwendet werden (frz. übers. Lizerand, S. 66–70).
Daraufhin berief Philippe IV. – auf die Unterstützung des Bürgertums bauend – die Generalstände nach Tours (zusammengesetzt aus Vertretern des Adels, Klerus und der Städte) ein. Auch diese Einberufung wurde von einer Propagandakampagne begleitet, mit der die Öffentlichkeit instrumentalisiert werden sollte. Zwei Schriften aus dem königlichen Umkreis gegen Clemens V., meist Pierre Dubois zugeschrieben, sind erhalten (frz. übers. Lizerand, S 79–88). Die sogenannte Ermahnung des französischen Volkes inszeniert sich als Mahnschrift der besonders gläubigen und kirchentreuen Franzosen, die der König dem Papst überbringen solle. Sie fordert ein hartes Durchgreifen der Kirche gegen die Templer. Deren Geständnisse hätten klar ihre Schuld erwiesen. Daher könne das Volk keinen Grund erkennen, warum der Papst nicht für Recht und Ordnung sorge, außer dass es ihm nur um Geld und die Vergabe von Pfründen an seine Familie ginge. Der Papst dürfe nicht wagen, Gott und das so treue Volk der Franzosen mit schlechter Amtsführung und Nepotismus weiterhin zu beleidigen. Die hier verurteilte Simonie (=Verschachern geistlicher Ämter) hatte theologisch und kirchenrechtlich den Status einer schweren Sünde und galt seit dem 11. Jahrhundert ebenfalls als Häresie.
Der zweite Text, die Bitte des französischen Volkes, ist noch schärfer gefasst. Diesmal wird klar formuliert, dass die Templer sich durch ihre Verbrechen selbst aus der Kirche ausgeschlossen hätten, ja sogar schlimmer als Ketzer seien und daher nicht als solche behandelt werden könnten: „[…] istis qui non debent dici heretici, immo omnino a potestate extra ecclesiam positi“. Die Templer seien sämtlich Mörder und Gehilfen von Mördern: „Nonne isti templarii omnes sunt homicide vel homicidiorum fautores?“ Ob hier auf eine Komplizenschaft mit den Muslimen zum Schaden der Christenheit abgezielt wird oder einen geistigen Mord durch ketzerische Umtriebe, ist nicht völlig klar. Deutlich ist jedoch der Anspruch, den König als obersten Hüter von Gesetz und Ordnung darzustellen. Beispiele aus dem Neuen und Alten Testament werden als göttliche Rechtsgrundlage angeführt: So habe Moses die Anbeter des Goldenen Kalbs töten lassen, ohne zuvor die Erlaubnis des Priesters Aaron einzuholen. Warum also, fragt das Schreiben, solle nicht auch der allerchristlichste Fürst notfalls gegen den gesamten Klerus vorgehen können, falls dieser in Irrlehren verfallen sei oder diese unterstütze? Damit quasi selbst mit einer Anklage wegen Unterstützung der Häresie bedroht, stimmte der Papst am 29. Mai 1308 Verhandlungen mit Philippe IV. zu.
Drittes Verfahren (Poitiers)
Vom 28. 6. bis zum 1. 7. 1308 fand das dritte Verfahren des Templerprozesses statt. Hierbei wurden 72 durch die Beamten des Königs ausgewählte Templer aus dem ganzen Königreich dem Papst und einer Kardinalskommission vorgeführt. Die Mitglieder dieser Kommission – Pierre, Bischof von Penestrina, Bérengar Frédol, Bischof von Beziers, sowie Thomas de Sainte Sabine, Etienne de Suisy, Landulph und Pietro Colonna – saßen den Verhören getrennt vor.
40 Protokolle sind überliefert (ed. Schottmüller und Finke). Sie enthalten die Geständnisse von 21 Servienten (unter ihnen drei Komture), 12 Rittern (unter ihnen acht Komture), und vier bereits aus dem Orden ausgestoßenen ehemaligen Templern, unter ihnen ein Priester. Bei vier Protokolleditionen fehlt der Status des Zeugen. Im Textvergleich bieten die Geständnisse kein homogenes Bild, da sich die Zeugen an ihren früheren, vor den Beamten des Königs und/oder der Inquisition abgelegten Geständnissen orientierten oder doch zu orientieren versuchten. In den Fällen, wo jene noch erhalten sind, sind diese Übereinstimmungen festzustellen. Denn nur wenn die Zeugen ihre früheren Geständnisse wiederholten, wurde die auf ihnen lastende Exkommunikation aufgehoben. Der Meister und die Würdenträger wurden in der Burg von Chinon eingekerkert und im August desselben Jahres ebenfalls durch die Kardinäle befragt.
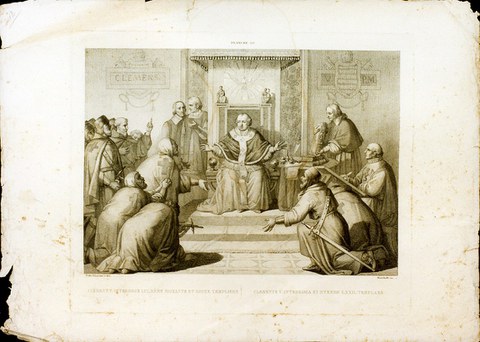
Eine Szene, die nie stattfand: „Papst Clemens verhört die 72 Templer“. D. MARCHETTI / T. DE VIVO: Cle-mente V interroga ei stesso LXXII templari, 1. Hälfte 19. Jahrhunderts.
Am 5. Juli erließ Papst Clemens die Bulle Subit assidue, mit der ein kanonischer Prozess, bestehend aus zwei weiteren Verfahren, gegen die Templer eingeleitet wurde. Erzbischöfe und Bischöfe der einzelnen Kirchenprovinzen sollten auf Provinzialkonzilien (Synoden) gegen die einzelnen Personen des Ordens vorgehen. Die Untersuchung gegen den Orden als Organisation wurde einer päpstlichen Kommission übergeben. Die Bulle Faciens misericordiam, veröffentlicht am 12. August 1308, enthielt eine detaillierte Liste mit neuen Anklageartikeln und exakte Anweisungen für die Arbeit der Diözesankommissionen. Am selben Tag berief Clemens V. mit der Bulle Regnans in Caelis für das Jahr 1310 ein allgemeines Konzil nach Vienne ein. Außerdem verfügte der Papst hinsichtlich der Immobilien der Templer, dass sie aus königlicher Hand in die Verwaltung der Bischöfe und Erzbischöfe übertragen werden sollten. Die Umsetzung dieser Anordnung dauerte Monate.
Diözesankommissionen in Frankreich
Auch in Frankreich konstituierten sich, wie in anderen europäischen Ländern, Provinzialkommissionen um über die Mitglieder des Templerordens zu befinden. Ihre Tätigkeit kann fast nur aus den Akten der Generalkommission erschlossen werden, wo die Zeugen ihre vorherigen Aussagen vor den entsprechenden Provinzialkommission erwähnen.
Aus der Feder des Bischofs von Paris sind detaillierte Anweisungen erhalten, wie mit den verschiedenen Gruppen der gefangenen Templer umzugehen sei: mit Leugnern, Geständigen und jenen, die ihre ersten Geständnisse unterdessen widerrufen hatten. Erste und Letztere sollten verschärfte Haftbedingungen erhalten: Einzelhaft, nur Wasser und Brot, außer bei Krankheit. Natürlich erhielten sie als nach wie vor Exkommunizierte auch keinen Zugang zu den Sakramenten. Leugneten sie weiterhin, bzw. blieben bei ihrem Widerruf, sollte die Folter eingesetzt werden (ed. Port, Guillaume Le Maire, S. 262ff). Ob diese Anweisungen Vorbildwirkung hatten, ist unbekannt.
Verhörprotokolle haben sich nur von der Kommission in Clermont und Nîmes erhalten. In Clermont wurden im Juni 1309 69 Templer verhört; 40 waren geständig, 29 leugneten. Die Verhöre in Nîmes fanden sehr spät, erst im August 1310 bis August 1311 in Alès statt. 32 Ordensbrüder wurden vernommen, von denen 29 ihre 1307 abgelegten Geständnisse widerriefen.
Die Prozessakten der Grafschaft Provence (Territorium gehörte zum Königreich Neapel) waren bisher unauffindbar. Bekannt ist nur, dass 1308 27 Templer aus Aix und Grasse in Mayronicis eingekerkert waren, und 32 weitere aus Arles, Marseille, Avignon und Nizza in Pertuis.
Kommission gegen den Orden als Institution in Paris
Die Kommission in Paris hatte aufgrund ihres Standortes besondere Wichtigkeit. Von ihrer Tätigkeit haben sich auch die meisten und vollständigsten Akten erhalten (ed. Satora 2020). Die Zeugen wurden entsprechend einer neuen Liste von 128 Anklagepunkten befragt, die darauf abzielten, die Verbreitung und die Dauer der vorgeblichen Häresie genauer zu fassen. Die Vorsitzenden der Kommission waren
- Gilles Aycelin, Erzbischof von Narbonne,
- Guillaume Durant, Bischof von Mende,
- Raynald de Laporte, Bischof von Limoges,
- Guillaume de Trie, Bischof von Bayeux,
- Matthäus von Neapel, Apostolischer Notar,
- Johannes von Mantua, Erzdiakon von Trient,
- Jean de Montlaur, Erzdiakon von Maguelonne,
- Guillaume Agarni, Probst des Domkapitels von Aix-en-Provence.
Nicht allein die Templer, sondern alle Personen, die eine Aussage machen wollten, wurden durch öffentliche Zitation vor die päpstliche Kommission geladen. Zum ersten Mal war auch eine Verteidigung eingefordert. Die verteidigungsbereiten Templer sollten „unverzüglich“ unter Bewachung nach Paris gebracht werden. Die Kommissare der Provinzialkommissionen sollten die bisher zusammen getragenen Aussagen ebenfalls nach Paris schicken.
Die Einberufungsbullen werden jedoch erst im Frühjahr 1309 versandt. Aufgrund von Kompetenzstreitigkeiten und der verspäteten Bekanntmachung der Vorladung an die Templer selbst konnte die Kommission erst Ende November 1309 mit ihrer Arbeit beginnen. Die ersten Ordensbrüder und ehemaligen Templer wurden vorgeführt. Am 26. November fand das erste Verhör von Jacques de Molay vor der Kommission statt. Er erklärte sich bereit, den Orden zu verteidigen und bat um die notwendigen Mittel für diese Verteidigung. Zwei Tage später fand das zweite Verhör des Meisters statt. Diesmal bat er die Kommissare, ihn mit dem Papst selbst sprechen zu lassen, was ihm jedoch nicht gestattet wurde.
Im Februar 1310 nahm die Kommission ihre Arbeit wieder auf, allerdings trafen die vorgeladenen Templer nur schleppend ein. Bis Mai 1310 erreichten schließlich über 650 verteidigungsbereite Templer aus den Ordensprovinzen des heutigen Frankreich Paris (Liste bei Demurger, Chronik, S.192f). Sie wurden zu einem Großteil in kirchlichen Liegenschaften inhaftiert, oft aber von königlichen Beamten bewacht und aus Erträgen der Besitzungen des Ordens unterhalten.
Am 2. März wurde Jacques de Molay zum dritten Mal vor das Tribunal geführt, beharrte jedoch darauf, nur mit dem Papst sprechen zu wollen. Am 28. März erklärten sich die im Garten des bischöflichen Palais in Paris versammelten verteidigungswilligen Templer erneut bereit, auszusagen. Auch reichten sie die ersten Beschwerden über ihre Behandlung und den Prozessverlauf ein. Die Kommission entschied, dass die Templer Vertreter wählen sollten. Sie ernannten Pietro di Bologna (=Pietro de Rotis), früher Prokurator des Templerordens beim Heiligen Stuhl, Rainald de Provins, Komtur von Orleans, sowie die Ritterbrüder Guillaume de Chambonnet und Bertrand de Sartiges. Diese Brüder erhielten die Freiheit, die Verteidigung zu organisieren, die Gefangenen zu besuchen und sie vor der päpstlichen Kommission zu vertreten. Am 10. Mai 1310 verurteilte Philippe de Marigny, Erzbischof von Sens und Vorsitzender der Diözesankommission, unter deren Jurisdiktion das Bistum Paris und die dort weilenden Templer fielen, 54 der verteidigungswilligen Ordensbrüder zum Scheiterhaufen. Die Begründung lautete, sie seien rückfällige Ketzer – eine Lesart, die jedoch selbst für einen erfahrenen Inquisitor wie Bernard Guy umstritten war. Der eingelegte Protest der Kommissare der Generalkommission bleibt wirkungslos. Am 12. Mai erleiden die 54 Verteidiger den Feuertod.
Weitere Hinrichtungen in Frankreich folgten; die Verteidigung brach zusammen. Die Generalkommission war durch mangelnde Kompetenzklärung – es gab keine Regelung, die die Generalkommission über die der Diözesen und Erzdiözesen stellte – nicht in der Lage, ihren Zeugen wirksamen Schutz zu bieten. Sie war damit an der ordnungsgemäßen Fortführung ihrer Tätigkeit gehindert und suspendierte ihre Sitzungen am 30. Mai. Im Dezember des gleichen Jahres nahm die Generalkommission ihre Tätigkeit wieder auf. Zur Verteidigung des Ordens fand sich kein Templer mehr bereit. Darüber hinaus befahl Papst Clemens am 18. März 1311 allen kirchlichen und weltlichen Fürsten eine strengere Anwendung der Folter, um die noch nicht geständigen Templer zum Geständnis zu bewegen. Viele der früheren Entlastungszeugen bekannten nun zumindest einige der Vorwürfe aus den Anklageartikeln.
Der Großteil der durch die päpstliche Kommission aufgenommenen Protokolle datiert aus dieser letzten Sitzungsperiode bis Mai 1311. Die Protokolle sind sehr kurz, enthalten selten mehr als die Antwort zu den Hauptanklageartikeln anstatt des kompletten Fragekatalogs mit 128 Punkten. Die Parallelen, die man bei der Prüfung der Protokolle zwischen den Aussagen entdecken kann, resultieren daraus, dass die gemeinsam nach Paris überführten und gefangengehaltenen Zeugen sich an früheren Aussagen vor ihren jeweiligen Diözesankommissionen orientierten. So kann man Ähnlichkeiten zwischen im Limousin verhörten Templern entdecken, auch wenn jene von ganz verschiedenen Persönlichkeiten in den Orden aufgenommen wurden, wohingegen die Prüfung der Ordensaufnahmen durch eine bestimmte Person – die natürlich nicht nur im Limousin stattfanden – eine große Bandbreite aufweisen. Ein vereinheitlichender Faktor war weiterhin die Formalisierung der Protokolle. Heute existieren noch 193 von ihnen. Es sind die Aussagen von 177 Servienten, unter ihnen eine große Anzahl Komture, 16 Rittern und 20 Priestern.
Die Verfahren außerhalb Frankreichs
In den übrigen Ländern Europas wurden die beiden Verfahren (gegen die Einzelpersonen und den Orden als Institution) zum Teil von denselben Kommissionen und in enger zeitlicher Abfolge geführt. Die Protokolle sind nicht komplett erhalten.
Flandern
Der Prozess in der zum größten Teil unter französischer Lehnshoheit stehenden Grafschaft Flandern wurde durch die von Philippe IV. und Inquisitor Guillaume Imbert im September 1307 abgesandten Briefe eingeleitet. Zuständig für die flandrischen Gebiete war der königliche Bailli von Amiens. Zunächst scheint Graf Robert de Béthune Widerstand geleistet zu haben, denn am 13. November 1307 folgte ein weiterer Brief des Königs von Frankreich, die Templer der Grafschaft der Jurisdiktion des Bailli von Amiens zu überstellen. Wie auch in anderen Ländern wurden die Güter beschlagnahmt. Während der Generalstände in Tours sprachen sich der Graf von Flandern und sein ältester Sohn, Graf von Nevers und Rethel, für entschiedene Maßnahmen gegen die Templer aus (ob unter politischem Druck nach den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Philippe IV. mit Flandern, kann spekuliert werden. Denn die Beziehungen der Templer zur Grafenfamilie waren stets eng gewesen). Über die Arbeit der Diözesankommissionen in Flandern ist nichts bekannt. Einige flämische Ordensbrüder wurden vor die Generalkommission in Paris gesandt, darunter der damalige Provinzmeister Goswin de Brugis (von Brügge). Sie erklärten, den Orden verteidigen zu wollen.
Patrimonium Petri, Abruzzen, Spoleto
Mehrere Kommissionen amtierten auf dem Gebiet des heutigen Italien, das verschiedenen Herrschern unterstand:
- dem Heiligen Römischen Reich (Lombardei und Toskana)
- dem Papst (Patrimonium Petri und Spoleto),
- Charles II. d’Anjou (Königreich Neapel),
- Alfonso IV., König von Aragon (Sizilien).
Die Kommission für das Patrimonium Petri und das Herzogtum Spoleto stand unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Sutri.
Das Verfahren dieser Kommission „contra ordinem militie Templi et magnum preceptorem dicti ordinis“ nach den 127 Anklageartikeln (ed. Gilmour-Bryson) begann Oktober 1309 in Rom, im Kloster S. Bonifacio ed Alessio. Im Dezember 1309 wurden zwei Boten in das päpstliche Gefängnis von Viterbo gesendet, in welchem fünf Templer einsaßen (ein Priester und vier Servienten). Die Gefangenen lehnten jedwede Aussage vor der Kommission ab. Im Laufe des April 1310 transferierte die Kommissionsleitung ihren Sitz nach Aquila. Dort verhörte sie elf Nicht-Ordensangehörige. Ende April wurde ein alter Templer in Penna befragt (ed. Gilmour-Bryson, S. 129ff), der die Hauptanklagepunkte gestand, darunter die Anbetung eines Idols in Form eines aufrechtstehenden Knaben, der „Gesundheit, Geld, Pferde und Liebe Gottes“ versorgen könne. Das Protokoll eines weiteren geständigen Templers stammt aus Chieti (ed. Gilmour-Bryson, S. 145ff).
Im Mai 1310 wurden erneut Boten nach Viterbo gesandt. Nun erklärten sich die vier noch lebenden Zeugen zur Aussage bereit. Sie bekannten verschiedene Verbrechen, darunter die Verunehrung des Kreuzes, unzüchtige Küsse und Anbetung eines verschieden beschriebenen Idols (ed. Gilmour-Bryson, S. 169ff). Die Zeugen orientieren sich dabei an den ausführlichen Vorgaben des Fragenkataloges mit den Anklagepunkten. Ende Juli wurde noch ein anderer Templer in Palombara vernommen, der die Verleugnung Christi, unzüchtige Küsse und Götzenanbetung gestand. Einige externe Zeugen sagten vor der Kommission in Segni und Velletri scheinbar zugunsten des Ordens aus.
Lombardei, Toskana, Romagna,
Die Kommission für die Lombardei und die Toskana formierte sich unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Pisa, des Bischofs von Florenz und eines Kanonikers aus Verona; die Kommission für die Romagna unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Ravenna. Ein Brief der lombardisch/toskanischen Kommission aus dem Jahr 1311 erwähnt nur 13 in der gesamten Region inhaftierte Templer.
Der erste Verfahrensgang fand 1310 in Florenz statt und erbrachte keinerlei Resultate. Nach dem Befehl des Papstes, die Folter strenger anzuwenden, fand 1311 das zweite Verfahren statt. Aber auch jetzt machten lediglich sechs der Templer teilweise belastende Geständnisse, die im noch existierenden Protokoll niedergelegt sind. Allein diese sechs Geständnisse wurden zur Synode gesandt, nicht die entlastenden Aussagen. Das Verfahren in der Romagna begann erst im November 1310 mit der Befragung zweier Templer in Cesena durch den Erzbischof von Ravenna, Rinaldo da Concorezzo.
Im Januar 1311 wurde in Ravenna die Diözesankommission eröffnet. Mitte Juni 1311 vernahm Erzbischof Da Concorezzo sieben Templer aus Piacenza, unter ihnen der Komtur von Piacenza, Raimondo Fontana, und der Komtur von Cabriolo, Giacomo Fontana, fünf Templer aus Bologna, unter ihnen ein Provinzmeister, einen Bruder aus Faenza, sowie 19 nicht dem Orden angehörige Zeugen. Alle Templer leugneten die vorgeworfenen Verbrechen. Der Erzbischof fragte bei der Synode nach, ob die Templer gefoltert werden sollten, um Geständnisse zu erlangen. Man sprach sich dagegen aus und für die Unschuld der Templer – mit Ausnahme der anwesenden Dominikaner. Die Templer, meinten die Konzilsteilnehmer, sollten sich vielmehr von den Anklagen mittels einer „Purgatio Canonica“ reinigen. Die unschuldigen Brüder sollten absolviert und die Schuldigen gemäß dem kanonischen Recht bestraft werden.
Einzigartig für den gesamten Prozess gegen die Templer war folgende Tatsache: die Kommission von Ravenna betrachtete jene, die aus Furcht vor der Folter gestanden und anschließend ihre Geständnisse zurückgenommen hatten als unschuldig, ebenso jene, bei denen offensichtlich war, dass sie nur aus Furcht vor erneuter Folter nicht ebenfalls widerriefen.
Die Protokolle der Kommission von Ravenna wurden zum Papst gesandt, die dem Erzbischof Da Concorezzo sofort die Anwendung der Folter befahl, welcher jener wohl „aus Nachlässigkeit unterlassen habe“. Dennoch führte Rinaldo da Concorezzo keine neue Untersuchung durch. Aus diesem Grund wurde er später von der den Templerorden betreffenden Kommission auf dem Konzil von Vienne ausgeschlossen. Die Protokolle der Kommission von Venedig sind verloren, aber es scheint, dass auch sie für die Templer günstig ausgefallen waren.
Königreich Neapel, Sizilien
Die Templer im Königreich Neapel und in der Grafschaft Provence, Territorien von Charles II. d’Anjou, wurden im Frühjahr 1308 nach dem Beispiel des französischen Kronlandes arrestiert. Im Königreich Neapel wurden die ersten Verhöre durch den Erzbischof von Brindisi durchgeführt, ohne dass Geständnisse abgelegt wurden. 1310 sandte der Papst drei Inquisitoren, um das Verfahren fortzuführen. Möglicherweise war die Vorladung nicht richtig veröffentlicht worden, denn nur zwei Servienten sagten vor der Kommission aus. Es lässt sich jedoch auch annehmen, dass die entlastenden Aussagen der Templer nicht niedergelegt wurden, wie dies in den meisten Ländern der Fall war. Die Kommission beendete ihre Arbeit im Grunde ohne Ergebnis. Noch Papst Johannes XXII. musste sich mit den in Neapel inhaftierten Templern beschäftigen.
Aragon, Katalonien, Leon, Kastilien, Navarra und Portugal
Im August 1308 wurden auch die Mitglieder der Kommissionen auf der iberischen Halbinsel (Spanien und Portugal) ernannt.
Portugal gilt in einiger (Populär-)Literatur als sicherer Hafen für die Templer, da König Dinis I. dem Orden eine Zuflucht geboten habe. Die Templer wurden aber auch hier im Einklang mit den päpstlichen Anweisungen verhaftet und das Verfahren gegen die Personen gemäß Faciens Misericordiam eröffnet. Der letzte Provinzmeister von Portugal wurde in Kastilien festgesetzt. Allerdings befanden sich die Templer wohl nicht in so strenger Haft wie in Frankreich. Gefoltert wurde ebenfalls nicht. Über etwaige diplomatische Bemühungen des Königs zugunsten der Templerbrüder gibt es keine Nachrichten. Im Gegensatz dazu erweisen einige Dokumente, dass Dinis I. die Gelegenheit nutzen wollte, um die Templergüter in königliche Gewalt zu bringen. Bereits vor der Verhaftung der französischen Templer leitete er im August 1307 ein Verfahren gegen den Orden ein – allerdings keines aufgrund von Häresievorwürfen. Er versuchte auf dem Wege rechtlicher Gutachten und Gerichtsverfahren zu beweisen, dass der Orden die ihm übertragenen Güter nur verwaltet habe, und dass die Übertragung nur solange gelte, wie die Templer tatkräftig bei der „Reconquista“ helfen würden. Da dies nun nicht mehr in dem Maße wie früher möglich und nötig war, argumentierte er, müssten die Besitzungen an die Krone zurückfallen. Die seitens der Templer angestrengte Verteidigung in diesem Prozess kam aufgrund der Entwicklung im großen Häresieprozess nicht zustande. 1309 gingen damit zunächst Besitzungen in Soure und Idanha verloren. Auch bei den Gesandtschaften an den Papst nach Aufhebung des Ordens scheint es im Wesentlichen um die Güterfrage gegangen zu sein.
Prozessprotokolle aus Portugal sind nicht erhalten. Der Bischof von Lissabon, João de Solhães, befragte in Orense 28 Templer und sechs Nicht-Ordensangehörige, die alle Anklagepunkte leugneten. Da er die Verhöre in seiner Eigenschaft als Suffragan von Santiago de Compostela vornahm, betrafen sie nur Ordensbrüder aus Kastilien und Leon, nicht wie in der älteren Forschung aufgrund von Campomanes (1747) angenommen, aus Portugal.
Vorsitzende der Provinzialkommission im Königreich Kastilien und Leon waren die Erzbischöfe von Toledo, Santiago de Compostela und Palencia. Wann die Templer dort verhaftet wurden, ist unbekannt. Der Komtur von Villalba beschwerte sich 1310 im Namen seiner Ordensbrüder, die Templer seien in Ketten und ständiger Gefahr für Leib und Leben durch die Willkür weltlicher Amtsleute („saecularibus vel laicalibus“) ausgesetzt. Die Brüder wagten nicht, ihren Aussagewillen vor der Kommission zu äußern, daher möge man Kommissare zu ihnen schicken, oder einen sicheren Ort bereitstellen (ed. Fita y Colomé, S. 87f).
Die Kommission unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Compostela befragte 30 Templer und drei externe Zeugen in Medina del Campo, ohne belastende Geständnisse zu erhalten. Im Juli 1310 berief der Erzbischof von Toledo ein Konzil ein, um über die Templerfrage zu entscheiden, jedoch sind keine Dokumente hierzu überliefert. Im Oktober 1310 sprach sich ein Konzil in Salamanca für die Unschuld des Ordens aus und rehabilitierte seine Mitglieder – überließ das letzte Urteil allerdings dem Papst (ed. Fita y Colomé, S. 65). Einzig in einem Fragment eines Protokolls, das die Aussagen von vier Nicht-Templern enthält, finden sich einige ungünstige Dinge über den Orden: So würden die Templer große Geheimhaltung bei der Ordensaufnahme üben; sie hätten Kreuze im Steigbügel angebracht zur Verunehrung des christlichen Glaubens. Ein weiterer Zeuge gibt zu Protokoll, von einigen Franziskanern gehört zu haben, wie ein Templerwürdenträger rasch ein verdächtiges Buch versteckte mit dem Hinweis, „wenn es bekannt würde, nähme der Orden Schaden“. Von anderen Bekannten am Königshof hatte der Zeuge vor etwa zwei Jahren – also nach der Verhaftung der Templer in Frankreich – gehört, dass König Alfons von Kastilien einen jungen Mann gezwungen habe, bei den Templern einzutreten, um „ihre Geheimnisse zu erfahren (ut sciret secretum ordinis Templariorum)“. Später habe dieser aus Angst, von den Templern enthauptet zu werden, erst unter Eid dem König geantwortet: Bei ihrer Ordensaufnahme würden die Templer Christus verleugnen, aufs Kreuz spucken, „Sodomie“ würde erlaubt und noch „viele andere üble Dinge“ spielten sich ab (ed. Fita y Colomé, S. 95-99). Dies ist die einzige belastende Aussage im Sinne der Anklage.
Das Königreich Navarra war durch Eheschließung der Kronerbin Juana I. mit dem damaligen französischen Kronprinzen und künftigen Philippe IV. mit der französischen Krone vereinigt. Daher wurden hier, unter der Regierung von Philippes Sohn Louis, die Templer wie in den französischen Kronlanden bereits 1307 inhaftiert. Da die dortigen Komtureien aber der Templerprovinz Aragon/Katalonien unterstanden, schickten die Ordensbrüder dieser Provinz einige Gesandte nach Navarra, die sich um die Aufklärung der Ereignisse bemühen sollten. Sie wurden ebenfalls festgesetzt. (ed. Finke II, S. 51f) Auf die Bitte des Provinzmeisters von Aragon/Katalonien gelang es dem König von Aragon, Jayme II., zumindest die Freilassung der aragonesischen Templer zu erwirken. Die weitere Entwicklung der Angelegenheit und das Schicksal der Brüder in Navarra sind unbekannt. Erhalten sind 1310 in Oleto protokollierte Aussagen von drei Templern, die die Vorwürfe leugneten (ed. Finke II, S. 378f).
Im Königreich Aragon begannen die Templer ihre Burgen in den Verteidigungszustand zu versetzen, nachdem die Krone sich nicht deutlich genug für einen Schutz des Ordens ausgesprochen hatte. Am 1. Dezember 1307 befahl Jayme II. seinerseits die Verhaftung der Ordensbrüder und die Einziehung ihrer Güter in seinen Territorien (Aragon, Katalonien und Valencia). Die Vorladung der Templer vor das Inquisitionstribunal blieb ohne Folgen. Der König ordnete daraufhin die Belagerung der Festungen des Ordens an. Die erste Burg, die fiel, war Peniscola, danach ereilte dieses Schicksal Burriana, Coves und einige andere kleine Burgen. Provinzmeister Ximèn de Lenda wurde ebenfalls festgesetzt. Die Korrespondenz des Königs zeigt, dass er von der Gelegenheit profitieren wollte, um sich der Burgen des Ordens zu bemächtigen.
Die Belagerten in den verbleibenden Festungen, in erster Linie der Stellvertreter des Provinzmeisters, Raimond de Guardia, versuchten zu Gunsten der Inhaftierten zu verhandeln, scheiterten jedoch. Ende Oktober 1308 ergab sich Miravet, im Mai 1309 Monzón und Chalamera, und im August Cantavieja. Die Templer wurden in Gardeny, Bellver und anderen ihrer eigenen Häuser inhaftiert. Im Herbst 1309 begannen die Provinzialkommissionen mit der Arbeit.
Zwischen November 1309 und Januar 1310 vernahm die in Saragossa tagende Kommission 33 Templer. Einige Nicht-Templer, Kleriker und Laien, wurden ebenfalls Ende des Jahres 1309 in Saragossa verhört. Im Februar 1310 sagten 32 Templer und im März neun externe Zeugen (darunter drei Franziskaner und drei Dominikaner) in Lleida aus (ed. Finke II, S. 364-378. Einige Zeugen geben „Verdachtsmomente“ zu Protokoll, wobei zum Teil eingeräumt wird, dass diese sich erst nach Beginn des Prozesses eingestellt hätten. Verdächtig war vielen die geheime Abhaltung von Kapiteln und Ordensaufnahmen bei den Templern.
Weitere Verhöre fanden in Cervera im Mai 2010 vor dem Bischof von Vich statt, und im September desselben Jahres wurden zwei Ordensbrüder sowie ein ehemaliger Templer und nunmehriges Mitglied der Zisterzienserabtei von Santas Creus in Tarragona befragt. Im Januar 1310 führte der Bischof von Elne in Troilas ein Verfahren gegen 25 Templer der Komturei von Mas-Dieu und ihren abhängigen Niederlassungen (18 Servienten, drei Ritter, unter ihnen Raimond de Guardia, und vier Kapläne). Insgesamt haben sich aus dem Königreich Aragon Verhörprotokolle von 71 Templern erhalten (darunter 20 Ritter, 46 Servienten und fünf Kapläne). Alle Aussagen fallen günstig für den Orden aus.
Bereits im März 1311 hatten die Kommissionen in Aragon und Katalonien ihre Arbeit beendet und die Protokolle dem Papst geschickt. Die Anordnung desselben, die bisher nicht eingesetzte Folter anzuwenden, traf einige Tage später ein. Auch wurde der König an seine Unterstützungspflicht gemahnt. Daraufhin wurden durch den Erzbischof von Tarragona und den Bischof von Valencia 24 ausgewählte Templer nach Barcelona überführt. Acht von ihnen wurden durch assistierende königliche Beamte gefoltert, zum Teil auch mehrfach, ohne dass ein belastendes Geständnis abgelegt wurde. Zu einer Fortführung des Verfahrens blieb keine Zeit, da die beiden Prälaten sich auf den Weg nach Vienne zum Konzil machen mussten. Die Aufgabe, Geständnisse zu erbringen, ging an den Bischof von Lleida über. Die dort festgehaltenen Aussagen sind jedoch nicht erhalten. Es scheint jedoch, dass es keine belastenden Geständnisse gab, denn letztlich wurden die Ordensbrüder im Königreich Aragon freigesprochen.
Wegen der unterdessen vom Papst verfügten Aufhebung des Ordens erhielten sie eine Pension aus den Einkünften der ehemaligen Ordensgüter, die die Johanniter ihnen zu zahlen hatten. 1331 gestattete ihnen Papst Johannes XXII., in andere monastische Orden einzutreten.
Im Königreich Aragon gelangten die Güter der Templer nach Aufhebung ihres Ordens nicht gänzlich, wie es ursprünglich der Wille des Papstes gewesen war, an die Johanniter. Nach langen Verhandlungen zwischen König und Papst wurde dem Monarchen zugestanden, auf seinem Herrschaftsgebiet einen neuen Orden gründen zu dürfen. Diesem sollten in der Provinz Valencia ein Großteil der ehemaligen Templergüter zugesprochen werden: der Orden von Montesa. In Katalonien erhielten die Johanniter die alten Templerbesitzungen. Das liturgische Gerät, was in den Templerhäusern gefunden und sofort sichergestellt worden war, wurde nach dem Prozess an die Niederlassungen anderer Orden verteilt – auch dies ist ein Zeichen dafür, dass die Templer nicht als häretisch und damit ihre liturgischen Gerätschaften auch nicht als bedenklich einstuft wurden.
England, Schottland und Irland
Nach der Verhaftung der Templer in Frankreich hatte Philippe IV. auch König Edward II. von England angeraten, die Templer in seinem Königreich arrestieren zu lassen. Dieser hielt die Häresievorwürfe aber für unglaubwürdig. Er verwies auf die von den Templern im Heiligen Land unternommenen Anstrengungen sowie ihre Dienste für die englische Krone. Im Dezember 1307 wandte sich Edward II. an die Könige von Kastilien, Aragon und Portugal sowie an den Papst (ed. Rymer, S. 101f) und äußerte Bedenken über die ungeheuerlichen Anschuldigungen. Nach der Promulgation von Pastoralis Praeeminentiae am 22. November 1307 war jedoch auch der englische Monarch zum Handeln verpflichtet. Am 15. Dezember gingen die ersten Befehle an die königlichen Amtsträger und die höchsten Beamten in Schottland und Irland, die die Verhaftung der Ordensbrüder vorbereiten mussten. Am 30. Dezember wurden die gesiegelten Briefe verschickt, wobei die Empfänger vor Öffnen der Befehle einen Eid leisten mussten, nichts verlauten zu lassen.
Im Januar 1308 ehelichte Edward II. die Tochter Philippes IV. von Frankreich. Im gleichen Monat wurden die Templer in den englischen Kronlanden schließlich verhaftet und ihre Güter inventarisiert. Allerdings, so hatte Edward II. in seinen Anweisungen verdeutlicht, sollten die Haftbedingungen milder als in Frankreich sein:
Et quod corpora dictorum Templariorum salvo, secure et honeste custodiantur, in loco competenti [...] dum tamen non sint in dura et vili prisona, donec Rex aliud inde duxerit ordinandum. (Und die Templer sollen unversehrt, sicher und ehrenhaft verwahrt werden, an geeigneten Orten […] so dass sie in keiner üblen und harten Haft sind, bis der König anderes befehlen mag. ed. Rymer, S. 101).
Ungefähr 150 Templer (, Nicholson 2009, S. 49) wurden in England festgenommen und meist in die jeweils nächstgelegene königliche Burg eskortiert. Die unterschiedlichen Schreibweisen der Namen und Benennungen in den Protokollen machen eine genaue Zählung der verhörten Ordensbrüder allerdings schwer. Unter den Verhafteten waren der Provinzmeister der Auvergne, Himbert Blanc, und der Provinzmeister von England, William de la More, die sich gerade für eine Ordensaufnahme in der Komturei von Ewell befanden. Beide beharrten bis zu ihrem Tode fest bei dem Bekenntnis der Unschuld. Zahlreiche Ordensbrüder, besonders die hochrangigen, blieben für Jahre im „offenen Vollzug“. Erst im November 1308 mahnte Edward II. – wohl unter päpstlichem Druck – seine Sheriffs, auf die sichere Verwahrung aller Templer, besonders des Provinzmeisters, zu achten. Der Unterhalt der Gefangenen wurde aus den in Beschlag genommenen Besitzungen des Ordens bezahlt. Einigen Templern gelang es, sich durch Flucht der Verhaftung für einige Zeit zu entziehen. Bis auf fünf Männer wurden aber alle ausfindig gemacht. Der Erzbischof von Canterbury verkündete die feierliche Exkommunikation gegen alle, die Templern auf der Flucht halfen oder sie beherbergten – schlussfolgernd ein häufig vorkommender Fall.
Erst im Oktober 1309 begannen die Provinzialkommissionen in York, Lincoln und London mit der Arbeit. Aus dem ganzen Königreich wurden die Gefangenen dorthin gesandt. Insgesamt sind vier Verhörprotokolle erhalten, davon eine vollständige Handschrift, ein Fragment und zwei summarische Zusammenfassungen derselben Verhöre (ed./übers. Nicholson 2011). Außer den Bischöfen von Chichester (John Langton) und Lincoln (John Dalderby) und dem Erzbischof von York (William of Greenfield) gehörten der Titularpatriarch von Jerusalem und Bischof von Durham (Anthony Bek), der französische Bischof von Orleans und zwei weitere aus Frankreich angereiste Inquisitoren, der Abt von Lagny und ein rechtsgelehrter Kanoniker aus Narbonne namens Sicard Vaur zu den Tribunalen.
Diverse Probleme behinderten ein Vorankommen des Prozesses oder sollten es absichtlich verhindern. Die englischen Prälaten zeigten sich wenig enthusiastisch, und zudem weigerte sich der König, Einkünfte aus den Templerländereien in seiner Verwaltung für die Deckung der Prozesskosten zur Verfügung zu stellen.
Am 23. Oktober wurden schließlich die ersten Templer-Zeugen in London vernommen. Bis zum 17. November waren 43 Templer vernommen worden. Keiner der Anklagepunkte wurde gestanden. Konfrontiert mit den Geständnissen aus Frankreich erklärten einige der englischen Ordensbrüder, sie seien erlogen. Mehrere Templer erklärten, sie würden eher sterben, als den infamierten Orden zu verlassen. Andere berichteten von Werken der Frömmigkeit im Orden.
Im Dezember 1309 gestattete der König auf Drängen der Inquisitoren die im englischen Recht nicht übliche Anwendung der Folter (ed. Rymer, S 165). Dennoch fand sich offenbar niemand, der die Anordnung auch umzusetzen bereit war, wie die Inquisitoren im Sommer 1310 beklagen. Unterdessen war ein verkürzter Katalog mit nur 25 Anklagepunkten entworfen worden. Er zielte darauf ab, die englischen Templer aufgrund der französischen Geständnisse zu inkriminieren, weil der Orden zentral regiert sei und für alle Brüder dieselben Regeln gelten würden (ed. Wilkins, S. 349f).
Zwischen März und Juni 1310 wurden Verhöre in Lincoln durchgeführt, von denen sich elf Protokolle erhalten haben. Auch diesmal bestanden die vernommenen Templer darauf, dass der Orden unschuldig und katholisch sei. Unter den Verhörten war auch Thomas Totty, der seinen Habit unter weltlichen Kleidern trug und auf der Flucht gewesen war. Auch er sprach sich für die Unschuld des Ordens aus, war aber letztlich so eingeschüchtert, dass er den Sheriff von Lincoln bestach und somit – ein zweites Mal – fliehen konnte! Parallel liefen die Verhöre in York, wohin die beiden päpstlichen Inquisitoren aufgebrochen waren. Hier wurden die Aussagen von 23 Templern aufgenommen, die ebenfalls auf ihrer und des Ordens Unschuld beharrten. Die einzig kirchenrechtlich problematischen Aussagen betrafen die Grauzone von Beichte und Schuldbekenntnis bei Verfehlungen gegen die Ordensregel. Hier hatten viele Templer keine kanonisch korrekte Ansicht.
Offenkundig verzweifelt ließen sich die Kommissare Geständnisse aus Frankreich kommen, die einige der englischen Templer belasteten, zum Beispiel Himbert Blanc, den Provinzmeister der Auvergne. Doch auch dies blieb ohne Erfolg. Vor dem Problem stehend, dass die Kommissare keine Geständnisse der vorgeworfenen Häresie erhielten, die Folter aber nicht durchzusetzen war, wandten sie sich vermehrt an Nicht-Ordensmitglieder, um von ihnen belastendes Material gegen die Templer zu sammeln. Die ersten externen Zeugen waren im Winter 1309 vernommen worden. Im April 1311 nahm die Kommission in England Aussagen von etwa 170 Laien und Mitgliedern der Bettelorden auf. Sie gaben zahlreiche Legenden und Gerüchte aus zweiter oder dritter Hand zum Besten, oft über lang Verstorbene, oder mit dem Hinweis, an Namen könnten sie sich nicht erinnern. Ein Franziskaner gab an, von einer Frau gehört zu haben, dass ein Bediensteter der Templer sich einst bei einer Kapitelsitzung im Raum verborgen und dabei einen ominösen kleinen Teufel gesehen habe. Auch andere Geschichten über das vorgebliche Idol tauchen in diesen Protokollen auf; ein Zeuge behauptet gar, die Templer beteten ein Götzenbild in Form eines Kalbes an. Eine Zeugin will von einem Bediensteten der Templer gehört haben, dass ein Ordensbruder, der sich weigerte, aufs Kreuz zu spucken, in einen Brunnen geworfen worden sei.
Auf welche Weise und nach welchem Muster die externen Zeugen ausgewählt wurden, oder ob einige von ihnen sogar Geld für belastende Aussagen erhielten, ist unklar. Möglich ist, dass die Franziskaner sich durch ihre eifrige Mitarbeit und Aussagen von Verdachtsmomenten befreien wollten, die gegen sie selbst vorlagen. Andere Zeugen mögen einfach die plötzliche „mediale Aufmerksamkeit“ genossen und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben.
Im Frühjahr 1311 wurden Templer aus London und Lincoln in London zusammengeführt, um das bisher gegen sie gesammelte Beweismaterial zu hören. Es handelte sich vermutlich um die Zusammenfassungen der bisherigen Geständnisse, die recht vage und frei mit den Aussagen umgehen. Als Folge dieser Anhörung stellten sich eine Anzahl Templer als formelle Verteidiger des Ordens zur Verfügung und gaben ein offizielles Glaubensbekenntnis ab (ed. Wilkins, S. 364f).
Erst im Juni und Juli erzielten die Kommissare in London drei Geständnisse (ed. Wilkins S. 383ff/Nicholson 2011, S. 397ff). Vermutlich war nun doch die Folter angewendet oder zumindest damit gedroht worden. Im Bericht über das Verfahren heißt es:
„etiam severas et crudeles personas laicas judicium sanguinis quandoque exercentes, ex certa scientia eis ad terrorem missas“ (auch strenge und grausame Laien, die im Scharfrichtergeschäft erfahren sind, wurden gesandt, um Schrecken einzuflößen, ed. Wilkins, 393).
Diese drei Geständnisse, darunter auch eines von dem offenkundig wieder aufgegriffenen Thomas Totty, sind die vermutlich einzigen Geständnisse des gesamten Prozesses in England.
Eine weitere, noch kürzere „Zusammenfassung“ aller Geständnisse wurde geschrieben und dabei die ursprünglichen Aussagen weiter entstellt. Vermutlich kam sie bei der Provinzialsynode in London zum Einsatz, die im Sommer 1311 tagte. Dort und wenig später auch auf der Synode in York bestätigten nach und nach mehrere Gruppen von Templern den allgemeinen Häresieverdacht („publica fama“) gegen ihren Orden, schworen global aller Häresie ab, erhielten die Absolution und wurden letztlich wieder in die Kirche aufgenommen. Das hatte unter den Prälaten eine Diskussion ausgelöst: Schließlich hatten die Templer nichts gestanden und waren nicht für schuldig erklärt worden – wofür wurden sie also absolviert?
Der Großteil der Templer wurde nach dem letzten Urteilsspruch in Klöster gesandt, nur die beiden Provinzmeister von England und der Auvergne blieben in Haft. William de la More starb 1312, Himbert Blanc nach 1313.
Irland gehörte zwar zu dieser Zeit zur englischen Krone, doch war die lokale Regierung relativ unabhängig. Edward II. hatte im Dezember 1307 den Befehl zur Inhaftierung der Templer an seinen Justiziar in Irland gesandt. Erst fast vier Wochen später erreichte das Schreiben seinen Adressaten und die Templer wurden am 3. Februar 1308 verhaftet. Die Güter wurden konfisziert und wie in anderen Ländern Inventare erstellt. Wie es scheint, wurden alle Ordensbrüder in Dublin festgehalten, wo die Provinzialsynode tagte. Die vom Papst entsandten Inquisitoren kamen im Herbst 1309 in England an, reisten aber nicht selbst nach Irland weiter, sondern benannten Stellvertreter. Die Verhöre begannen erst im Januar 1310 in der Kathedrale Sankt Patrick und dauerten bis Juni desselben Jahres. 15 Aussagen sind die einzigen, deren Protokolle erhalten sind (ed./übers. Nicholson 2011, S. 365). Aus einer Abrechnung des Royal Exchequer ist bekannt, dass zumindest 19 Templer eine Pension erhielten. Einige wurden also nicht verhört, die Aussagen nicht festgehalten, oder die Protokolle sind verloren. Unter diesen Templern war auch William de Warenne, Provinzmeister 1302–1308. Warenne war 1312 noch am Leben und hätte also als Zeuge gehört werden können. Möglicherweise hatte ihn die Verwandtschaft zum stellvertretenden Justitiar vor der entwürdigenden Prozedur bewahrt. Ebenfalls nicht befragt wurden in Irland befindliche Flüchtlinge aus England.
Die 15 vernommenen Templer, unter ihnen der Provinzmeister Henry Tanet und sein Kaplan, stritten die Anklagepunkte ab. Tanet beschuldigt aber zumindest die Ordensbrüder im Orient unlauterer Taten. Hinweise, dass in Irland die Folter angewandt wurde, gibt es nicht. Anschließend befragte die Kommission noch 42 externe Zeugen, von denen 39 Angehörige anderer Orden, hauptsächlich Franziskaner, waren. Sie erzählten zum Großteil allgemeine Gerüchte und Legenden vom Hörensagen. Zwei Zeugen erklärten, sie hätten Templer gesehen, die die Hostie bei der Elevation nicht angesehen hätten.
Die weitere Versorgung der Gefangenen gestaltete sich äußerst schwierig, trotz des königlichen Befehls, dass sie aus Einkünften ihrer Güter zu unterhalten seien, befanden jene sich doch unterdessen oft längst in zweifelhaften dritten und vierten Händen. 1311 bat der irische Provinzmeister um seine Freilassung gegen Kaution, um den Unterhalt seiner Brüder sicherzustellen. Der König gab der Bitte nicht statt, sondern betraute den Justiziar von Irland mit der Führung der ehemaligen Templergüter und der Versorgung der Inhaftierten. Nach der Aufhebung des Ordens durch die Bulle Vox in excelso wurden die in Dublin inhaftierten Templer entlassen, der Provinzmeister gegen Kaution.
In Schottland war der Vorsitzende des Verfahrens gegen die Einzelpersonen wie gegen den Orden insgesamt William Lamberton, Bischof von St. Andrews. Es gelang ihm lediglich, zwei Templer festzunehmen, „die ihren Habit trugen“, wie das Protokoll vermerkt. Die beiden Brüder leugneten die Anklagen. Auch 41 externe Zeugen machten keinerlei belastende Aussagen (ed. Wilkins, S. 280/Nicholson 2011, S. 382). Die beiden Templer wurden absolviert und in Zisterzienserklöster eingewiesen. Die moderne Alternativhistorik berichtet, dass die Ordensbrüder in Schottland offiziellen Schutz unter Robert Bruce genossen hätten. Hierfür, wie für eine Teilnahme der Templer an der Schlacht von Bannockburn im Juni 1314, gibt es keinerlei Hinweise. Die Legenden von einer Flucht nach Schottland und einem Weiterleben unter dem Deckmantel der Freimaurer tauchten erst im 18. Jahrhundert auf.
Deutschland (inklusive der damaligen Ostgebiete)
In Deutschland leistete König Albrecht I. den Forderungen nach Verhaftung der Templer, die der französische König an ihn richtete, zunächst keine Folge. Auch nach Pastoralis Praeeminentiae vom 22. November 1307 schienen die Templer weitgehend unbehelligt. Die Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium berichtet, dass Erzbischof Burchard III. gleich nach seiner Rückkehr aus Rom, wo er das Pallium empfangen habe, die Templer der vier Komtureien des Erzstifts verhaften ließ (ed. MGH Scriptores 14, S. 428f). Die Chronik datiert die Ereignisse auf Anfang Mai 1308, was noch vor Faciens Misericordiam gewesen wäre. Darüber hinaus residierte der Papst damals nicht in Rom, eine weitere Ungenauigkeit des Chronisten. Näher beleuchtet werden die Ereignisse in einem Brief, den der Papst 1312 an den Erzbischof richtet. Laut diesem waren einige Templer der Verhaftung 1308 entkommen und hatten sich mit Verwandten und Unterstützern auf Bayernaumburg verschanzt. Burchard III. hatte die Belagerung eingeleitet und zu diesem Zweck eine nahegelegene Kirche befestigen lassen. Die Zweckentfremdung der zur Diözese Halberstadt gehörenden Kirche sowie die Weigerung der Herausgabe der Templergüter in der Diözese Halberstadt sorgten für Unmut bei Albrecht I., Bischof von Halberstadt, der den Erzbischof deshalb exkommunizierte (ed. Register Clementis V, S. 58). Am 19. November 1308 wurde ein Vertrag zwischen den Templern und dem Erzbischof von Magdeburg ausgehandelt, der den Templern Sicherheit gewähren sollte. Der stellvertretende Provinzmeister, Günther von Köthen, und die Komture der vier Niederlassungen des Erzstiftes, Bertram von Greifenberg, Heinrich von Bardeleben, Nicolaus von Andersleben und Thielecke von Warmsdorf, mussten im Gegenzug mit fünf Bürgen das schriftliche Versprechen abgeben, weder den Erzbischof noch seine Freunde zu schädigen (ed. Ledebur, S. 251f). Dieser Vertrag kam maßgeblich durch das Wirken des Provinzmeisters Friedrich von Alvensleben als zustande. Auch Peter Aspelt, Primas des Deutschen Reiches und Erzbischof von Mainz, trat für den Templerorden ein, so dass den Templern schließlich freier Abzug gewährt wurde.
Mit der Bulle Faciens Misericordiam vom August 1308 wurden auch in Deutschland die Verfahren der Diözesankommissionen eingeleitet. Den Vorsitz sollten die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier, Magdeburg, Prag, Riga und die Bischöfe von Basel, Konstanz, Breslau und Uppsala innehaben. Dass der Orden auch in diesen Regionen Unterstützer hatte, beweist ein Brief des Erzbischofs von Mainz aus dem Jahr 1309, der ein Inquisitionsverfahren gegen Unterstützer der Templer erwähnt. Im Mai 1311 tagte im Kapitalsaal des Mainzer Domes eine Synode, auf der man auch die Templerfrage beriet. Die anwesenden Suffragane der Mainzer Kirche zeigten aber ebenso wenig Neigung wie der Erzbischof Peter von Aspelt, gegen die Templer einzuschreiten. Die im 16. Jahrhundert abgefasste Nauclerus-Chronik berichtet, während einer Sitzung hätten sich etwa 20 bewaffnete Ordensbrüder unter der Führung Wildgraf Hugos von Grumbach eingefunden, gegen das ungerechte Verfahren protestiert und an den Papst appelliert. Der Erzbischof habe zugesagt, in dieser Sache tätig zu werden und sie wieder ziehen lassen.
Vor der Mainzer Kommission sagten noch weitere 49 Zeugen, unter ihnen 37 Templer, zugunsten des Ordens aus (ed. Raynouard, S. 268ff). Das Konzil von Mainz entschied letztlich die Unschuld dieser Personen und – gegen den Befehl des Papstes – auch die Unschuld des gesamten Ordens. Aus diesem Grunde annullierte Clemens V. die Mainzer Sentenz. Über das weitere Schicksal der deutschen Templer ist nichts bekannt. Nach dem Konzil von Vienne wurden sie gezwungen, ihre Güter zu verlassen.
In der östlich der Oder gelegenen sogenannten Neumark und in Polen sind keine Verfolgungen der dortigen Templer bekannt. Der Prozess selbst hat hier auch nur wenige Spuren in der Geschichtsschreibung hinterlassen. Ehemalige Templer waren weiterhin in geistlichen Diensten (wie ein Pfarrer von Königsberg namens Gero als Notar und Kaplan des Brandenburger Markgrafen Woldemar oder Busso von Greiffenberg in Diensten des Bischofs von Kammin). Die Güterübertragung an die Johanniter ging allerdings nicht reibungslos vonstatten, da Markgraf Woldemar von Brandenburg versuchte, sich die Güter um Tempelburg und Zielenzig anzueignen. Erst im Vertrag von Kremmen 1318 konnten die Probleme weitgehend gelöst werden.
Zypern
Neben den Prozessprotokollen geben auch Chroniken Nachrichten über die Geschehnisse auf Zypern: der „Templer aus Tyrus“ und die späteren Amadi (15. Jahrhundert) und Bustron (16. Jahrhundert), die jedoch frühere Quellen nutzen.
Laut der Chronik von Amadi erreichte Balian von Ibelin im März 1308 der Befehl, die Templer zu verhaften. Dies habe ihm „sehr missfallen“, doch habe er sich dem päpstlichen Befehl gefügt. Amadi berichtet weiter, der Marschall des Ordens, Ayme d’Oyseliers, und die anwesenden Würdenträger hätten eine Beschwerde an den durch den Orden unterstützten Regenten des Königreiches, Amaury von Tyrus verfasst, in der sie an ihre Dienste erinnerten. Keinesfalls seien sie gewillt, ihre Waffen und Pferde auszuliefern; Land und Schatz dürften mit den Siegeln von König und Templern sichergestellt werden. Amaury möge sich für sie verwenden (ed. Mas Latrie, S. 284, übers. Schottmüller I, S. 462f)).
Die Chronik von Amadi fährt fort, Amaury habe sich beim Papst entschuldigt: Er könne wegen der militärischen Macht des verteidigungsbereiten Ordens nichts tun. Trotz Drohungen seien die Templer nicht zur Aufgabe bereit gewesen und daher auf freiem Fuß verblieben. Der Marschall und der Komtur von Zypern hätten eine Verteidigungsschrift mit Glaubensbekenntnis in Nikosia verlesen. (ed. Mas Latrie S. 286ff)
Letztendlich habe aber auch Regent Amaury die Güter des Ordens auf Zypern konfisziert und die Kirchen der Templer schließen lassen. Laut Amadi protestiert König Henri II. (der von seinem Bruder Amaury in Haft gehalten wurde) und erlangte so die Wiedereröffnung der Kirchen und die Möglichkeit für die Templer, Messe zu feiern. Amadi berichtet von einem geplanten bewaffneten Ausfall der in der Komturei von Limassol festgesetzten Ordensbrüder, der letztlich aber an den geringen Kräften der Belagerten gescheitert sei. Anschließend hätten die Templer ihre Waffen gestreckt. Bei der anschließenden Inventur wurden Rüstungen und Waffen und eine große Menge an Lebensmitteln vermerkt – jedoch kaum Geld. Dieses, so der Chronist, sei „heimlich verborgen worden“ und bis heute nicht gefunden („il resto havevano ascoso così secretamente che alcum del mondo non ha possuto saver niente“, ed. Mas Latrie S. 290).
Der Marschall und ein Teil der Templer wurden in die Templerburg von Chierochitia gebracht, die übrigen in die Burg von Geromassoia. Laut Amadi plante der offenbar nicht in strengem Gewahrsam gehaltene Marschall, eine Galeere auszurüsten und mit den Templern der Insel zu fliehen. Wenig später überführte man die höchsten Würdenträger daher in die sichere Burg von Leukara.
Das Verfahren (ed. Gilmour-Bryson) begann im Mai 1310 unter dem Vorsitz der Bischöfe von Famagusta, Baudoin Lambert, und Limassol, Pierre Erlant. Bis zum 5. Mai nahm man die Aussagen von 21 externen Zeugen auf, unter ihnen Verwandte des abgesetzten Königs Henri II., der, wie man annahm, den Templern feindlich gesonnen war. Ab dem 5. Mai und bis zum 31. Mai wurden 76 Ordensbrüder befragt (47 Ritter, unter ihnen der Marschall des Ordens, Ayme d’Oiselier, und der Provinzmeister von Süditalien, Odo de Villarote, 26 Servienten und drei Kapläne aus allen Provinzen des Ordens). Die Zeugen wurden zuerst hinsichtlich ihrer persönlichen Schuld untersucht (ed. Gilmour-Bryson, S. 77–153), dann aufgrund der 127 Anklagepunkte nach der Schuld des Ordens befragt (ed. Gilmour-Bryson, S. 155–403).
Vom 1. bis zum 19. Juni wurden weitere externe Zeugen aus allen sozialen Schichten vernommen. Sämtliche Templer verneinten die Anklagepunkte und verteidigten den Orden. Und auch die externen Zeugen, einschließlich der Verwandten Henris II., machten keine belastenden Aussagen. Sie erinnerten an die große Verehrung der Templer für das Heilige Kreuz, ihre heroische Verteidigung des Heiligen Landes und unterstrichen, dass die Gerüchte erst nach der Veröffentlichung der Anklagepunkte begannen. Einer der Zeugen berichtete sogar ein Hostienwunder, um den katholischen Glauben der Ordensbrüder zu bekräftigen.
Ende des Prozesses

König Philipp IV. diskutiert mit dem Papst / Hinrichtung von Templern, Miniatur aus den Grandes Chroniques de France, um 1460
Die Diözesankommissionen führten ihre Arbeit gegen die Personen des Ordens auch noch nach dessen offizieller Aufhebung fort, die auf dem Konzil von Vienne mit der Bulle Vox in excelso am 22. März 1312 ausgesprochen wurde. Die Bulle Ad providam vom Mai desselben Jahres übertrug beinahe alle Güter des Templerordens den Johannitern. Das Verfahren gegen den Meister und die anderen in Frankreich inhaftierten obersten Würdenträger wurde im Dezember 1312 einer Kardinalskommission übertragen. Sie fällte ihr Urteil, das auf lebenslänglichen Kerker lautete, am 18. März 1314. Jacques de Molay und der Provinzmeister der Normandie, Geoffroi de Charny, widerriefen daraufhin öffentlich all ihre früheren Geständnisse und erklärten die Unschuld des Ordens. König Philippe IV. ließ sie noch am selben Abend auf einer Seine-Insel verbrennen.
Der Tod der beiden Würdenträger war ein Ereignis, das zahlreiche Chronisten mit Bestürzung vermerken. Chronisten in Deutschland, Aragon und Italien beschreiben die Aufhebung des Ordens als ungerechten Akt, der der Gier des französischen Königs zuzuschreiben sei. Der Chronist von Pistoia sieht in der Zerschlagung des Ordens gar einen der Gründe für die Pestepedemien als Strafe für die Christenheit. Villani, Dante und Boccaccio sprechen ein ähnlich hartes Urteil über Papst und König, während die Templer immer mehr in den Stand der Märtyrer rücken, auch wenn Untugenden wie Hochmut und Machtentfaltung gegeißelt werden. Fast alle mittelalterlichen Darstellungen von Templern sind Visualisierungen von Templern auf dem Scheiterhaufen.
Ob König Philippe letztlich „Erfolg“ hatte, muss zwiespältig beantwortet werden. Was die finanzielle Seite betraf, so kann nur von einem Teilerfolg die Rede sein, denn die Immobilien des Templerordens überschrieb der Papst zum Hauptteil den Johannitern. Ersatzweise 200.000 Livres für die Güter und 60.000 Livres als „Unkostenentschädigung“ für die Haft und Verfahren wurden dem König zugeschrieben; eine eher geringe Summe. Beträchtlich war der Schaden, den der Prozess auf kirchenpolitischer und spiritueller Ebene angerichtet hatte. Bis dahin als Grundlage der Weltordnung aufgefasste Werte waren unwiderruflich zerstört worden. Die Diffamierungskampagne gegen die Templer wirkte in der Polemik des 18. und 19. Jahrhunderts gegen die Freimaurer nach. Bis heute wird in der Populärkultur der Orden oft als „Geheimbund“ mit einer „verborgenen Agenda“ und seine Mitglieder als zwielichtige Kriminelle dargestellt. Einzelne belastende Aussagen und Gerüchte aus dem Prozess werden aus dem Kontext gerissen und in Szene gesetzt.
Gründe für den Prozess
Die Frage, warum König Philippe IV. von Frankreich mittels seiner Infamierungskampagne zum großen Schlag gegen den Templerorden ausholte, kann mangels Quellen nicht mit letztgültiger Sicherheit beantwortet werden.
Lage im Templerorden
Fest steht in der historischen Forschung weitgehend, dass es keine Häresie und auch keine militärischen Initiationsriten im Templerorden gegeben hat, wie sie die Anklagen von 1307 widerspiegeln. Missbräuche einzelner Mitglieder, grobe Verfehlungen und auch Desertionen von Templern, die sich dem harten Ordensleben und dem Kampf nicht gewachsen sahen sind belegbar vorgekommen, waren aber keine Besonderheit dieses Ordens. Nicht umsonst gab es auch in Klöstern kontemplativer Orden ebenso wie in Bettelordenskonventen strenge Strafen, die auch lebenslängliche Kerkerhaft innerhalb des Klosters vorsahen.
Die Templer waren auch nicht vermögender als etwa die wirtschaftlich auch hoch erfolgreichen Zisterzienser, die im Gegensatz zu den Ritterorden keine solche enormen Ausgaben durch Burgenbesatzung, Rüstungen, Waffen etc. hatten, die nach verlustreichen Schlachten ersetzt werden mussten.
Ein Rückgang der Attraktivität des Templerordens bei Schenkungen und Eintritten ist nur insofern festzustellen, als alle „traditionellen“ Orden angesichts der „modernen“ Ordensformen der Bettelorden in dieser Zeit Einbußen erlitten. Eine zunehmende Verarmung des Adels hatte hier ebenfalls Einfluss. Dennoch gibt es Eintritte in den Templerorden bis zum Jahr 1307, ebenso Schenkungen und Privilegien von kirchlicher und weltlicher Seite noch im Jahr des Prozesses. Vorbereitungen zu einem neuen Kreuzzugsunternehmen liefen noch 1307; Jacques de Molay (und der Meister der Johanniter) führte diesbezüglich Gespräche mit dem Papst, welche sich auch mit der konkreten militärischen Planung befassten. Von einer Verlegung des Hauptsitzes von Zypern nach Frankreich – besonders gern in der Populärliteratur und Alternativhistorik bemüht – war nie die Rede.
Amtsmissbrauchs- und Häresievorwürfe gegen andere Orden
Kritik an den (Ritter-)Orden hatte es immer gegeben. Habgier und Rücksichtslosigkeit bei der Durchsetzung ihrer Interessen war ein oft geäußerter Vorwurf an die exemten, wirtschaftlich erfolgreichen Gemeinschaften. Den Johannitern wurde insbesondere nach Übernahme der Templergüter vorgeworfen, ihren Reichtum nicht zum Kampf gegen die Ungläubigen zu verwenden. Gerichtsprozesse der Orden mit anderen geistlichen oder weltlichen Institutionen um Einkünfte und Besitztitel waren an der Tagesordnung.
Auch andere Orden oder einzelne Mitglieder sahen sich Anklagen wegen Häresie oder anderer Verbrechen ausgesetzt. Der Deutsche Orden in Kurland wurde von den dortigen Bischöfen und Stadtregierungen beim Papst wegen Machtmissbrauchs, Mordes, Verschleuderung von Kirchengut und Vernachlässigung geistlicher Pflichten (und damit Begünstigung des Heidentums der Region) verklagt. Da die Deutschordensritter jedoch weder verhaftet noch unter der Folter verhört wurden, sondern einen ordnungsgemäßen Prozess anstrengen konnten und sie zudem zu wichtig für die Region waren, entging der Orden drastischen Maßnahmen.
Die Franziskaner waren seit Mitte des 13. Jahrhunderts hinsichtlich des Armutsideals zwischen Spiritualen und Konventualen gespalten, die sich gegenseitig mit Kirchenstrafen belegten. Einige Spiritualen wurden als Häretiker verbrannt. 1314 beschwerten sich englische Mitglieder des Predigerordens über einige absonderliche Praktiken und das grausame Strafmaß innerhalb des Ordens. In diesen Fällen blieb es jedoch bei einer kircheninternen Angelegenheit.
Der Streit mit Papst Bonifatius VIII.
Die durch Philippe IV. durchgesetzte Besteuerung des Klerus hatte für Aufruhr innerhalb der kirchlichen Hierarchie gesorgt. 1296 publizierte Papst Bonifatius VIII. die Bulle Clericis Laicos, mit der er scharf gegen die Steuererhebungen und weitere Eingriffe in die geistliche Jurisdiktion Stellung nahm. Der Streit eskalierte sehr rasch. Unter anderem wurde der Bischof von Pamiers, Bernard de Saisset, eingekerkert. In einer dem Papst vorgelegten Klageschrift warf man Saisset neben Majestätsbeleidigung auch Blasphemie, Unzucht und häretisches Gedankengut vor. Bonifatius VIII: widerrief das Privileg, demzufolge französische Könige nicht exkommuniziert werden durften und berief ein Konzil nach Rom ein. Philippe IV. untersagte der französischen Geistlichkeit die Reise und drohte damit, „sämtliche Güter ungehorsamer Prälaten einzuziehen“. Der Papst antwortete 1301 mit der Bulle Ausculta fili, mit der er die Fronten zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt nochmals scharf abgrenzte.
Hugues de Pairaud, damals Visitator in Frankreich, unterzeichnete wie ein Johanniteroberer und die meisten anderen Prälaten Frankreichs die darauffolgende Forderung der französischen Krone nach einem Konzil, auf dem über die Schuld Papst Bonifatius VIII. am Tod seines Amtsvorgängers entschieden werden sollte. Die Templer profilierten sich in diesem also schon weiter zurückreichenden Konflikt nicht als Gegner des Königs.
Am 13. November 1302 veröffentlichte Papst Bonifatius VIII. die Bulle Unam sanctam, der am deutlichsten je in der Kirchengeschichte formulierte Anspruch auf Suprematie der geistlichen über die weltliche Gewalt. Philippe IV. ließ daraufhin eine Anklageschrift gegen den Papst veröffentlichen, in der jener der Usurpation des Amtes, des Teufelspaktes, der Unzucht und Häresie angeklagt wird. Am 7. September 1303 ließ der französische König den Papst in dessen Residenz in Anagni überfallen und festsetzen. Kurz nach seiner Befreiung durch einen Volksaufruhr starb Bonifatius VIII. Während des gesamten Templerprozesses lief der Prozess gegen Bonifatius auf zweiter Schiene; die Verurteilung von Clemens’ Amtsvorgänger blieb eine große Bedrohung für die Kirche und damit ein Druckmittel.
Philippe IV. war der Enkel des heiliggesprochenen Königs Louis IX. und besaß den Quellen nach zu urteilen eine hohe Auffassung vom sakralen Charakter des Königtums und seiner Verantwortung. In den 1308 veröffentlichten Pamphleten Pierre Dubois’ (s.o.) wird diese Überzeugung von einem Königtum, das von Gottes Gnaden mit der Aufrechterhaltung von göttlichem und menschlichem Gesetz (notfalls auch gegen die Kirche) beauftragt ist, deutlich. Ob Philippe aber zu irgendeinem Zeitpunkt des Prozesses tatsächlich glaubte, der Orden sei von häretischem Gedankengut durchsetzt, darf stark bezweifelt werden.
Nachleben des Prozesses
Die Erinnerung an den historischen Templerorden verschwamm im Laufe des 14. Jahrhunderts. Einzelne Chronisten berichten noch mit kurzen Notizen über den Prozess und die Hinrichtung des Ordensmeisters, geben die Anklagepunkte aber zum Teil entstellt wieder. Das Interesse am Prozess und dem Orden erwachte erst im 17. Jahrhundert mit der Publikation Dupuys. Die Angst protestantischer Länder vor päpstlich-jesuitischer Unterwanderung, die Wirren der Französischen Revolution, sowie freimaurerische und anti-freimaurerische Publizistik sorgten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für eine vermehrte Beschäftigung mit dem Prozess und den Vorwürfen gegen den Orden. Dabei standen vermeintliche Geheimlehren des Templerordens und verschwörerische Tätigkeit gegen Kirche und Staat im Vordergrund. Auch Dramaturgen und Schriftsteller nahmen sich des Themas an, darunter Johann von Kalchberg und Friedrich Ludwig Werner. Die Ritterromantik des 19. Jahrhunderts sorgte – nicht zuletzt beeinflusst durch die Werke Walter Scotts – für den Einzug des Templermotivs in die Populärkultur. Losgelöst von der Auseinandersetzung von Historikern mit dem Prozess entwickelten die Mythen über Geheimwissen und Verschwörungen ein Eigenleben. Die Publikationen von De Sède und Baigent/Leigh in den 1960er und 1980er Jahren zementierten die populäre Sicht auf den Templerorden als Geheimgesellschaft mit sagenhaften Schätzen und zwielichtiger Agenda, die sich in sogenannten Doku-Dramen, Computerspiel (Assassin’s Creed) und Belletristik und immer neuen alternativhistorischen Fantasien manifestiert. Vor diesem Hintergrund betrachtet war die Diffamierungskampagne Philippes IV. ausgesprochen erfolgreich. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Prozess dauert an.
Quellen
Arrestationsbefehl und Briefe der Inquisition:
- Paris, Archives Nationales de France J 413 Nr. 22 (Vidimus des Bailli von Rouen): URL.
Publizistik:
- Paris, Bibliothèque Nationale, MS lat. 10919 (u.a. Pamphlete von Pierre Dubois fol. 119r-122r): URL.
Verhörprotokolle im Original:
- Paris, Archives Nationales de France J 413 Nr. 18 (Verhöre in Paris im Oktober und November 1307): URL.
- Paris, Archives Nationales de France J 413 Nr. 20 (Verhöre in Caen im Oktober 1307): URL.
- Paris, Archives Nationales de France J 413 Nr. 23 (Verhöre in Renneville im Oktober 1307): URL.
- Musée des Archives Nationales AE II 311 (Verhöre in Carcassonne): URL.
- Paris, Bibliothèque nationale MS Lat 5376, fol. 33–40 (Kopie englischer Verhöre).
- Vatican, Archivio Segreto, Originalurkunde der Absolution der Chinon gefangengehaltenen Ordensführung: URL.
- Barcelona, Arxiu Capitular de la S.E. Catedral Basílica, Nr. 124a-124b (Verhöre in Lleida und Navarra): URL und 149 (Verhöre in Saragossa, Cervera und Tarragona): URL (für beide Quellen kostenlose Registrierung bei der VHMML nötig).
- Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Varia de Cancillería 412, Urteil über die Templer im Königreich Aragon.
- Oxford, MS Bodleian Nr. 454 (Verhöre in England und Irland).
- London, British Library MS Julius B XII fol. 67–82, und Additional MS 5444.
Editionen/Übersetzungen der Protokolle und weiterer Schriftstücke:
- G. Baudin / G. Brunel, Les templiers en Champagne: Archives inédites, patrimoines et destins des hommes, in: A. Demurger (Hg.): Les templiers dans l’Aube (Ausstellungskatalog), 2012, S. 27–69.
- E. J. Castle, Proceedings against the Templars in France and England for Heresy, A. D. 1307–1311. Taken from the Official Documents of the Period, in: Ars Quatuor Coronatorum 20 (1907), S. 47–70 u. S. 112–142: URL.
- F. Fita y Colomé, Actas inéditas de siete concilios españoles celebrados desde el año 1282 hasta el de 1314, Madrid, 1882: URL.
- S. L. Field, Torture and Confession in the Templar Interrogations at Caen, 28–29 October 1307, in: Speculum 91/2 (2016), S. 297–327.
- H. Finke, Papsttum und Untergang des Templerordens, 2 Bde. Münster 1907: URL.
- A. Gilmour-Bryson, The Trial of the Templars in Cyprus, Leiden-Boston-Köln 1998.
- A. Gilmour-Bryson, The trial of the templars in the Papal State and the Abruzzi, Rom 1982.
- A. Ilieva, The suppression of the Templars in Cyprus according to the chronicle of Leontios Makhairas, in: M. Barber / P. Edbury/ A. Luttrell/ J. Riley-Smith (Hgg.), The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick, London 1994, S. 212–219.
- L. v Ledebur, Die Tempelherren und ihre Besitzungen im preußischen Staate, in: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preuss. Staates 16 (1835), S. 97–120, S. 242–268, hier S. 251.
- G. Lizerand, L’affaire des Templiers, Paris 1923, Neuauflage Boulogne 1999 (französ. Übersetzung der Pamphlete Pierre Dubois‘ und weiterer Schriftstücke).
- L. Ménard, Histoire civile, ecclesiastique et litteraire de la ville de Nîmes, 7 Bde., Erstauflage Paris 1750, Bd. I, S. 195–209 (Verhöre 1307) und S. 209–214 (Verhöre 1311): URL.
- R. de Mas Latrie (Hg.), Chroniques d’Amadi et de Strambaldi, Paris 1891, Bd. 1: URL.
- R. de Mas Latrie (Hg.), Chronique de l'Île de Chypre par Florio Bustron, Paris 1886, S. 164ff: URL.
- J. Michelet, Le procès des Templiers, 2 Bde., Paris 1841, (Inquisition 1307/8 in Paris, Generalkommission 1309-1311 Paris Provinzialkommission Elne 1310): URL (Bd. 1), URL (Bd. 2).
- H. Nicholson, The Proceedings against the Templars in the British Isles, 2 Bde., Abingdon 2011 (neue Edition aller vier englischen Protokollhandschriften)
- A. Nicolotti, L’interrogatorio dei Templari imprigionati a Carcassone, in: Studi Medievali, 3e serie, Anno LII, Fasc. II, Dez. 2011, S. 697–729.
- C. Port, Le Livre de Guillaume Le Maire, Paris 1874, S. 262–264: URL.
- Regestum Clementis papae V: ex vaticanis archetypis sanctissimi domini nostri Leonis XIII pontificis maximi iussu et munificentia, Bd. 7, Rom 1887, S. 58, Nr. 7858: URL.
- J.-M. Raynouard, Monumens historiques, relatifs a la condamnation des chevaliers du Temple, et a l'abolition de leur ordre, Paris 1813, Anhang mit Aufzählung der damals noch vorhandenen Archivalien S. 305–317: URL.
- H. T. Riley (Hg.), The french chronicle of London, A.D. 1259 to 1343, London 1863.
- Th. Rymer, Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica, Bd. 1 u 2, London 1745: URL.
- M. Satora, Processus contra Templarios in Francia. Procès-verbaux de la procedure menée par la commission pontificale à Paris (1309–1311), 2 Bde., Leiden 2020.
- K. Schottmüller, Der Untergang des Templer-Ordens, Berlin 1887, 2 Bde. (Provinzialkommissionen in Europa und Verfahren von Poitiers): URL.
- Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, ed. W. Schum in MGH SS 14, Hannover 1883, S. 361–374, hier S. 428: URL.
- R. Sève / A.-M. Chagny-Sève, Le procès des Templiers d’Auvergne, Paris 1986. (Provinzialkommission von Clermont).
- W. Stubbs (Hg.), Chronicles of the reigns of Edward I and Edward II, Edited from Manuscripts. 2 vols. (Rolls Series 76), Bd. I, London 1882, S. 264 Bd. II, London 1883, S. 32.
D. Wilkins (Hg.) Conciliae Magnae Britanniae et Hiberniae II, London 1737, S. 329–401: URL
- SekundärliteraturM. Barber, The trial of the Templars, Cambridge 1978. T. Bini, Dei Templari e del loro processo in Toscana, Accademia Lucchese 13 (1845).
- G. J. Brzustowicz, Die Aufhebung des Templerordens in der Neumark und in Pommern, in: Chr. Gahlbeck / H.-D. Heimann / D. Schumann (Hg.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin 2014, S. 155–170.
- M. L. Bulst-Thiele, Der Prozeß gegen den Templerorden, in: J. Fleckenstein (Hg.), Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen 1980, S. 375–402: URL.
- T. Burrows, The Templars Case for their defence in 1310, in: The journal of religious history 13 (1985), S. 248–259.
- P. R. Campomanes, Dissertaciones historicas del orden, y cavalleria de los Templarios, Lissabon 1747.
- V. Challet, Entre expansionisme capétien et relents d'hérésie: le procès des templiers du Midi, in: Cahiers de Fanjeaux 41 "Les Ordres religieux militaires dans le Midi", Toulouse 2006, S. 139–168.
- A. Demurger, Die Verfolgung der Templer. Chronik einer Vernichtung 1307–1314, München 2017.
- A. J. Forey, The beginning of the proceedings against the Aragonese Templars, in: D. W. Lomax / D. MacKenzie (Hg.), God and Man in Medieval Spain: Essays in Honour of J.R.L. Highfield, 1989, S. 81–96.
- A. J. Forey, The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, Aldershot 2001.
- B. Frale, Il papato e il processo ai Templari. L'inedita assoluzione di Chinon alla luce della diplomatica pontifica (La corte dei papi. 12), Rom 2003.
- A. Gilmour-Bryson, Vox in excelso and Vox clamantis, bulls of suppression of the Templar Order, a correction, in: Studia Monastica 20 (1978), S. 71–76.
- F. Hooghe, The Trial of the Templars in the County of Flanders, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 285–299.
- N. Housley, The Avignon Papacy and the Crusades, 1305–1379, Oxford 1986, S. 260–292, bes. 268ff zu den Anklagen gegen die Deutschordensritter in Kurland.
- Ph. Josserand, Le procès de l’ordre du Temple en Castille, in: M.-A. Chevalier (Hg.), La fin de l’ordre du Temple, Paris 2012, S. 135–152.
- Th. Krämer, Terror, Torture and the Truth: The Testimonies of the Templars Revisited, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 71–86.
- A. Krüger, Schuld oder Präjudizierung? Die Protokolle des Templerprozesses im Textvergleich (1307–1312), in: Historisches Jahrbuch 117, 2 (1997), S. 340–377.
- S. Menache, A clash of Expectations: Self-Image versus the Image of the Knights Templar in Medieval Narrative Sources, in: R. Czaja / J. Sarnowsky (Hg.), Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden (Acta Torunensia Bd. XIII), Torun 2005, S. 47–58.
- G. Mollat, Dispersion définitive des Templiers aprés leur suppression, in: Compte rendu des séances de l’academie des inscriptions et belles lettres, Paris 1952, S. 376–380.
- H. Nicholson, The Trial of the Templars in the British Isles, in: A. Luttrell / F. Tommasi (Hg.), Religiones militares: Contributi alla storia degli Ordini religiosomilitari nel medioevo, Citta di Castello 2008, S. 131–154.
- H. Nicholson, The Knights Templar on Trial. The Trial of the Templars in the British Isles 1308–-1311, Stroud 2009.
- H. Nicholson, The Trial of the Templars in Ireland, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 225–235.
- C. Perkins, The trial of the Templars in England, in: English Historical Review XXIV (1909), S. 432–447.
- C. Porro, Reassessing in the Dissolution of the Templars: King Dinis and their supression in Portugal, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 171–182.
- J. M. Sans y Travé, La desfeta del Temple, in: L’Avenc 161 (1992), S. 56–61.
- J. M. Sans y Travé, El procés dels templers catalans, in: R. Vinas / L. Verdon (Hg.), Les Templiers en pays catalan, Canet 1998, S. 131–157.
- J. Seiler, Die Aufhebung des Templerordens nach neueren Untersuchungen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 109,1 (1998), S. 19–32.
- D. R. Streeter, The Templars face the Inquisition: The Papal Commission and the Diocesan Tribunals in France, 1308–11, in: H. Nicholson / Paul F. Crawford / J. Burgtorf (Hg.), The Debate on the Trial of the Templars (1307–1314), Aldershot 2010, S. 87–96.
- J. Théry, Une héresie d’État. Philippe le Bel, le procès des ‘perfides templiers’ et la pontificalisation de la royauté française, in: M.-A. Chevalier (Hg.), La fin de l’ordre du Temple, Paris 2012, S. 63–100.
- K. Ubl / W. J. Courtenay, Gelehrte Gutachten und königliche Politik im Templerprozess, Hannover 2010.
- L. Wetzel, Le concil de Vienne et l’abolition de l’ordre du Temple, Paris 1993.
