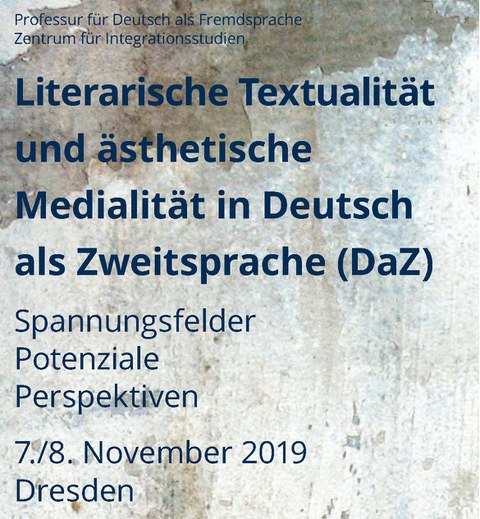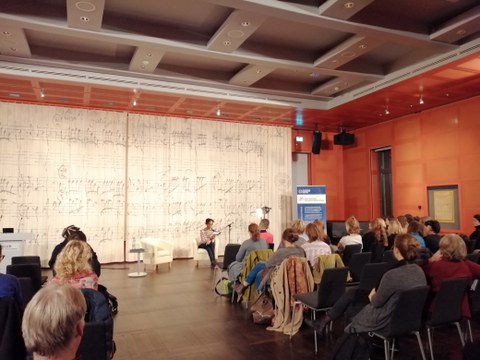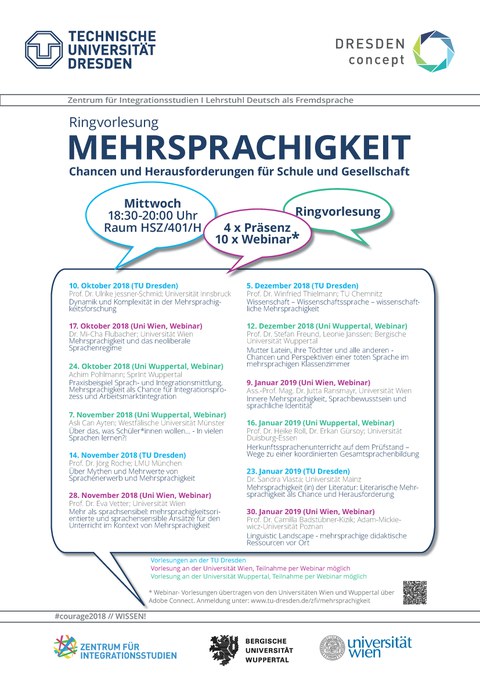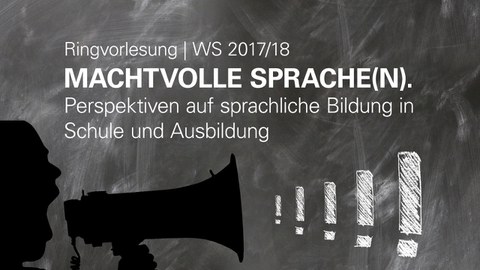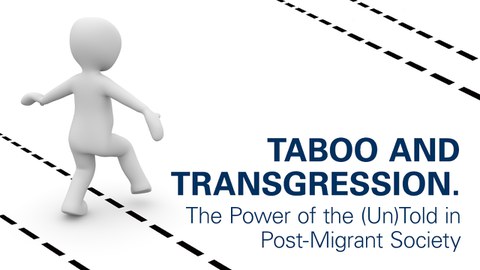Veranstaltungsarchiv
Veranstaltungen 2022
Auch im Jahr 2022 fanden in Dresden wieder die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Das Motto lautete dieses Mal "Haltung zeigen!". In Dresden fanden im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnerinnen und Gegnern sowie Opfern von Rassismus vom 14. März bis zum 6. April 2022 Veranstaltungen wie Vorträge, Themenabende und Diskussionen statt. Geplant und koordiniert wurden sie wie jedes Jahr rund um den 21. März, dem "Internationalem Tag gegen Rassismus" von der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus und dem Interkulturellen Rat. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sollten diesen sichtbar machen und zu solidarischem Handeln mit den Betroffenen motivieren. Das Zentrum für Integrationsforschung der TU Dresden sowie die dem ZfI angeschlossenen Initiativen "In Dresden ankommen", "Refugee Law Clinic" und "MigOst" beteiligten sich auch in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen.
| 14.3.2022 // 12-14 Uhr | Stadtführung | Kritische Stadtrallye | In Dresden Ankommen |
| 26.3.2022 // 16-18 Uhr | Online-Podiumsdiskussion | Fremd im eigenen Land? Aufwachsen in der Ostdeutschen Provinz | MigOst |
| 29.3.2022 // 18-19 Uhr | Online-Workshop | Mythen erkennen und kontern - Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt | Refugee Law Clinic |
14.3.2022 // 12-14 Uhr // Kritische Stadtrallye // Dresdner Innenstadt
Stadtrallyes gibt es viele. Meist werden dabei prominente historische Plätze angesteuert und die Teilnehmenden werden mit allerlei barockem Klatsch und Tratsch wie Anekdoten zum Bierkonsum der sächsischen Könige erheitert. Geschichten aus dem aktuelleren Stadtgeschehen, oder gar kritische Hintergründe zu den Orten einer Stadt, kommen oft zu kurz. Nicht so bei der kritischen Stadtrallye! In einer etwa zweistündigen Tour lernten die Teilnehmenden bekannte Orte aus einer antirassistischen und kritischen Perspektive kennen und wurden an Orte geführt, die besonders für Minoritäten in Dresden relevant sind. Trotz der ernsten Themen gab es an den Stationen kleine Rätsel zu lösen, wodurch auch echte Rallye Fans auf ihre Kosten kamen.
26.3.2022 // 16-18 Uhr // Fremd im eigenen Land? Aufwachsen in der Ostdeutschen Provinz // Online
Wie ist es für People of Color in Ostdeutschland aufzuwachsen? Was ist mit Rassismus und dem Gefühl der Unsichtbarkeit?
Auf unserem Podium sprachen:
- Katharina Warda (Autorin, Soziologin)
- Rasha Nasr (Bundestagsabgeordnete der SPD für Dresden und den südlichen Teil des Landkreises Dresden)
- Kassem Taher Saleh (Bundestagsabgeordneter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 20. Deutschen Bundestag und für den Wahlkreis 159 Dresden-Süd)
29.3.2022 // 18-19 Uhr // Mythen erkennen und kontern – Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt // Online
Die Debatte zu Flucht und Migration ist von Vorurteilen und Stereotypen geprägt. Diese Veranstaltung klärte über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz auf. Ziel des Workshops war es, über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz aufzuklären und so den Vorurteilen und Stereotypen, die die Debatte um Flucht und Migration prägen, entgegenzuwirken.
Für die Lange Nacht der Wissenschaften öffnen einmal im Jahr Dresdner Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und wissenschaftsnahe Unternehmen ihre Türen für die Öffentlichkeit, um Naturwissenschaft und Technik, Forschung und Innovation und Kunst und Kultur aus unmittelbarer Nähe erlebbar zu machen. Am 08.07.2022 von 17 bis 24 Uhr erwartete alle Interessierten im gesamten Dresdner Stadtgebiet ein bunt gefächertes Programm unterschiedlichster Formate: Zu den Vorträgen, Experimenten, Führungen und Mitmachshows waren alle großen und kleinen Nachtschwärmer und Nachtschwärmerinnen eingeladen, die Forschung interaktiv erleben und das eigene Wissen erweitern wollten.
Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden sowie das Projekt QuaBIS und die studentische Initiativen In Dresden Ankommen (IDA) und Refugee Law Clinic Dresden beteiligten sich auch im Jahr 2022 wieder.
Programm
EXPERIMENT „Inklusive" Süßigkeiten – Der Candy Shop
Inklusive Köstlichkeiten erwarteten alle Besucher:innen in unserem ungesunden, aber leckeren Süßwarenbereich. Anhand von Süßigkeiten konnte der Unterschied zwischen Inklusion und Exklusion erlebt werden. So wurden nicht nur neue Erkenntnisse mitgenommen, auch der eigene Zuckerspiegel erhöhte sich. Selbstverständlich gratis! Das Projekt QuaBIS lud ein!
EXPERIMENT „Gib mir mal die Hautfarbe“ – Die Inklusive Ausmalstation für Jung und Alt
Bestimmt erinnern Sie sich noch an das Ausmalen im Kindergarten. An welche Farbe dachten Sie, wenn jemand zu Ihnen sagte „Gib mir mal die Hautfarbe!“? Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden bot eine inklusive Ausmalstation für Jung und Alt an. Neben künstlerischem Talent konnten viele Möglichkeiten entdeckt werden, der Vielfalt Ausdruck zu verleihen. Bei Interesse diskutierte das ZfI-Team mit Besucher:innen, welche Hindernisse und Hürden einer inklusiven Gesellschaft noch immer entgegenstehen.
EXPERIMENT „Alles normal, oder was?“ – Checken Sie Ihre Normalitätsgrenze
Das Projekt QuaBIS lud ein, die eigene Normalitätsgrenze zu checken. Was ist „nicht normal“ und was „völlig normal“? Für viele Menschen sind das verschiedene Dinge. Wir boten die Möglichkeit, sich über die persönlichen Normalitätsvorstellungen auszutauschen und sich dadurch kennenzulernen. Für Fragen und Antwortenfindung stand – gespannt – die Fragezeichenwäscheleine bereit.
EXPERIMENT „Können Sie DEUTSCHE-R werden?“ – Testen Sie Ihre Fähigkeiten beim Einbürgerungstest
Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden bot interessierten Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern Fragen aus dem zentralen Einbürgerungstest für Neu-Deutsche an. Es konnte sich ausprobiert und Fragen aus Politik, Gesellschaft und Geschichte beantwortet werden. Gerne kam das ZfI-Team mit Teilnehmenden ins Gespräch darüber, welche Erwartungen der Test an Neu-Deutsche richtet, ob der Test sinnvoll ist und was wir von uns und den Neu-Deutschen wissen.
EXPERIMENT „How-To-Deutschland?“ – Das Quiz für Zuwander:innen
Ich bin in Deutschland angekommen, aber was nun? Wie kann ich einen Führerschein machen? Welche Versicherungen brauche ich und wie schließe ich sie ab? Wie eröffne ich ein Bankkonto? All diese Fragen und mehr wurden anhand von kurzen „How-To‘s“ beantwortet, um die erste Zeit in Deutschland einfacher zu gestalten. Die studentische Initiative „In Dresden ankommen“ (IDA) am Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden lud ein.
EXPERIMENT Rechtsberatung für Geflüchtete - Mit Fällen aus der Beratungspraxis
Die studentische Initiative Refugee Law Clinic Dresden (RLC) am Zentrum für Integrationsstudien und Zentrum für Internationale Studien der TU Dresden lud zu einem Einblick in die Beratungspraxis ein. Indem Fallbeispiele besprochen wurden, die typischen Fällen ähneln, mit denen die ehrenamtlichen Berater:innen der Law Clinic an den unterschiedlichen Beratunsgsstellen in Dresden konfrontiert werden, brachte das RLC-Team Interessierten ihre Arbeit in der Rechtsberatung näher und beantwortete Fragen.
Auch in diesem Jahr partizipierte das ZfI am 05. September 2022 von 16 bis 20 Uhr am Gastmahl in Dresden, welches bereits seit 2015 unter dem Motto „Dresden is(s)t bunt“ für Vielfalt, Offenheit und Gastfreundschaft in der Dresdner Stadtgesellschaft wirbt und vielfältige Formate des Dialogs und des Austauschs anbietet. Gemeinsam mit den Projekten "Ostdeutsche Migrationsgesellschaft selbst erzählen" (MigOst), "Qualifizierung von Bildungs- und Inklusionsreferent:innen in Sachsen" (QuaBIS), "Gesellschaft im Dialog" (GiD), "In Dresden Ankommen" (IDA) und "Refugee Law Clinic Dresden" (RLC) ging das ZfI Fragen wie „Was ist Integration?“, „Wie gelingt Integration?“ und „Wo bestehen Hürden?“ nach, stand am Tisch für Gespräche bereit und lud zu kleinen Aktionen ein.
"Gesellschaft im Dialog" 2022 war die Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihen "Gesellschaft im Dialog" 2021 und "Vielfalt im Dialog" 2020.
Als Teil von TU Dresden im Dialog - Transferaktivitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie der TU Dresden.

GiD 2022
"Gesellschaft im Dialog" ist ein Projekt der TU Dresden, in dem verschiedene zivilgesellschaftliche Kooperationspartner:innen und Wissenschaftler:innen auf wissenschaftlicher Grundlage zu Themen der Migration, Integration, aber auch zu Fragen von Diskriminierung und Rassismus mit einer breiten sächsischen Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. In unterschiedlichen Formaten wie beispielsweise Gesprächscafés, Kunstworkshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen werden vor dem Hintergrund aktueller Forschungserkenntnisse und Praxiserfahrungen neue Perspektiven auf Themen der Migrationsgesellschaft gemeinsam entwickelt und diskutiert. Dabei spielen Praxiserfahrungen eine gleichberechtigte Rolle neben aktuellen Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft. Thematisch lag der Fokus 2022 auf „Disruption, Zugehörigkeiten und demokratischer Teilhabe“, wobei insbesondere die Transformationserfahrungen der Jahre 1989/90 in Deutschland, aber auch darüberhinausgehende Veränderungsprozesse in dem Blick genommen und diskutiert wurden.
Konzipiert und organisiert wurde die Veranstaltungsreihe von anDemos – Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit der TU Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien und dem Kulturbüro Sachsen.
Programm
Stattgefundene Veranstaltungen
Mi., 04.05.2022 | 18.00 Uhr
LESUNG
Solidarität in Umbruchszeiten
Oder: Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus. (Suhrkamp Verlag, Berlin 2021)
mit Dr. OLGA SHPARAGA, belarussische Aktivistin und Philosophin
Olga Shparagas Buch erzählt von den Frauen der revolutionären Ereignisse 2020 in Belarus. Es sind Geschichten einer solidarischen Macht, die sich gegen die diktatorische Gewalt erhebt. Diese von vielen getragene Macht erhält ihre Kraft durch die horizontalen, füreinander einstehenden Beziehungen unter den protestierenden Bürger:innen von Belarus. In nachrevolutionären Zeiten geht diese Form der Solidarität – die auf einem gemeinsamen, sich gegenseitig stützenden und tragenden politischen Handeln beruht – oftmals viel zu schnell verloren. Wie kann sie auch in Demokratien bewahrt werden? Was bedeutet sie – in Revolutionen und Demokratien? Und unter welchen Bedingungen kann solidarisches Handeln überhaupt entstehen?
Über diese und viele andere Fragen sprachen wir gemeinsam mit der belarussischen Aktivistin und Philosophin Olga Shparaga.
Referentin: Dr. OLGA SHPARAGA, Philosophin, Wissenschaftskolleg zu Berlin
Moderation: Prof. ANIKA WALKE, Historikerin, Washington University in St. Louis und Imre Kertész, Kolleg Jena
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Frauenkultur e. V. Leipzig und dem Kulturbüro Sachsen e. V.
Mi., 18.05.2022 | 19.00 Uhr DISKUSSION Revolution und Umbruch – Belarus im Fokus mit Dr. OLGA SHPARAGA, belarussische Aktivistin und Philosophin
In ihrem Buch Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus (Suhrkamp 2021) erzählt die Philosophin und Aktivistin Olga Shparaga von den revolutionären Ereignissen 2020 in Belarus und nimmt insbesondere die Rolle der belarussischen Frauen in den Fokus. Hunderttausende mutige Bürgerinnen und Bürger aller gesellschaftlicher Schichten setzten sich gewaltfrei, kreativ und selbstorganisiert einem brutalen Regime entgegen.
Was ist seit den Präsidentschaftswahlen am 9. August 2020 in Belarus geschehen? Wie können die revolutionären Ereignisse in Minsk und anderen Städten zwischen der EU und Russland beschrieben werden? Wie schaut man aus der Opposition von Belarus auf die Geschehnisse in der Ukraine? Wie verändert der Krieg dort die Lage in Belarus? Gemeinsam mit der belarussischen Aktivistin Olga Shparaga haben wir uns diesen und weiteren Fragen zugewandt und im Kontext europäischer und globaler Emanzipationsbewegungen diskutiert.
Referentin: Dr. OLGA SHPARAGA, Philosophin, Wissenschaftskolleg zu Berlin Moderation: Prof. ANIKA WALKE, Historikerin, Washington University in St. Louis und Imre Kertész, Kolleg Jena
Ein Mitschnitt der Veranstaltung kann hier abgerufen werden.
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden, Richters Buchhandlung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Kulturbüro Sachsen e. V..
Mo., 27.06.2022 | 19.00 Uhr LESUNG UND GESPRÄCH Die DDR schien mir eine Verheißung Hrsg. vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e. V. in Zusammenarbeit mit DaMOst e. V.
Die beiden Zeitzeugen Piedoso Manave und Mahmoud Dabdoub erzählten von ihren Erfahrungen in der DDR, zur friedlichen Revolution und in den Transformationsjahren. Monika Kubrova von DaMOst berichtete aus Perspektive der Herausgeberin von dem Buchprojekt "...die DDR schien mir eine Verheißung.".
Das Buch „... die DDR schien mir eine Verheißung." Migrantinnen und Migranten in der DDR und in Ostdeutschland (Ammian Verlag 2022) versammelt 16 Lebenserzählungen von Menschen, die zwischen 1966 und 1989 aus neun verschiedenen Ländern und ganz unterschiedlichen Gründen in die DDR einreisten, die Wende miterlebten und sich entschieden, in Ostdeutschland zu bleiben. Dabei haben die sehr unterschiedlichen Biografien, die ein facettenreiches Bild vom Leben in der DDR und in Ostdeutschland zeichnen, eine zentrale Gemeinsamkeit: Der Systemwechsel verlangte allen Erzählenden eine große Anpassungsleistung ab. Wie die Erzählenden diese Umbruchsjahre nach der Wende gemeistert haben, während derer sie neue Berufswege einschlugen, Kinder aufzogen, ihre Familien unterstützen, sich ehrenamtlich engagierten und immer wieder den Stress durch rassistische Bedrohungen aushielten, ist genauso spannend wie inspirierend und stand im Fokus der Lesung und des anschließenden Gesprächs.
Außerdem konnte die Fotoausstellung Brotherland der Künstler:innen Martina Zaninelli und Thomas Jacobs angesehen werden, mit welcher verdeckte und vergessene Narrative in ein gesellschaftliches Bewusstsein zurückgeführt werden.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Montagscafé im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden, der TU Dresden, anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, dem Kulturbüro Sachsen e. V. und dem Initiativkreis Gedenken. Erinnern.Mahnen. statt. Das Montagscafé, ein interkultureller Treffpunkt und Forum des Austauschs für alle Bürger:innen aus der Stadt und der Region, beschäftigt sich mit Migration und Kultur in wöchentlich wechselnden Abendveranstaltungen.
Mo., 04.07.2022 und Di., 05.07.2022 | 09.00 bis 14.00 Uhr
PODCAST-PROJEKT
Herausforderungen der Meinungsfreiheit
mit ANNETTE FÖRSTER und dem MIMIMI.KOLLEKTIV
Innerhalb des zweitägigen Workshops an der Oberschule Dippoldiswalde erstellten die Schüler:innen gemeinsam mit dem mimimi-KOLLEKTIV einen Podcast, welcher verschiedene Fragen zum Thema Meinungsfreiheit in einer Demokratie aufgriff. Im Vorfeld wurde das Thema Meinungsfreiheit mit der Wissenschaftlerin Annette Förster diskutiert.
Referentin: Annette Förster, Wissenschaftlerin Podcaster:innen: mimimi-Kollektiv
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, dem mimimi-Kollektiv, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Sebastian-Cobler-Stiftung und dem Kulturbüro Sachsen e. V..
Do., 06.10.2022 | 17.30 Uhr
FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG
Stimmen des Umbruchs - Biografische Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt
mit NAZANIN ZANDI
Die Ausstellung STIMMEN DES UMBRUCHS gab einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen unterschiedlicher Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung und Sprache. Die Geschichten stammten aus dem Comicbuch STIMMEN, herausgegeben von Nazanin Zandi und Elena Pagel. Sie berichten von alltäglichen, aber herausfordernden Situationen: Sie erzählen von Krisen und Umbrüchen, vom Ankommen in einem fremden Land, von Diskriminierung und Ungleichheit. Gleichzeitig wenden sie die Perspektive auf die solidarischen und empowernden Wege, die von den Frauen beschritten worden sind, um den Herausforderungen entgegenzutreten. In den Comics begegnen uns grundlegende Werte, die zum Kernversprechen von Demokratien gehören: Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Vielfalt. Sie stellen Ressourcen zur Verfügung, mit deren Hilfe sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Umbruchzeiten friedlich und empowernd bearbeitet werden können.
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Kulturbüro Sachsen e. V., der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und dem Ausländerrat Dresden e. V..
Fr., 07.10.2022 | 17.00 bis 18.30 Uhr
WORKSHOP
Zur Transformation in Lebenswegen - Ein wissenschaftlicher Blick auf biografische Comic-Zeichnungen
mit DR. MAREN HACHMEISTER und NAZANIN ZANDI
Ausgewählte Comicgeschichten der Ausstellung STIMMEN DES UMBRUCHS waren Ausgangspunkt, um in dem Workshop gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Dr. Maren Hachmeister (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung) und der Künstlerin Nazanin Zandi über Transformations- und Umbruchserfahrungen zu sprechen. Mit ihnen überlegten wir, welche gesellschaftlichen Reaktionen in Umbruchszeiten selbstermächtigend wirken, wie im wissenschaftlichen Kontext über Transformation diskutiert wird, welche Theorien es hierzu gibt und wie sich diese mit den Comics verbinden lassen.
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, dem Kulturbüro Sachsen e. V., dem Ausländerrat Dresden e. V. und der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie.
Fr., 07.10.2022 | 18.30 bis 21.00 Uhr
WORKSHOP
Umbrüche zeichnen - Eine Anleitung zum biografischen Comiczeichnen
mit NAZANIN ZANDI
In dem Workshop wurden Grundkenntnisse für das Comiczeichnen vermittelt. Nazanin Zandi gab erste Tipps und Tricks für die „Neunte Kunst“. Hier gab es für alle die Möglichkeit, eigene Geschichten über Erfahrungen in Zeiten von Umbrüchen zu zeichnen und zu besprechen.
In Kooperation mit anDemos e. V. - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung, der Technischen Universität Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, dem Kulturbüro Sachsen e. V., dem Ausländerrat Dresden e. V. und der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie.
So., 23.10.2022 GESPRÄCHSCAFÉ FRAUENSTEIN
Proteste unter den Bedingungen autoritärer/diktatorischer Herrschaft
Im Mittelpunkt des Gesprächscafés stand die Arbeit in der Umwelt- und Friedensbewegung in den 1980er Jahren bis hin zu den revolutionären Umbrüchen von 1989. Oftmals werden von Protesten die „Heldengeschichten“ Einzelner herausgehoben. Wir setzten jedoch einen anderen Fokus. Im Gesprächscafé sprachen wir über die Bedeutung solidarischen Miteinanders für das politische Engagement bzw. die politische Teilhabe. Es moderierte Michael Bittner.
Do., 03.11.2022 KONZEPT-WORKSHOP STIMMEN – 47 Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt Für politische Bildner:innen, Theatermacher:innen, Lehrkräfte, Künstler:innen, Forscher:innen und Comic-Fans
Den Abschluss der Veranstaltungsreihe "Gesellschaft im Dialog" bildete ein interdisziplinärer Konzept-Workshop für politisch Interessierte, welcher am 03.11.2022 in Kooperation mit der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie (JoDDID) stattfand. Dieser Workshop begleitete ebenso wie die bereits stattgefundenen Workshops „Zur Transformation in Lebenswegen“ und „Umbrüche zeichnen“ die Ausstellung „STIMMEN DES UMBRUCHS – biografische Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt“, welche noch bis zum 03.11.2022 in den Räumen des JoDDiD zu sehen war.
Projektleiter:innen
- Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Wissenschaftliche Koordinatorin, Zentrum für Integrationsstudien)
- Dr. Julia Schulze Wessel (Geschäftsführerin, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V.)
Kooperationspartner:innen
- Kulturbüro Sachsen e.V. (Grit Hanneforth)
- Richters Buchhandlung (Christine Polak)
Förderung
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.
Film
Hier finden Sie einen Zusammenschnitt der bisherigen Veranstaltungen zu den Reihen "Vielfalt im Dialog" 2020 und "Gesellschaft im Dialog" 2021.
Film GiD
Podcast
Gemeinsam mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Riesa wurde 2021 im Rahmen von "Gesellschaft im Dialog" ein Projekt zu migrantischen Stimmen in Riesa konzipiert, umgesetzt und veröffentlicht. In dem Podcast erzählen die Jugendlichen von ihrem Leben in Riesa, von Freundschaft und ihrer Lieblingsmusik. Sie führen kleine Interviews mit Bewohner:innen und Besucher:innen von Riesa durch. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kooperationspartner von ‚Gesellschaft im Dialog‘. Mit den Jugendlichen haben wir ein ganzes Jahr zusammengearbeitet, Interview- und Aufnahmetechniken erprobt und mit ihnen über ihr Leben in Riesa gesprochen.
Gemeinsam mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Riesa wurde 2022 im Rahmen von "Gesellschaft im Dialog" ein Projekt zu migrantischen Stimmen in Riesa konzipiert, umgesetzt und veröffentlicht.
In dem Podcast erzählen die Jugendlichen von ihrem Leben in Riesa, von Freundschaft und ihrer Lieblingsmusik. Sie führen kleine Interviews mit Bewohner:innen und Besucher:innen von Riesa durch.
Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kooperationspartner von ‚Gesellschaft im Dialog‘. Mit den Jugendlichen haben wir ein ganzes Jahr zusammengearbeitet, Interview- und Aufnahmetechniken erprobt und mit ihnen über ihr Leben in Riesa gesprochen.
Veranstaltungen 2021
Vom 24. bis 26. November 2021 fand in Dresden die internationale Jahrestagung des Rats für Migration "Körper und ‚Rasse‘. Konjunkturen des Rassismus in Europa" statt. Gerahmt wurde diese Tagung von einem Kunst- und Kulturfestival, das zwischen dem 22. und 29. November 2021 ebenfalls online stattfand.
An sieben Tagen entstand im Rahmen des Festivals ein Raum der kritischen und kreativen, ernsten und heiteren Auseinandersetzung mit migrationsgesellschaftlichen Realitäten und der Alltäglichkeit von Rassismus. Das Kulturfestivals hatte das eminent wichtige, wenngleich schwer besprechbare Thema ‚Rassismus‘ im Blick und behandelte es auf künstlerisch vielfältige Weise, die Menschen zueinander in Beziehung setzte.
Aufgrund der Pandemie-Situation fanden alle Veranstaltungen ausschließlich online statt.
Das ZfI beteiligte sich mit folgenden Beiträgen:
| 24.11.2021 19:30 Uhr |
"Gib mir mal die Hautfarbe": Mit Kindern über Rassismus sprechen | Lesung mit Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar |
| 25.11.2021 19:00 Uhr |
Dunkeldeutschland | Premiere: Live-Essay und intermediale Lesung von Katharina Warda |
|
26.11.2021 |
Tipps und Tricks für das Comic-Zeichnen |
Comic-Workshop mit Nazanin Zandi |
|
26.11.2021 |
Frauenstimmen in Bildern | Buchvorstellung zum Comic-Kunstprojekt von Nazanin Zandi |
Das Gesamtprogramm des Festivals finden Sie auf der Website vom Rat für Migration.
Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie der Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
"Gesellschaft im Dialog" 2021 war die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Vielfalt im Dialog" aus dem Jahr 2020
Als Teil von TU Dresden im Dialog - Transferaktivitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie der TU Dresden.
"Gesellschaft im Dialog" war ein Projekt der TU Dresden, in dem verschiedene zivilgesellschaftliche Kooperationspartner:innen und Wissenschaftler:innen zu Themen der Migration, Integration, aber auch zu Fragen von Diskriminierung und Rassismus mit einer breiten sächsischen Öffentlichkeit ins Gespräch gekommen sind. In unterschiedlichen Formaten wie Kunstworkshops, Lesungen, Podiumsdiskussionen und einer offenen Fachkonferenz wurden vor dem Hintergrund aktueller Forschungserkenntnisse und Praxiserfahrungen neue Perspektiven auf Themen der Migrationsgesellschaft gemeinsam entwickelt und diskutiert.
Im Rahmen eines Teilprojekts von 'Gesellschaft im Dialog' ist dieser Film entstanden, in dem verschiedene Menschen aus ihrer Perspektive auf die Frage antworten:
"Was bedeutet Zugehörigkeit für Dich?"
Wir haben Menschen in Sachsen gefragt: "Was bedeutet Zugehörigkeit für Dich?" Das sind ihre Antworten. © TUD / Gesellschaft im Dialog
Programm
Bisherige Veranstaltungen
Für all unsere Veranstaltungen gilt die Datenschutz- und Einwilligungserklärung des Zentrums für Integrationsstudien der TU Dresden.
Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzten wir das digitale Comicprojekt "Vielfalt im Dialog" mit dem Thema "Was bedeuten uns Zugehörigkeiten?" fort.
| Ausführliche Informationen finden Sie auf der Comicprojekt-Seite. |
Wir wollten Menschen dazu anregen, begonnene Geschichten, in denen verschiedene Menschen und Ereignisse aufeinandertreffen, selbst zu Ende zu zeichnen bzw. den Anfang einer zu Ende erzählten Geschichte neu zu erfinden. Aus den eingesendeten Comics entstandd ein Video-Collage.
Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 sprachen Franziska Martinsen, Eter Hachmann und Douha Al-Fayyad mit Julia Schulze Wessel darüber, was Rassismus ist und gingen gemeinsam mit Dresdner:innen mit und ohne Rassismuserfahrung dieser Frage anhand aktueller Beispielen von Alltagsrassismus in Dresden nach.
- PD Dr. Franziska Martinsen ist Vertretungsprofessorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt "Politische Theorie" an der Universität Duisburg-Essen sowie Privatdozentin und Lehrbeauftragte an der Leibniz Universität Hannover.
- Eter Hachmann, M.A. ist promovierende Politikwissenschaftlerin, Vorstandsvorsitzende des Ausländerrats Dresden und Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen.
- Douha Al-Fayyad, M.Sc. ist Schriftstellerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft der TU Dresden. Seit 2014 lebt sie in Deutschland und ist seit 2015 als Kulturmittlerin und Dolmetscherin in verschiedenen Projekten tätig, u.a. im Projekt "Migrantinnen in Arbeit" (MiA) der Stadt Freiberg sowie im Programm "Mit Migrantinnen für Migrantinnen" zu den Themenfeldern Gesundheitsförderung und Gewaltprävention.
-
PD Dr. Julia Schulze Wessel ist Politikwissenschaftlerin, Geschäftsführerin des Instituts für angewandte Demokratie- und Sozialforschung anDemos, Privatdozentin an der TU Dresden und vertrat in den letzten Jahren Professuren für Politische Theorie an den Universitäten in Leipzig und Dresden.
Diskriminierung ist ein zentrales Hindernis für ein gleichberechtigtes und respektvolles Zusammenleben in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Im Kontext ‘Schule’ gehören Diskriminierungen zu den Alltagserfahrungen von Schüler:innen und deren Eltern – wie kann mit Diskriminierungen auf individueller und struktureller Ebene umgegangen werden? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen und Schulsozialarbeiter:innen? Wie können wirkungsvoller Unterstützungsstrukturen aussehen?
Der Fachtag vereinte verschiedene Perspektiven und ermöglichte ein Sprechen und ein Austausch über Diskriminierung, in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Darüber hinaus befähigte der Fachtag dazu eigene Handlungsstrategien zu entwickeln.
Der Fachtag setzte damit ein Zeichen gegen Ausgrenzung und ermutigte Alltagsdiskriminierung zu benennen, sichtbar und besprechbar zu machen. Er richtete sich an Menschen, die sich im Kontext Schule verorten: an Eltern, Lehrer:innen, Schüler:innen, Schulsozialarbeiter:innen, außerschulische Bildungsträger:innen und an verantwortliche Schulleiter:innen.
Referent:innen
Aliyeh Yegane Arani
… ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Diversität & Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz an Schulen. Seit 2015 leitet sie den Bereich Diskriminierungsschutz und Diversität bei LIFE – Bildung, Umwelt, Chancengleichheit e.V in Berlin, der die Anlauf- und Fachstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) zugeordnet ist. Sie war als Bildungsreferentin und Projektleiterin für verschiedene Organisationen tätig, u.a. für die Heinrich-Böll-Stiftung und das Deutsche Institut für Menschenrechte. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) und im beratenden Expert:innengremium aus Wissenschaft und Praxis der CLAIM-Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit.
Hamida Taamiri
… kam 2015 aus dem syrischen Aleppo nach Bautzen. Von Beruf ist sie Lehrerin. In Bautzen hat sie den arabischen Frauenvereins Nissaa gegründet, dessen Vorsitzende sie ist. Von ihr stammt die Idee, ein Komitee von Migrant:innenselbstorganisationen im Landkreis Bautzen zu gründen, um eine starke Stimme der Migrant:innen im Landkreis zu haben. Das Komitee wurde in einem einjährigen Prozess gegründet. Hamida Taamiri ist neben drei anderen Frauen Mitglied im Sprecherinnenrat des Komitees. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Empowerment von Migrant*innen insbesondere migrantischer Eltern.
Moderation
Rudaba Badakhshi
… ist Referentin, Trainerin, Lehrbeauftragte und Moderatorin mit den Schwerpunkten: Transkulturelle Bildungsarbeit, Antirassismus, Migration, Flucht, Arbeit und Beeinträchtigung. Sie studierte Kunstgeschichte und Romanistik in Jena, Berlin, Lyon und Leipzig (M.A.). Von 2008 bis 2020 arbeitete sie im Referat für Migration und Integration der Stadt Leipzig. Seit 2020 ist sie für den Dachverband der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) als Regionalkoordinatorin für Sachsen, Sachsen- Anhalt und Thüringen tätig. Sie studiert berufsbegleitend Public Management im Masterstudium.
Veranstalter:innen
Bündnis gegen Rassismus, Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V., Kulturbüro Sachsen e.V., Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, Courage – Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V., Support – Beratungsstelle der RAA Sachsen e.V., ZEOK e.V., TU Dresden/TU Dresden im Dialog
Kooperationspartner:innen
anDemos – Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V., Stadt Bautzen, KOMMIT – Komitee Migrant:innenorganisationen im Landkreis Bautzen, Partnerschaft für Demokratie Landkreis Bautzen, Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden
An der Oberschule am Pfortenberg Dippoldiswalde haben wir gemeinsam mit der Oberschule, ProJugend e.V. und der Dresdner Künstlerin Nazanin Zandi in zwei achten Klassen ein Comicprojekt zum Thema „Zugehörigkeit“ durchgeführt.
Dieses Comicprojekt wurde von der Nazanin Zandi und den Projektpartnerinnen von „Gesellschaft im Dialog“ entwickelt. Grundlage sind Geschichten verschiedener Dresdner Frauen, die in Comicform gezeichnet wurden. Sie sind in einem langjährigen Projekt, geleitet von Nazanin Zandi und Elena Pagel, entstanden. Alle entstammen erlebten Alltagserfahrungen.
Die von uns ausgewählten Geschichten erzählen alle von verschiedenen Möglichkeiten der Zugehörigkeit und des Ausschlusses. Sie zeigen den Wunsch danach, mit Respekt behandelt zu werden, Freundschaften zu schließen, dem Umgang mit herausfordernden und überraschenden Situationen und von dem Wunsch auf Selbstbestimmung.
Bei dem Workshop haben die Jugendlichen viele spannende Perspektiven auf die Geschichten geworfen und neue Ausgänge erzählt. Auch hier ging es um solidarisches Miteinander, um zufällige Begegnungen, die zur Freundschaft wurden, um die Anerkennung von Menschen, die noch nicht vertraut sind, aber auch von unsolidarischem und abwertendem Verhalten.
Unsere Gesellschaft ist divers. Doch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen wird diese Diversität sichtbar bzw. ist ausreichend repräsentiert. Mit der Veranstaltung schauten wir genauer auf den Bereich der Kunst und Kultur, der wie kein anderer Bereich in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen Entwicklungen steht, weil er gesellschaftlich reflektierende, kritisierende Funktionen erfüllt und andere (manchmal noch ungedachte und irritierende) Sichtweisen, Perspektiven und Visionen aufzeigen kann. Kunst und Kultur bieten Raum, sich mit Fragen von Zugehörigkeiten, De-/Identifizierung und Diversität in Formaten auseinanderzusetzen, die Menschen auf anderen Ebenen der Wahrnehmung erreichen, ansprechen und neue Denkanstöße anbieten können. Umso entscheidender ist es, die Diversität in Kunst und Kultur aktiv zu fördern, deren Potenziale zu nutzen und Teilhabe zu ermöglichen.
In unserer Veranstaltung am 22.9.2021 im Weltclub Dresden (Königsbrücker Str. 13, 01099 Dresden) wollten wir mit Bürger:innen und Expert:innen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb (insbes. aus Ostdeutschland) ins Gespräch kommen. Wir gingen dabei Fragen nach, wie: Ist die Diversität der (ostdeutschen) Gesellschaft ausreichend in Kunst und Kultur repräsentiert? Welche Bedeutung hat Diversität in Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft? Welche kulturpolitischen Weichen müssen für eine diversere und beteiligungsorientiertere Kunst- und Kulturlandschaft gestellt werden (insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl)?
Über verschiedene (digitale) Beteiligungsformate wurde das Publikum in die Diskussion einbezohen, um eine Vielzahl an Perspektiven sichtbar zu machen.
Gesprächsrunde mit
Katharina Warda • freie Autorin & Soziologin
1985 in Wernigerode (Harz) geboren, lebt und arbeitet als Soziologin und freie Autorin in Berlin. Inhaltlich liegen ihre Schwerpunkte auf den Themen Ostdeutschland, Rassismus, Klassismus und Punk. Neben ihrer Promotion an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien arbeitet Warda an dem Audioprojekt "Dunkeldeutschland", das von blinden Flecken deutscher Geschichtsschreibung nach der Wiedervereinigung erzählt. Zudem gestaltet sie derzeit ein Panel für die im Herbst 2021 geplante Konferenz der German Studies Association. Dabei werden ostdeutsche nicht-weiße Personen und Perspektiven im Mittelpunkt stehen.
Anna Zosik • Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kulturstiftung des Bundes
Anna Zosik ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Kulturstiftung des Bundes und dort zuständig für das Programm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Außerdem war sie Projektmanagerin für Kulturelle Bildung in der Zukunftsakademie NRW, ist Mitbegründerin von "eck_ik büro für arbeit mit kunst" Berlin und Teaching Artist an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Kanwal Sethi • Filmemacher, politischer Aktivist und Vorsitzender des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen e.V.
Kanwal Sethi ist ein in Indien geborener und heute in Leipzig lebender Filmemacher und politischer Aktivist (er ist u. a. Vorsitzender des Dachverbandes sächsischer Migrantenorganisationen e.V.). Noch in Indien gründete er eine Theatergruppe und schrieb parallel für Literatur- und Filmmagazine. 1992 zog er nach Deutschland und studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden. Nach einigen Kurz- und Dokumentarfilmen entstand 2011 mit Fernes Land sein Spielfilmdebüt. Sein nächster Spielfilm Once Again – Eine Liebe in Mumbai entstand 2017/18 als Teil einer geplanten Trilogie.
Ramin Büttner • Initiative Postmigrantisches Radio
Die Initiative Postmigrantisches Radio besteht seit 2020 und die Gruppe bezeichnet sich als (post-)migrantisch, queer, BPoC und möchte eben solchen Stimmen mehr Repräsentanz verschaffen. Die Diversität in einer Demokratie ist Ausganspunkt des Schaffens, welche über Diskurs, Politik und Pop-Kultur und über das Medium des Radios kritisch und künstlerisch thematisiert wird. Aufgrund der Biografien und Wohnorte, die von den Geschichten der ehemaligen DDR geprägt sind, richtet sich das Projekt momentan vor allem an diejenigen, die in den neuen Bundesländern leben, arbeiten, geboren sind und/oder in diese migrierten. Aufgrund der eigenen Erfahrungen fehlt es gerade der jungen, ostdeutschen, migrantischen Generation an Vorbildern in Politik. Neben der Arbeit bei der Initiative Postmigrantisches Radio, beschäftigt sich Ramin mit dem durch Eigenleistung entstandenem Projekt "Music Of Color" und ist Programmkoordinator bei Radio Corax in Halle an der Saale.
"Music Of Color" legt Wert darauf, Schwarze Menschen und People of Color zu fördern und sichtbar zu machen, eine Community aufzubauen, und somit Menschen eine Chance zu geben, deren Perspektiven durch Marginalisierungsprozesse wenig Teilhabe und Mitgestaltungsmöglichkeit am wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben erfahren. "Music Of Color" möchte durch die Förderung von Musik, Kunst und Kultur eben diesen Menschen eine Stimme verleihen und trägt damit maßgeblich zur Diversität in der Musikszene in Leipzig bei. Bisher geschah dies in Form einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe im Institut für Zukunft in Leipzig. Es wurde ein Ort für Vernetzung und Austausch als auch eine Bühne für unterrepräsentierte Personen und Musikrichtungen geschaffen. Auf den Veranstaltungen wird versucht, die Club- und die Tanzszene näher zusammen zu bringen und anstatt auf Line-Ups und große Namen einen Fokus auf das gemeinsame Erleben und Teilen von Sound zu legen.
Moderation:
Rudaba Badakhshi • ZEOK e.V.
Rudaba Badakhshi ist Referentin, Trainerin und Moderatorin mit den Schwerpunkten: Transkulturelle Bildungsarbeit, Diversity, Antirassismus, Migration, Flucht und Arbeit, Intersektionalität und Feminismus. Sie studierte Kunstgeschichte und Romanistik in Jena, Berlin, Lyon und Leipzig (M.A.). Bis 2020 arbeitete sie hauptamtlich bei der Stadt Leipzig, im Referat für Migration und Integration. Seit 2020 arbeitet sie beim Dachverband der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) als Regionalkoordinatorin der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aktuell studiert sie berufsbegleitend Master Public Management. Sie ist in diversen Bündnissen, Netzwerken und Beiräten aktiv.
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Townhall meets Hochschule" finden Sie auf der Website.
Der Kick-Off zur Veranstaltungsreihe kann auf YouTube nachgesehen werden.
Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichten einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache. Die Soziologin Youmna Fouad (TU Dresden) führte das Gespräch und brachte Perspektiven aus ihrer Forschungsarbeit ein.
Ort: Richters Buchhandlung (Förstereistraße 44, 01099 Dresden) und hybrid (Zoom)
Veranstalterinnen:
Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden & anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit Kultur Aktiv e.V.
Ist Bautzen-Budyšin vor allem eine Stadt der Wutbürger oder auch gemeinsam auf dem Weg? "Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nicht von allein und kann auch nicht verordnet werden, aber einige Rahmenbedingungen lassen sich durchaus aktiv gestalten. Er setzt stabile und vertrauensvolle Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschen, Gruppen und Organisationen voraus." - so etwa die Bertelsmann Stiftung. Darum sollte es in verschiedenen Impulsvorträgen und gemeinsamen Workshops bei dieser offenen Konferenz gehen, zu der Initiativen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bautzen-Budyšin herzlich eingeladen wurden.
Am Vormittag standen "best practice" Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung und Aushandlungsprozessen, sowie spannende Perspektivwechsel im Vordergrund. Am Nachmittag gestalteten Bautzener Themenpaten und -patinnen Workshops über das lokale und nachhaltige Zusammenlebens, über Gedenkorte und Begegnungsräume. Die Workshops boten viel Platz für neue, kreative Ideen des Miteinanders.
Im Rahmen des Projekts "Gesellschaft im Dialog" der TU Dresden sollten so Erfahrungen geteilt und durch intensive Gespräche miteinander neue Synergien zwischen Initiativen, Vereinen sowie Bürger:innen von Bautzen-Budyšin erzeugt werden. "Was kann nun gemeinsam passieren?" lautete der Titel der gemeinsamen Schlussdiskussion.
Veranstaltungsleitung & -organisation: Prof. Dr. Michael Kobel
IMPULSVORTRÄGE AM VORMITTAG
- "Zahlen und Fakten zum Gesellschaftlichen Zusammenhalt" mit Dr. Kai Unzicker, Bertelsmann Stiftung
- "Miteinander leben – aber auf welcher Grundlage? Zwischen Verfassungspatriotismus und Volksgemeinschaft" mit Dr. Steven Schäller, TU Dresden
- "Beteiligungsprozesse erfolgreich gestalten" mit Dr. Dietrich Herrmann, Sächsisches Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Referat V.2 "Bürgerbeteiligung und Online-Beteiligungsformate")
WORKSHOP AM VORMITTAG
- Zusammenhalt gestalten: Das Zusammenhaltsmodell in der Praxis nutzen
Im Workshop wird gezeigt, wie man das Modell des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das die Bertelsmann Stiftung mit Expert:innen entwickelt hat, für die praktische Arbeit in der Nachbarschaft oder Kommune einsetzen kann. Die Teilnehmenden erarbeiten exemplarisch eine erste Bestandsaufnahme und Vorschläge, wie Zusammenhalt vor Ort gestaltet werden kann.
Leitung: Dr. Kai Unzicker (Bertelsmann Stiftung) - Perspektiven wechseln mit dem 'More in Common' Toolkit
In diesem Workshop wollen wir uns experimentell mit einer Perspektivübernahme verschiedener gesellschaftlicher Gruppen beschäftigen. Zusammenhalt gelingt in einer heterogenen Gesellschaft nur über den Austausch mit Menschen die anders sind als man selbst. Das More in Common Toolkit ermöglicht den Teilnehmenden spielerisch verschiedene politische und gesellschaftliche Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und miteinander zu diskutieren.
Leitung : Dr. Cathleen Bochmann (TU Dresden) & Andreas Tietze (Aktion Zivilcourage e.V.) - Bürgerbeteiligung: wie macht man das?
In diesem Workshop wollen wir Erfahrungsberichte über Initiativen zu Bürgerbeteiligung austauschen und uns so den Fragen nähern: In welchen Themen ist Bürgerbeteiligung sinnvoll? Welche Voraussetzungen sollten für gelingende Beteiligung gegeben sein? Wie gehen wir mit Hindernissen um? Wie motivieren wir andere zum Mitmachen?
Leitung: Dr. Dietrich Herrmann (Sächsisches Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Referat V.2 "Bürgerbeteiligung und Online-Beteiligungsformate")
WORKSHOP AM NACHMITTAG
- Kultur der Erinnerung, Gedenkorte mit Dana Dubil (DGB Sachsen) & Dawid Statnik (Domowina)
Wie kann die Erinnerung an Persönlichkeiten und Orte aufrechterhalten bleiben? Welche Ideen gibt/gab es für Dr. Maria Grollmuß? Welche Personen/Orte in Bautzen fehlen noch oder sind zu wenig bekannt? Wer macht sie bekannt? - Nachhaltiges Zusammenleben in der Stadt mit Norbert Hesse (Die Stadtbegrüner Bautzen) & Christin Wegner (Foodsharing Bautzen)
Was heißt Nachhaltigkeit für Bautzen? Wie fördert man vielfältigeres Stadtgrün, Erhalt stadtnaher Wanderwege, Müllvermeidung durch Wertschätzung für Dinge, die von jemandem produziert worden sind? Wie kann Engagement für Nachhaltigkeit den Zusammenhalt fördern? - Begegnungsräume in der Stadt, Belebung der Angebote mit Carolin Dittrich (TiK - Treff im Keller) & Richard Hinz (Tagwerk Bautzen & Jugendclub Kurti)
Offene Küche und Clubraum für Jugendliche, Testshops in leerstehenden Läden, Treff für Kreative im Kulturshop, Co-Working Spaces als Insel für gemeinschaftliches Arbeiten und schöpferisches Entwickeln: Wie schaffen wir am besten Räume für Begegnung, kreatives Wirtschaften und den Transfer von Innovationen in die regionale Wirtschaft? - Beziehungsgeflecht - offener Ideen-Workshop mit Manja Gruhn (Partnerschaft für Demokratie)
Wer? Wie? Was? Zusammen?! - In einer offenen Workshop-Atmosphäre wollen wir gemeinsam spielerisch der Frage nachgehen, was Akteure und Akteurinnen in Bautzen benötigen, um neue oder bereits ausgebrütete Ideen umzusetzen. Das Ziel: miteinander die Stadt gestalten! Austausch und Bewegung sind garantiert!
"Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen" ist der Titel des ersten gemeinsamen Buchs von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar. 2018 haben die Psychologin und Kulturwissenschaftlerin Tebalou, ein Onlineshop für vielfältige Kinderbücher und Spielzeug, gegründet. In ihrem Buch gehen sie umfänglich auf das Thema Antirassismus im kindlichen Kontext ein. Neben der Möglichkeit zur Selbstreflexion wird Erziehenden eine Vielzahl von praktischen Anweisungen und Tipps an die Hand gegeben. Ziel ist es, Kinder nicht nur nicht-rassistisch, sondern antirassistisch zu erziehen.
Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.
Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowe durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.
© ZfI
Der Live-Essay "Dunkeldeutschland" von Katharina Warda erzählte polymedial aus verschiedenen Kapiteln nicht-weißer ostdeutscher Geschichte. Er befasste sich mit den sozialen Rändern der Nachwendezeit und beleuchtete blinde Flecken deutscher Geschichtsschreibung. Ausgangspunkt der Erzählung sind Wardas eigene Erfahrungen gewesen, die sie als Schwarze Ostdeutsche nach 1989/90 machte.
Weitere Infos zum Projekt "DUNKELDEUTSCHLAND" finden Sie unter diesem Link.
Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.
Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.
Wolltet ihr schon immer mal ein paar wichtige Grundkenntnisse für das Comiczeichnen lernen? In diesem Workshop bringt euch Nazanin Zandi erste Tipps und Tricks für die "Neunte Kunst" bei. In lockerer Atmosphäre könnt ihr im Anschluss autobiografische Comics selbst schreiben und zeichnen! Bereitet bitte ein paar A4-Blätter, eure Lieblingsbuntstifte und Filzstifte sowie alle anderen Zeichenmaterialien, die ihr verwenden möchtet, vor. Über eine kurze Geschichte aus eurem Leben könnt ihr euch auch schon Gedanken machen – müsst ihr aber nicht.
Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.
Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.
Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichten einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache.
Die Veranstaltung war Teil des Festivals "Rassismus verlernen" – Kunst- und Kulturfestival vom 22. bis 29. November 2021 und der Veranstaltungsreihe 'Gesellschaft im Dialog'.
Ermöglicht wurde das Festival durch die Unterstützung von TU Dresden, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden sowie durch die Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung.
Projektleiter:innen
- Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Wissenschaftliche Koordinatorin, Zentrum für Integrationsstudien)
- Dr. Julia Schulze Wessel (Geschäftsführerin, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V.)
- Dr. Oliviero Angeli (Wissenschaftlicher Koordinator, MIDEM)
- Prof. Dr. Michael Kobel (Professor Teilchenphysik, ehrenamtlicher Leiter der AG Arbeit und Ausbildung für Geflüchtete im Netzwerk Willkommen in Löbtau e.V. und Vorstandsmitglied Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.)
Kooperationspartner:innen
- Kulturbüro Sachsen e.V. (Grit Hanneforth)
- Richters Buchhandlung (Christine Polak)
- Hochschule Mittweida (Asiye Kaya)
- Pro Jugend e.V.
Presse
Unsere Veranstaltungsreihe in Presse und Öffentlichkeit:
- im Newsletter des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften
- im Exzellenz-Newsletter der TU Dresden
- im TU Dresden Newsportal
- im Dresdner Universitätsjournal (S. 4)
Förderung
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.
Film
Hier finden Sie einen Zusammenschnitt der bisherigen Veranstaltungen zu den Reihen "Vielfalt im Dialog" 2020 und "Gesellschaft im Dialog" 2021.
Film GiD
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Gesellschaft im Dialog" finden Sie hier: Gesellschaft im Dialog 2022
Auch Ostdeutschland hat eine Migrationsgeschichte: DDR-Vertragsarbeiter:innen u.a. aus Vietnam, Mosambik, Polen beluden Schiffe in Rostock, förderten Kohle in der Lausitz, bauten Waggons in Halle. Menschen kamen für eine Ausbildung oder einen der raren Studienplätze; andere als politische Emigrant:innen.
Ab den 1990er Jahren folgten Spätaussiedler:innen, Kontingentflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, später aus Syrien und Afghanistan. Andere, als Kinder binationaler Paare in Ostdeutschland geboren, machten Erfahrungen des Andersseins, obwohl sie selbst keine Migration erlebten.
Dennoch wird über die Rolle von Migrant:innen in Ostdeutschland kaum gesprochen. Selbst in der Forschung dominiert die westdeutsche Einwanderungsgeschichte den Diskurs.
Im Rahmen von „MigOst – Ostdeutsche Migrationsgeschichte selbst erzählen“ hat ein interdisziplinäres Team 2021 daran gearbeitet in drei Städten - Cottbus, Halle und Dresden, die Migrationsgeschichte der DDR und der ‚neuen Bundesländer‘ gemeinsam mit Zeitzeug:innen in partizipativen Geschichtswerkstätten aufzuarbeiten und im bundesweiten Diskurs sichtbarer zu machen.
Das Projekt wird bis 2024 fortgesetzt werden und verfolgt dabei das Ziel eine Auseinandersetzung mit der (eigenen) Migrationsgeschichte anzustoßen. Die Teilhabe von Migrant:innen in Ostdeutschland soll dadurch sichtbarer gemacht und die eindimensionale mehrheitsgesellschaftliche Perspektive auf Migration erweitert werden, um so den Weg für vielfältigere (Stadt-) Geschichten zu ebnen.
Zum Projektstart 2021 wurde neben konzeptionellen Vorbereitungen damit begonnen erste Kontaktorte zu erschaffen, Projektverknüpfungen mit Migrant:innenselbstorganisationen (MSO's) herzustellen und dazu in den drei Orten des Projektgeschehens Kick-Offs organisiert, die der (betroffenen) Zielgruppe und interessierten Zivilgesellschaft einen Zugang zum Projekt ermöglichen sollten. In Gruppen- und Austauschtreffen (Erzählcafés genannt) wurden Menschen ermutigt von ihren Erfahrungen zu berichten. Im Verlauf sollen erste Projektergebnisse präsentiert werden. Das Projektteam unterstützt Zeitzeug:innen dabei durch die Konzeption, Organisation und wissenschaftliche Begleitung dabei ihre Migrationsgeschichte aufzuarbeiten und davon zu berichten.
Programm 2021
| 07.06.2021 18 Uhr | Kickoff Dresden (Weltclub Dresden) |
| 14.06.2021 18 Uhr | Kickoff Cottbus (Strombad Cottbus) |
| 28.06.2021 18 Uhr | Kickoff Halle (WUK Theater Halle) |
| 01.10.2021 16 Uhr | Erzählcafé Dresden I „Die Moritzburger“ |
| 02.10.2021 14 Uhr | Erzählcafé Dresden II „Vertragsarbeit in Dresden und der DDR“ |
| 02.10.2021 10:30 Uhr | Erzählcafé Cottbus I für „Erzählcafé für arabische Frauen“ |
| 10.11.2021 15 Uhr | Erzählcafé Dresden III „Gemeindedolmetscher:innen“ |
| 20.11.2021 12 Uhr | Erzählcafé Cottbus II „Ankommen in Cottbus“ |
| 29.10.2021 18 Uhr | Erzählcafé Halle I mit Migrant Voices |
| 19.12.2021 11 Uhr | Erzählcafé Cottbus III „Leben mit zwei Kulturen“ Teil 1 |
Kooperationspartner:innen
Es handelt sich um ein Projekt des Zentrums für Integrationsstudien der TU Dresden, des DaMOst e.V. und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden und dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM).
Projektbeirat
Ein Projektbeirat aus Vertreter:innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis hat das Projekt 2021 in Fragen der Konzeptausrichtung, Umsetzung und Vernetzung mit anderen relevanten Akteur:innen beraten.
Der Beirat bestand aus:
- Prof. Dr. Urmila Goel (HU Berlin)
- Dr. Patrice Poutrus (Uni Erfurt)
- Dr. Karamba Diaby (MdB)
- Dr. Noa Ha (DEZIM)
- Mamad Mohamad (Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt)
- Mika Kaiyama (Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt)
Förderung
Das Projekt wurde im Rahmen des Förderbereichs Bürgerforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Es gehört zu 15 Projekten, die bis Ende 2024 die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inhaltlich und methodisch voranbringen und Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen geben sollen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier https://www.buergerschaffenwissen.de/
Weitere Informationen
Das Projekt wird fortgesetzt. Weitere Informationen finden Sie hier https://www.damost.de/projekte/projekte-migost-/projekte-migost-ostdeutsche-migrationsgeschichte-selbst-erzaehlen/
Die 31. Interkulturellen Tage in Dresden fanden vom 26. September bis 17. Oktober 2021 statt. Das Motto „Verantwortung. Gemeinsam. Leben.“ hob dabei die Wichtigkeit eines verantwortungs- und verständnisvollen Miteinanders hervor und sollte die Vielfalt der Dresdner Stadtgesellschaft feiern.
Über 150 Veranstaltungen – darunter Konzerte, Vorträge, Bastel- oder Vorlesenachmittage, Ausstellungen oder Filmvorführungen und vieles mehr - widmeten sich den Schwerpunkten:
- Politische Teilhabe stärken
- Menschen- und Kinderrechte stärken
- Interreligiösen Austausch fördern
- Nachbarschaft gestalten
- Selbstbestimmt leben
| 28.9.2021 // 19.30 - 21.00 Uhr // Richters Buchhandlung | FRAUENSTIMMEN IN BILDERN – Buchvorstellung zu einem Comic-Kunst-Projekt von Nazanin Zandi, im Gespräch mit Youmna Fouad | Biografische Geschichten von Frauen, in Form von Comics nachgezeichnet, sind Teil eines neuen Buches, dessen Idee die Dresdner Künstlerinnen Nazanin Zandi und Elena Pagel in einem dreijährigen Projekt entwickelt haben. Die autobiografischen, ehrlichen und humorvollen Bildgeschichten ermöglichen einen Einblick in die Lebensgeschichten von Frauen mit sehr unterschiedlicher Herkunft, Religion und Sprache. Die Soziologin Youmna Fouad (TU Dresden) führt das Gespräch und bringt Perspektiven aus ihrer Forschungsarbeit ein. |
| 5.10.2021 // 18.00 - 19.30 Uhr // online | Mythen erkennen und kontern – Das Asyl- und Aufenthaltsrecht erklärt | Die Debatte zu Flucht und Migration ist von Vorurteilen und Stereotypen geprägt. Diese Veranstaltung klärt über Mythen rund um das Asyl- und Aufenthaltsgesetz auf. Kein juristisches Vorwissen nötig. |
| 13.10.2021 // ab 18.30 Uhr // LOUISE – Haus für Kinder, Jugendliche und Familien | Gemeinsam Kochen | IDA kocht wieder! Gemeinsam mit euch und dem Projekt INTEGRA des Career Service der TU Dresden wollen wir einen gemütlichen Kochabend verbringen. Damit setzen wir unseren internationalen Kochabend fort, mit dem wir den interkulturellen Austausch fördern und einen kleinen Teil von verschiedenen (Koch-) Kulturen erleben wollen. Wir werden eine Vor-, Haupt- und Nachspeise aus drei verschiedenen Ländern zubereiten. |
| 14.10.21 // 17.00 -19.00 Uhr //Dresden |
Kritische Stadtrallye Dresden |
Stadtrallyes gibt es viele. Meist werden dabei prominente historische Plätze angesteuert und die Teilnehmenden werden mit allerlei barockem Klatsch und Tratsch wie Anekdoten zum Bierkonsum der sächsischen Könige erheitert. Geschichten aus dem aktuelleren Stadtgeschehen, oder gar kritische Hintergründe zu den Orten einer Stadt, kommen oft zu kurz. Nicht so bei der kritischen Stadtrallye! In einer etwa zweistündigen Tour lernen die Teilnehmenden bekannte Orte aus einer antirassistischen und kritischen Perspektive kennen und werden an Orte geführt die besonders für Minoritäten in Dresden relevant sind. Trotz der ernsten Themen gibt es an den Stationen kleine Rätzel zu lösen, wodurch auch echte Rallye Fans auf ihre Kosten kommen. |
Die Beiträge wurden veranstaltet vom Zentrum für Integrationsstudien (ZfI) der TU Dresden, dem Projekt "Gesellschaft im Dialog" des ZfI's, der Refugee Law Clinic Dresden, IDA (In Dresden ankommen), INTEGRA und anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung in Kooperation mit Kultur Aktiv e.V..
Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind bundesweite Aktionswochen der Solidarität mit den Gegnerinnen und Gegnern sowie Opfern von Rassismus. In Deutschland werden sie von der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus und dem Interkulturellen Rat geplant und koordiniert.
Auch im Jahr 2021 fanden rund um den 21. März, dem "Internationalem Tag gegen Rassismus", Veranstaltungen statt, die Rassismus sichtbar machen und zum solidarischen Handeln mit Betroffenen motivieren sollten. In Dresden fanden Veranstaltungen wie Vorträge, Themenabende und Diskussionen vom 15. März bis zum 6. April 2021 statt.
Das Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 lautete "Rassismus zur Sprache bringen - Solidarisch handeln!"
Das Projekt "Gesellschaft im Dialog" des ZfI setzte im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus das digitale Comicprojekt "Vielfalt im Dialog" mit dem Thema "Was bedeuten uns Zugehörigkeiten?" fort.
- Ausführliche Informationen finden Sie auf der Comicprojekt-Seite.
Demonstrationen und antirassistischer Protest werden meist von sehr homogenen Gruppen getragen. Menschen, die selbst Rassismus erfahren, bekommen hier leider nur selten Gehör. Doch woran liegt das? Wie können Berührungsängste abgebaut und wie bisher unterrepräsentierte Gruppen dazu ermutigt werden sich generell politisch mehr einzumischen? Diese Fragen wollten wir gemeinsam ergründen und diskutieren. Dazu hatte die studentische Initiative am Zentrum für Integrationsstudien IDA - In Dresden Ankommen wir Vertreter:innen von lokalen Initiativen sowie verschiedene Referent:innen eingeladen.
Franziska Martinsen, Eter Hachmann und Douha Al-Fayyad sprachen mit Julia Schulze Wessel darüber, was Rassismus ist und gingen gemeinsam mit Dresdner:innen mit und ohne Rassismuserfahrung dieser Frage anhand aktueller Beispielen von Alltagsrassismus in Dresden nach.
Organisiert wurde das digitale Gespräch vom Projekt Gesellschaft im Dialog des ZfI's.
Der Workshop Institutioneller Rassismus - Im Namen des Rechtstaats wurde von der studentischen Initiative Refugee Law Clinic Dresden am Zentrum für Integrationsstudien in Kooperation mit der Kontaktgruppe Asyl und Abschiebehaft e.V. und dem Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. organisiert und verdeutlichte anhand konkreter Fallbeispiele des Asyl- und Aufenthaltsrechts die Normalität und Wirkungsmacht von institutionellem Rassismus. Ein Gespräch zwischen zwei Experten führte zu Beginn theoretisch in den Themenbereich "Institutioneller Rassismus" ein. Danach wurde das Thema aus drei praktischen Perspektiven beleuchtet und anschließend in die gemeinsame Diskussion übergeleitet.
Institutioneller Rassismus wirkt für viele wie ein fernes, vornehmlich theoretisches Thema. Doch auch in Dresden, vor der eigenen Haustür, findet institutioneller Rassismus statt. Er betrifft Dresdner Einwohner:innen auf vielen Ebenen mit weitreichenden Folgen. Im Workshop ,Zeit, gehört zu werden!' wurden verschiedene Formen von institutionellem Rassismus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie die/den Einzelne:n beleuchtet. Dazu sollte Migrant:innen ein Sprachrohr geboten werden und Nichtbetroffene für das Thema sensibilisiert werden.
Organisiert wurde der Workshop von der studentischen Initiative am Zentrum für Integrationsstudien IDA - In Dresden Ankommen.
Aufgrund der Pandemiesituation fanden die Veranstaltungen teilweise verändert statt. Das vollständige Programm kann auf der Website der Stadt Dresden eingesehen werden.
Veranstaltungen 2020
Reasoning
When in 2000 Dipesh Chakrabarty's influential Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference was published, social sciences debates and conversations on various aspects of European societies were burgeoning. The debates on "The European City", also emerging in those years, remained perhaps more confined than others to a limited set of disciplinary fields, primarily Urban Studies in Europe. And yet, they inaugurated a new way of looking at European urbanities, by centering "The European City" as a model that was crafted to define a geographic mode of urban production as an ontological plausibility. Substantially drawing on the Weberian history and genealogy of urban formations in Medieval Europe, these conversations focused on what became to be theorized as distinctive morphologies, values, and politics of European cities.
In jointly bringing the modelling of "The European City" and Chakrabarty's Provincializing Europe into conversation we identify a tension between voices and sensibilities emerging at the dawn of the new millennium that address Europe and its social formations in opposed and perhaps irreconcilable terms, such as Eurocentrism vs. Postcolonialism, and historicism vs. Subaltern Studies. We consider the investigation of this tension and ambivalence of fundamental relevance for the understanding of contemporary European urbanities in a globalized world while aiming for decolonization and justice.
Provincializing European Cities sits at this junction, critically focuses on the tension which is generated there, and addresses its implications for social and urban theories in the 21st century. We propose a critical move toward studying and theorizing European cities, including their socially constructed temporalities and spatialities, beyond Eurocentrism. This approach implies a critical look at emphases and silences in the varied analyses of urban Europe, in both their historical accounts and present-day observations.
Questions
Against this background we welcome empirical, theoretical and methodological papers addressing the following and related questions:
- What are the limitations and potentials of contemporary approaches from global perspectives to cities in Europe for understanding urban transformations on the continent?
- How do Eurocentric approaches to urban Europe contribute to forge theoretical and historical imagination on capitalism, class, race, labour, gender and ability/disability?
- How could global geographies of (urban) knowledge production benefit from critical and global approaches to urban Europe?
- What can postcolonial, decolonial and more generally critical race perspectives contribute to global and comparative analyses of European urbanities?
- What implications does a singular "European-City" ideal type have on theorizing the urban in Europe and beyond?
- How could concepts such as internal colonialism and settler colonialism contribute to understanding cities in Europe today?
Program
PROGRAM | Thursday. 26 March 2020
13:30 Registration
14:00 Introduction Provincialising European Cities
Noa Ha (Technische Universität Dresden)
Giovanni Picker (University of Glasgow)
14:30 Panel 1: Provincialising Historicism
- Parochial imaginations? A socio-territorial perspective on the European city
Anke Schwarz (Technische Universität Dresden) -
Provincializing Industry: Debating Industry and Urban Modernity in Nineteenth-Century Buenos Aires
Antonio Carbone (German Historical Institute in Rome) - Beyond the coloniality in World Heritages: Countermapping the colonial amnesia in the Parisian urban landscapes
Tania Mancheno (University of Hamburg)
Moderation: Julie Chamberlain
16:30 Break
17:00 Panel 2: Provincialising (Urban) Geography
- Decolonizing Cottbus - Postcolonial and Postsocialist Entanglements
Miriam Friz Trzeciak, Dr Manuel Peters (Brandenburg University of Technology) - Balkanising Conviviality: Urban Conflicts and the Making of Post-Ottoman, Socialist, and Divided Mitrovica
Pieter Troch (University of Regensburg) - Urban infrastructures, migration and the reproduction of colonial forms of difference in Sheffield
Aidan Mosselson (University of Sheffield)
Moderation: Mahdis Azarmandi
19:00 End
PROGRAM | Friday. 27 March 2020
09:30 Welcome Coffee
10:00 Panel 3: Provincialising The Political (agency) I
- Between hope and despair: how racism and anti-racism produce Madrid
Stoyanka Andreeva Eneva (Autonomous University of Madrid) - Theorizing Hamburg from the South
Julie Chamberlain (York University, Toronto) - Taking Care of Others and the Self through Islamic Funeral Service in Berlin
Barış Ülker (Technical University Berlin)
Moderation: Aidan Mosselson
12:00 Lunch
13:30 Panel 4: Provincialising The Political (agency) II
- Hide and Seek: Where is the ‘Colour Line’? Questioning Race in Lisbon
Ana Rita Alves (Centre for Social Studies, University of Coimbra) - Migrant Claims to the Metropol and the new Mediterranean City
Mahdis Azarmandi (University of Canterbury) and Piro Rexhepi (Northhampton Community College)
Moderation: Anke Schwarz
15:00 Break
15:30 Discussion and wrapping up
16:30 End
Organizers and Contact
Noa K. Ha, Junior Research Group Leader at Center for Integration Studies, TU Dresden. More information
Giovanni Picker, Lecturer in the Sociology of Inequalities (Sociology) at University of Glasgow. More information
Information about venue of the conference: calendar entry
Funding
The conference is funded by ZEIT-Stiftung und TU Dresden
Internationale Wochen gegen Rassismus 2020
Dieses Jahr stehen die IWgR vom 16. März bis zum 6. April 2020 unter dem Motto „Gesicht zeigen – Stimme erheben“.
Anliegen der IWgR
Die Wochen sollen darauf hinweisen, dass Rassismus immer noch ein Problem in unserer Gesellschaft darstellt und es wichtig ist, sich für ein demokratisches Miteinander und die Achtung von Menschenrechten und Menschenwürde einzusetzen.
Die bundesweiten Aktionswochen sind ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern sowie den Gegnerinnen und Gegnern von Rassismus. Sie haben das Ziel, über rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu informieren und zu sensibilisieren. Sie regen zu Selbstreflexion und eigenem Handeln an, um die Voraussetzungen für ein respektvolles, menschliches Mit- und Füreinander zu schaffen und Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung aus unserem Alltag zu verbannen.
Seit Januar 2016 werden die Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert. Die Stiftung hat diese Aufgabe vom Interkulturellen Rat e.V. übernommen, der seit 1994 die Aktivitäten rund um den 21. März in Deutschland initiierte. Dieses Jahr erinnert sie am 21. März 2020 an 25 Jahre UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland und plant dazu wieder Veranstaltungen und Projekte.
Weitere Informationen dazu gibt es hier.
Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden
Die Landeshauptstadt Dresden wird sich auch in diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen.
"2020 wird ein denkwürdiges Jahr wegen des 75. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des zweiten Weltkrieges. Vor diesen Hintergründen wird ein Themenschwerpunkt der kommenden Wochen gegen Rassismus die historische Dimension von rassistischer Diskriminierung beleuchten.
Auch unsere Stadt ist nicht frei von intoleranten Einstellungen und rassistischem oder diskriminierendem Denken und Handeln. Das ist nicht hinzunehmen! Vielmehr müssen wir uns stark machen für ein friedliches Zusammenleben in einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft.
Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für Menschenwürde und Gleichbehandlung und unsere Stimmen erheben gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, Hass und Gewalt. Ich möchte alle Dresdnerinnen und Dresdner, alle Vereine, Initiativen, demokratischen Parteien und Organisationen einladen dazu beizutragen, ein lebendiges, demokratisches Miteinander in Dresden zu gestalten. "
Dirk Hilbert
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden
Beteiligung des Zentrums für Integrationsstudien
[Abgesagt] Transzendentale Toleranzerziehung - Vortrag und Austausch
Wie philosophische Bildung auf Rassismus in Schule reagieren kann.
Vortrag von Prof. Markus Tiedemann (TU Dresden)
Austausch (mit Lehrer*innen der 128. OS, Vertreterinnen des NDC Sachsen und des ZfI); für Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern, Interessierte
gemeinsam mit
- Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
- Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V.
- Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen (NDC)
- 128. Oberschule „Carola von Wasa“: Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Wann?
Dienstag, 17. März 2020, 16:00-18:00 Uhr
Wo?
128. Oberschule „Carola von Wasa“ - Rudolf-Bergander-Ring 3, 01219 Dresden
[Abgesagt] "Rassismus im System Schule. Sachsen und Berlin im Gespräch"
Ein Diskussionsabend mit
- Saraya Gomis, ehemalige Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes Berlin und
- Prof. Dr. Anja Besand, Professur für Didaktik der politischen Bildung, TU Dresden
An diesem Abend werden wir mit zwei Expertinnen uns mit der Frage befassen, in welchen Formen Rassismus im deutschen Schulsystem angetroffen wird, und wie das System Schule darauf reagiert, um es zu vermindern oder zu verhindern. Vergleichend werden die Bundesländer Berlin und Sachsen im Fokus der Diskussion stehen, um nicht nur augenfällige Unterschiede - Sachsen ist ein Flächenstaat, Berlin ist ein Stadtstaat – anzusprechen, sondern auch Gemeinsamkeiten.
Moderation: Dr. Noa K. Ha, Zentrum für Integrationsstudien
gemeinsam mit
- Landeshauptstadt Dresden
- Bürgermeisteramt, Referentin für Demokratie und Zivilgesellschaft - Dr. Julia Günther
Wann?
Donnerstag, 2. April 2020, Beginn: 18:30 Uhr
Wo?
Kulturrathaus: Clara-Schumann-Saal - Königstraße 15, 01097 Dresden
[Abgesagt] „Wo kommst Du her?“ - Lesung und Gespräch
Eine Lesung und Anschlussgespräch mit
Alice Hasters, Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Michael Nattke ("Wer schweigt, stimmt zu")
Moderation: Dr. Noa K. Ha, Zentrum für Integrationsstudien
Wann?
6. April 2020, Beginn 19.30 Uhr
Wo?
Zentralbibliothek - Schloßstraße 2, 01067 Dresden
Informationen zu den Veranstaltungen auf Bundesebene
Die Auftaktveranstaltung wird am 16. März 2020 in Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Annette Widmann-Mauz in Berlin statt finden.
Den Link zum Bundesprogramm gibt es hier.
Im Wintersemester 2020/21 wurde am Zentrum für Integrationsstudien in Zusammenarbeit mit der Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden, der Bergischen Universität Wuppertal und der Universität Wien eine Ringvorlesung zum Thema "Bildungssprache(n) & Sprach(en)bildung. Perspektiven auf ein wirkmächtiges Konstrukt und seine Praktiken" angeboten.

RV: Bildungssprache(n)&Sprache(n)bildung
Format
Universitäten-übergreifende Online-Ringvorlesung für Studierende, Hochschulangehörige und Interessierte der Geistes- und Sozialwissenschaften
Zeit und Ort
- Wintersemester 20/21
- Start: 13.10.2020; Ende: 26.1.2021
- Dienstags, 18:30-20:00 Uhr
Programm
|
13.10.20 |
Für den Standort: TU Dresden Für den Standort: Bergische Universität Wuppertal Für den Standort: Universität Wien |
Einführung in die Ringvorlesung und studien-organisatorische Absprachen Nur für Studierende je Standort. Die Links zu den anderen Standorten wurden durch die jeweilige*n Dozent*innen zur Verfügung gestellt. |
| 20.10.20 | Hans-Joachim Roth (Universität zu Köln) |
Eröffnungsvortrag |
| 27.10.20 | Anja Wildemann (Universität Koblenz · Landau) |
Bildungssprache in der Professionalisierung von angehenden Lehrkräften – Bildungsziel: Reflective Practitioner |
| 03.11.20 | Corinna Peschel (Bergische Universität Wuppertal) | Bildungssprache und Schriftlichkeit in der Schule |
| 10.11.20 | Melanie Moll (LMU München / Deutschkurse bei der Universität München e.V.) | Wissenschaftssprache Deutsch für alle? Überlegungen zu einer studienbezogenen Sprachvermittlung für Studierende mit Deutsch als L1, L2 |
| 17.11.20 | Vivien Heller (Bergische Universität Wuppertal) | Bildungssprachliche Praktiken in schulischen und außerschulischen Feldern. Erfahrungen und Perspektiven sozial privilegierter und benachteiligter Kinder |
| 24.11.20 | Projekt Qualifizierung von Bildungsfachkräften (TU Dresden) |
Bildungssprache als Zugangsbarriere im universitären Kontext |
| 01.12.20 | Katharina Groß (Universität Wien) | Bildungssprache im Fachunterricht am Beispiel der Chemie |
| 15.12.20 | Andrea Daase (Universität Bremen) | Bildungssprache und (die Unmöglichkeit von) Machtkritik |
| 12.01.21 | Erkan Gürsoy (Universität Duisburg-Essen) |
Herkunftssprachlicher Unterricht in der Migrationsgesellschaft: machtkritische und sprachbildungsdidaktische Perspektiven |
| 19.01.21 | Eva Vetter (Universität Wien) | Bildungssprache im Kontext von Mehrsprachigkeit |
| 26.01.21 |
Sandra Reitbrecht (Pädagogische Hochschule Wien) |
Durchgängigkeit ko-konstruieren |
Thematischer Fokus der Ringvorlesung
In den letzten Jahren ist mit Blick auf die Problematik der Benachteiligung von Kindern aus "bildungsfernen Schichten" und mit "Migrationshintergrund" der Begriff der "Bildungssprache" (Gogolin 2009) zu einem Schlüsselbegriff im Diskurs um Schule und Bildung geworden. In der Ringvorlesung wurde dieser Terminus nicht nur in seiner sprachen- und bildungspolitischen Bedeutung reflektiert und begründet, sondern vor allem in seinem schillernden Facettenreichtum beleuchtet, seiner - auch ideologischen - Aufgeladenheit, seiner linguistischen Unterbestimmtheit, seiner mangelnden empirischen Fundierung und wurde so nicht zuletzt in seiner Ambivalenz diskutiert und ergründet.
Wenn von "Bildungssprache" die Rede ist, geht es einerseits um die Gewährung bzw. Verweigerung des Zugangs zu gesellschaftlichen Ressourcen qua Sprache. Andererseits geht es um ein damit verknüpftes Verständnis von Sprache, um ein Verständnis des Verhältnisses von Sprache und Subjekt, und damit um ein Bündel von bislang kaum durchschauten Konzeptualisierungen, Zuschreibungen, Narrativen und schließlich auch Praktiken. Sie konstituieren Bildungssprache als ein enorm wirkmächtiges Konstrukt in unterschiedlichen Bildungskontexten. Dessen Potenzial wurde dabei in der Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Sprache im Bildungsprozess gesehen. Um ihr Rechnung zu tragen, erschien im Kontext dieser Ringvorlesung der Begriff der Bildungssprache mit dem Begriff der Sprachenbildung verkoppelt. Impliziert wurde, dass Sprachenbildung eine Aufgabe nicht nur der Schule sein kann, sondern aller Bildungsinstitutionen sein muss: von der Elementarpädagogik bis zur Hochschule. Dabei spielte die Zusammenarbeit der jeweiligen Bildungsinstitutionen mit anderen Akteur*innen und Einrichtungen eine wichtige Rolle. Sprachenbildung wird als Aufgabe aller an Bildungsprozessen Beteiligter verstanden und erfordert dementsprechend interdisziplinäre Zugänge, wie sie in dieser Ringvorlesung zur Sprache kommen konnten.
Anmeldung und Zugang zum Videokonferenzsystem
Die Vorlesung fand in einem virtuellen Vortragsraum des Videokonferenzsystems Collaborate statt. Der Link wurde zur jeweiligen Veranstaltung mit einer Registrierung ohne Voranmeldung zur Verfügung gestellt und blieb alle Vorlesungstermine über gleich.
Informationen zu Collaborate finden Sie hier: https://wiki.univie.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=101484831
Folien, Texte und Aufzeichnungen zur Vorlesung finden Sie hier: http://bit.ly/bildungssprache-materialien
Jede Vorlesung (inkl. Chat) wurde aufgezeichnet. Alle Teilnehmenden der Vorlesung haben sich mit der Aufzeichnung einverstanden erklärt.
Teilnahmenachweise
Externe Teilnehmer*innen und Studierende der TU Dresden, die über Studium generale an der Ringvorlesung teilgenommen haben, können einen Teilnahmenachweis erhalten. Bitte richten Sie dazu eine formlose Email an .
Veranstalter
Institut für Bildungsforschung, Bergische Universität Wuppertal
Institut für Germanistik, Universität Wien
Professur für Deutsch als Fremdsprache & Zentrum für Integrationsstudien, TU Dresden

BUW
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Vorlesung!
Vielfalt im Dialog 2020 war eine Veranstaltungsreihe über Vielfalt, Integration, Migration und Rassismus als Teil von TU Dresden im Dialog - Transferaktivitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie der TU Dresden. Im Jahr 2021 wir sie unter dem Titel "Gesellschaft im Dialog" fortgeführt.

Vielfalt im Dialog 2020
„Vielfalt im Dialog“ war eine Veranstaltungsreihe an der TU Dresden, die mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner*innen im dem Herbst / Winter 2020 über Themen der Migration und Integration mit einer breiten sächsischen Öffentlichkeit ins Gespräch kam. Mit unterschiedlichen Formaten wie einem Kunstworkshop, Lesungen und Podiumsdiskussionen wurden vor dem Hintergrund aktueller Forschungserkenntnisse und Praxiserfahrungen neue Perspektiven auf Themen der Migrationsgesellschaft gemeinsam entwickelt und diskutiert.
Konzipiert und organisiert wurde die Veranstaltungsreihe durch den Themenzirkel „Mig-ration und Integration“ der TU Dresden sowie zwei außeruniversitäre Institutionen: anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung und das Kulturbüro Sachsen: Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Zentrum für Integrationsstudien, TU Dresden), Dr. Julia Schulze Wessel (anDemos - Institut für angwandte Demokratie- und Sozialforschung), Prof. Dr. Michael Kobel (Professur Teilchenphysik, Willkommen in Löbtau, Sächsischer Flüchtlingsrat) und Dr. Oliviero Angeli (MIDEM, Institut für Politikwissenschaft).
Programm
| 29.10.2020 16:00 Uhr | Podiumsdiskussion "Erinnerungsräume von Bewegungsgeschichten - BPoC Kollektive im Transformationsprozess" |
Podiusmdiskussion im Rahmen der Tagung "Im Osten was Neues? Intersektionale Migrantische - BIPoC Perspektiven auf 30 Jahre (Wieder-)Vereinigungsprozess in Ostdeutschland" Den Nachbericht und die Bilder von der Tagung finden Sie auf der Website der Hochschule Mittweida. |
| 11.11.2020 19:30 Uhr | Patrice Poutrus liest: Umkämpftes Asyl • Gespräche über Zugehörigkeit | Die Veranstaltung wurde so barrierearm wie möglich abgehalten und digital gestreamt. |
|
3.12.2020 19:30 Uhr |
Olivia Wenzel liest: 1000 Serpentinen Angst • Gespräche über Zugehörigkeit | Die Veranstaltung fand digital mit Anmeldung und Registrierung statt und wurde gestreamt. |
| Digitales Comic-Projekt "Was bedeutet uns Vielfalt?" • Nazanin Zandi | Mehr Informationen zum digitalen Comic-Projekt finden Sie hier. |
Projektleiter*innen
- Dr. Karoline Oehme-Jüngling (Wissenschaftliche Koordinatorin, Zentrum für Integrationsstudien)
- Dr. Julia Schulze Wessel (Geschäftsführerin, anDemos - Institut für angewandte Demokratie- und Sozialforschung e.V.)
- Dr. Oliviero Angeli (Wissenschaftlicher Koordinator, MIDEM)
- Prof. Dr. Michael Kobel (Professor Teilchenphysik, ehrenamtlicher Leiter der AG Arbeit und Ausbildung für Geflüchtete im Netzwerk Willkommen in Löbtau e.V. und Vorstandsmitglied Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.)
Kooperationspartner*innen
- Kulturbüro Sachsen e.V. (Grit Hanneforth)
- Richters Buchhandlung (Christine Polak)
- Hochschule Mittweida (Asiye Kaya)
- Pro Jugend e.V.
Presse
Unsere Veranstaltungsreihe in Presse und Öffentlichkeit:
- im Newsletter des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften
- im Exzellenz-Newsletter der TU Dresden
- im TU Dresden Newsportal
- im Dresdner Universitätsjournal (S. 4)
Förderung
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe "Vielfalt im Dialog" 2020 finden Sie hier: Vielfalt im Dialog 2020.
Im Wintersemester 2020/21 bot das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden die Fortbildung „Grundlagen des Aufenthalts- und Asylrechts“ an. Sie richtete sich einerseits an Studierende, die im Rahmen der Refugee Law Clinic Dresden eine Ausbildung zu ehrenamtlichen Berater*innen im Migrationsrecht absolvieren wollten, andererseits an externe Interessierte, insbesondere Haupt- und Ehrenamtliche der Migrations- und Integrationsarbeit.
Die Fortbildung wurde als Vorlesungsreihe angeboten und begann mit einem Überblick zum allgemeinen Verwaltungsrechts und behandelte auf Basis der Historie des Flüchtlingsrechts die Einordnung des Asyl- und AufenthG in die aktuelle deutsche Rechtsordnung. Darauf aufbauend wurde das deutsche und europäische Asyl- und Aufenthaltsrecht verständlich und mit Blick auf die Verfahrensabläufe erläutert. Insbesondere die Bereiche der humanitären Zuwanderung und des Flüchtlingsrechts standen dabei im Fokus. Die Fortbildung sollte damit sowohl die Grundlagen und die Struktur des Asyl- und Aufenthaltsrechts vermitteln als auch die aktuellen Entwicklungen, Herausforderungen und Fragen im Rechtsgebiet.
Zielgruppe
Haupt- und Ehrenamtliche in der Migrations- und Integrationsarbeit, Interessierte
Zusätzlich Studierende im Rahmen der Ausbildung zu ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern im Migrationsrecht (Refugee Law Clinic Dresden)
Programm
| 1. DS // 29.10.2020 | Vorlesungseinführung; Einordnung des Asyl-/ AufenthR im Allgemeinen Verwaltungsrecht |
| 2. DS // 5.11.2020 | Historischer Überblick über das Flüchtlingsrecht; Entwicklung in Deutschland und international |
| 3. DS // 12.11.2020 |
Grundzüge des Verwaltungsrechts; Verwaltungsverfahren; allgemeiner Prüfungsaufbau Überblick über Rechtsweg; Verwaltungsakt und dessen Abgrenzungsprobleme; Wirksamkeitsvoraussetzungen; Behördenstruktur im Migrationsrecht |
| 4. DS // 19.11.2020 | Überblick Aufenthaltsrecht: Grundstruktur und Arten von Aufenthaltstiteln; Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels |
| 5. DS // 26.11.2020 | Einreise (irreguläre und legale); Abgrenzung Zurückweisung, Zurückschiebung, Abschiebung; Aufenthaltsrecht - allg. Erteilungsvoraussetzungen (Regelerteilungsvoraussetzungen), Visum und Visumverfahren |
| 6. DS // 3.12.2020 | Dublinverfahren: Antragstellung; Anhörung, wichtige Unterlagen, Dublin-Fristen |
| 7. DS // 10.12.2020 | Überblick über das nationale Asylverfahren (beteiligte Personen und Institutionen, regelmäßiger Ablauf, Vergleiche mit dem allgem. Vw-Verfahren) |
| 8. DS // 17.12.2020 | Materielles Flüchtlingsrecht: Die materielle Prüfung des Schutzstatus; Flüchtlingsbegriff, Art. 16a GG |
| 9. DS // 07.01.2021 | Materielles Flüchtlingsrecht: Subsidiärer Schutz, Abschiebeverbote |
| 10. DS // 14.01.2021 | Verwaltungsprozessrecht: Anfechtungs- und Verpflichtungsklage; Eilrechtsschutz, Eilverfahren; Zustellvorschriften, Fristberechnung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand |
| 11. DS // 21.01.2021 | Rechtsschutz im Asylverfahren: (Vertiefung), Klage- und Eilverfahren |
| 12. DS // 28.01.2021 | Aufenthaltsbeendigung, Erlöschensgründe; Ausreisepflicht; Abschiebung (Vollziehung und Aussetzung) |
| 13. DS // 04.02.2021 | Widerrufsverfahren, Folgeantrag, Zweitantrag |
Der Flyer steht Ihnen hier im PDF zur Verfügung.
Weitere Informationen
Dozentin: RA und wissenschaftliche Mitarbeiterin Elena Bogdanzaliew (Zentrum für Integrationsstudien & Zentrum für Internationale Studien der TU Dresden)
Keine Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmekosten: 360€
Abschluss: Teilnahmebescheinigung
Veranstalter war das Zentrum für Weiterbildung der TU Dresden in Kooperation mit dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden.
Die Fortbildung war Teil des Ausbildungsprogramms der Refugee Law Clinic Dresden.
Veranstaltungen 2019
Sprachsensibles Unterrichten kann in allen Fächern und allen Schularten die Chancenverteilung im Klassenzimmer verbessern. Dies kommt Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache bei der Integration in den Regelunterricht, aber genauso auch Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Erstsprache zugute. An vielen Schulen wird DaZ-Unterricht jedoch noch nicht als Aufgabe aller Lehrkräfte betrachtet, ein Bewusstsein für die Relevanz durchgehender Sprachbildung in allen Fächern ist nicht immer ausreichend vorhanden. Seitens der Schulleitung, des Kollegiums und der Elternschaft gehen trotz guter Ansätze damit zum Teil eine geringere Wertschätzung der Arbeit der DaZ-Lehrkräfte und zu wenig Austausch einher.
Zum Abschluss des Projektes „Spracherwerb im Spannungsfeld interkultureller pädagogischer Beziehungen (SiB)“ laden wir herzlich zum Fachtag „Sprachsensibles Unterrichten“ ein.
Dort werden die Ergebnisse und offenen Fragen aus der SiB-Projektarbeit vorgestellt und durch einen Inputvortrag von JProf. Inger Petersen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) und die Arbeit in drei thematischen Workshops ein Rahmen für eine Annäherung an den Gegenstand „Sprachsensibles Unterrichten“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln geschaffen.
Das SiB-Projekt, angesiedelt im Erweiterungsfach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an der Technischen Universität Dresden und im Rahmen des Sonderprogramms Integration durch Bildung durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gefördert, hat seit Ende 2017 Kooperationen mit Dresdner Grund- und Oberschulen aufgebaut, um Lehramtsstudierende der TU im Sinne des Service-Learning-Prinzips dort den DaZ- und Regelunterricht beobachten, miterleben und mitgestalten zu lassen.
Nutznießende sind hier alle Akteur*innen: Die Schüler*innen an den Kooperationsschulen profitieren von der teilweise individuellen Betreuung und der Expertise der Studierenden, zugleich werden die Lehrkräfte entlastet und ein persönlicher fachlicher Austausch mit den Studierenden begünstigt. Deren Engagement wird von universitärer Seite durch Leistungspunkte gewürdigt und wissenschaftlich gerahmt. Das Angebot des Lehramtsstudiums wird durch die Miteinbeziehung weiterer Partner*innen, den intensiven Einsatz an den Schulen und die intensive Begleitung im Seminar über die Mindestanforderungen einer schulpraktischen Übung hinaus verstärkt.
Zeit und Ort
| Datum | Freitag, 6. Dezember 2019 |
| Zeit | 12:30-18:00 Uhr |
| Ort |
Technische Universität Dresden, Standort August-Bebel-Str. 20 |
Fachtagsleitung
- Dr. Frank Beier, Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) der TU Dresden
- Anke Börsel, Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden
- Dr. Torsten Andreas, Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden
- Julia Welchering, Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden
Zielgruppe
Lehrer*innen und Lehramtsstudierende
Die Veranstaltung ist Teil des externen Fortbildungskatalogs des Landesamts für Schule und Bildung (EXT04581).
Programm
| 12:30 - 13:00 | Ankunft & Begrüßungskaffee |
| 13:00 - 13:30 |
|
| 13:30 - 14:30 |
Inputvortrag |
| 14:30 - 15:00 | Kaffeepause |
| 15:00 - 17:00 |
Workshops
|
| 17:15 - 18:00 | Abschluss |
Anmeldung
Die Veranstaltung ist ausgebucht. Eine Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.
Förderhinweis
Das Projekt "Spracherwerb im Spannungsfeld interkultureller pädagogischer Beziehungen (SiB)" wird gefördert durch den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
Vom 10. bis 12. November 2019 fand in Dresden ein internationaler Kongress statt, der sich der historischen Zäsur um 1989 ff. und ihrer Folgen annahm: Im Fokus standen die Pluralität und Heterogenität von Erwartungen, Erfahrungen und Erinnerungen – von 1989 bis in die Gegenwart. So wurde der Horizont über die klassische „Erfolgsgeschichte“ hinaus durch alternative Narrative und Differenzierungen erweitert. Die Frage nach den tiefgreifenden mentalen und emotionalen Vermächtnissen der (Ko-)Transformation sowohl in Deutschland wie auch in den ostmitteleuropäischen Nachbarländern sollte auch dazu anregen, über offenkundige Gegenwartsphänomene und -problematiken nachzudenken.
Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Integrationsstudien und dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (Dresden) lud alle Interessierten aus Wissenschaft und Öffentlichkeit ein, am Kongress teilzunehmen.
Das Programm finden Sie hier.
Bildergalerie

AT

Vortrag AT

Vortrag AT

Vortrag AT

Vortrag AT

Vortrag AT

Vortrag AT
Demokratiekonferenz Dresden 2019:
Filmvorführung "Bruderland ist abgebrannt" (1991) und Werkstattgespräch mit Angelika Nguyen
Am 9. November 2019 widmet sich die diesjährige Demokratiekonferenz der Frage „Friedliche Revolution gestern – Unfriedliche Demokratie heute?“, die in der Dresdner JohannStadthalle stattfinden wird. Die Konferenz wird maßgeblich von der LHS Dresden und dem Dresdner Geschichtsverein e. V. organisiert – das ZfI hat am Nachmittag einen Workshop angeboten. Im Workshop wurde explizit eine vietnamesisch-deutsche Perspektive auf die letzten 30 Jahre geworfen und diskutiert, wie die Wende erfahren wurde. Dazu lud das ZfI die Filmemacherin und Essayistin Angelika Nguyen ein und zeigte ihren Film „Bruderland ist abgebrannt“. Der Film entstand im Jahre 1991 und dokumentiert die Geschichte der Vertragsarbeiter*innen aus Vietnam nach dem Zusammenbruch der DDR, die daraufhin ihre Arbeit verloren. Das außerordentlich nahe und dichte Zeitdokument im Film blickt in das Berlin der 1990er Jahre, in denen die Menschen aus Vietnam nicht nur mit dem Verlust ihrer Arbeit, sondern auch mit dem Verlust von Bleibeperspektiven, täglichen Anfeindungen und der Gefahr rassistischer Gewalt zu kämpfen hatten.
- Film: Bruderland ist abgebrannt - 1991
- Gast: Angelika Nguyen, Filmemacherin und Essayistin
- Moderation: Noa Ha
Die Tagung geht aus von dem Befund, dass zwar eine Reihe von erprobten Ansätzen das Literarisch-Ästhetische in den Kontexten von DaZ fruchtbar machen wollen, diese in der Praxis aber nur einen geringen Einfluss gewonnen haben. Die Marginalität des Literarisch-Ästhetischen in DaZ liegt – so die These – an den sprach-, gesellschafts- und integrationspolitischen Rahmenbedingungen des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts, die ein instrumentelles, auf Eindeutigkeit, Kontrollierbarkeit und Testbarkeit ausgerichtetes Sprach- und Kulturverständnis voraussetzen und vorgeben.
Die Tagung will daher die Funktionen, die Potenziale und den Stellenwert literarischer Textualität und ästhetischer Medialität in DaZ-Kontexten mit Blick auf die sprach-, ge- sellschafts- und integrationspolitischen Rahmenbedingungen, Vorgaben und Zielsetzungen der (Zweit-)Sprach(en) vermittlung diskutieren; in der Überzeugung, dass es in dieser Diskussion um Grundfragen der Gestaltung der (Zweit-)Sprach(en)vermittlung in der bundesdeutschen Einwanderungsgesellschaft geht.
Weitere Informationen zu Konzept und Zielsetzung der Tagung finden Sie hier.
Datum und Ort
- 7.11.2019, 8:30-21:00 Uhr
8.11.2019, 9:00-17:00 Uhr -
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB)
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
Klemperer-Saal (1. OG)
Veranstalter, Partner, Förderer
Die Tagung wird von der Professur für Deutsch als Fremdsprache, Institut für Germanistik (Dr. Michael Dobstadt) und dem Zentrum für Integrationsstudien (Dr. Noa K. Ha, Dr. Karoline Oehme-Jüngling) der TU Dresden veranstaltet.
Kooperationspartner ist die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und das SLUB TextLab.
Tagung und Begleitprogramm werden mit der freundlichen Unterstützung
- der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
- der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und
- dem Lehrzentrum Sprachen und Kulturen der TU Dresden
gefördert.
Förderer
Programm
| Donnerstag | 7.11.19 |
| 08:00–09:30 | Begrüßungskaffee |
| 09:30–9:45 | Begrüßung Michael Dobstadt, Noa K. Ha, Julia Meyer (Dresden) |
| 09:45–10:30 |
Eröffnungsvortrag
|
| 10:30–12:30 |
Panel: Sprach- und Kulturreflexion I
|
| 12:30–14:00 | Mittagspause |
| 14:00–16:00 |
Panel: Sprachaufmerksamkeit/Bildungssprache
Moderation: Claudia Oechel-Metzner (Dresden) |
| 16:00–16:30 | Pause |
| 16:30–17:10 |
Panel: Spracherwerb
|
| 17:10–18:30 |
Panel: Sprach- und Kulturreflexion II
Moderation: Dorothea Spaniel-Weise (Jena) |
| 18:30–19:30 | Empfang |
| 19:30–21:00 |
Öffentliche Lesung und Publikumsgespräch
|
| Freitag | 8.11.19 |
| 09:00–10:00 | Begrüßungskaffee |
| 10:00–10:30 |
Öffentlicher Vortrag
|
| 10:30–12:00 |
Öffentliche Podiumsdiskussion
Moderation: Carolin Eckardt (Dresden) |
| 12:00–13:30 | Mittagspause |
| 13:30–16:10 |
Panel: Film/Graphic Novels/Musik
Moderation: Claudia Oechel-Metzner (Dresden) |
| 16:10–16:30 |
Abschluss |
| 16:30–17:00 | Abschlusskaffee |
Begleitprogramm
- Öffentliche Lesung mit der Autorin Sharon Dodua Otoo:
die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle
7. November 2019, 19:30-21:00 Uhr,
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB)
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
Klemperer-Saal (1. OG)
Weitere Informationen zur Lesung hier - Seminar „Literarische Textualität und ästhetische Medialität im Kontext DaZ“ an der TU Dresden/Institut für Germanistik im WiSe 2019/2020 von Dr. Michael Dobstadt in Zusammenarbeit mit Dr. Julia Meyer vomSLUB TextLab; sie wird im Rahmen des Seminars einen Workshop zum Kreativen Schreiben anbieten.
Weitere Informationen zur Lesung hier
Anmeldung
Zur Anmeldung nutzen Sie bitte dieses Anmeldeformular. Der Anmeldeschluss wurde verlängert; die Anmeldung ist bis zum 4. November 2019 geöffnet.
Zielgruppe
Die Tagung richtet sich an Interessierte aus der Fachcommunity (insbes. Germanistik, DaF/DaZ), der Integrationspraxis und -politik, an Lehrkräfte der Fächer Deutsch und Deutsch als Zweitsprache (vor allem) aus Sachsen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Die Veranstaltung ist Teil des externen Fortbildungskatalogs des Landesamts für Schule und Bildung (EXT04601).
Materialien
Konzept und Zielsetzung
Die Tagung geht aus von dem Befund, dass es zwar eine Reihe von erprobten Ansätzen, Konzepten sowie didaktischen Vorschlägen gibt, das Literarisch-Ästhetische in den Kontexten von DaZ fruchtbar zu machen (siehe z.B. Belke/Belke 2006; Belke 2011; Schweiger 2014; Zierau/Kofer 2015; Gaul/Nagel 2016; Eder/Dirim 2017; Rösch 2017; DaZ-Sekundarstufe 3/2017; Steinbrenner 2018; Wieler 2018; Wildemann 2018; Moraitis 2018), diese aufs Ganze gesehen in der Praxis aber einen nur verhältnismäßig geringen Einfluss gewonnen haben. Dies liegt – so die These – ganz wesentlich an den sprach-, gesellschafts- und integrationspolitischen Rahmenbedingungen des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts, die sich an einem instrumentellen, auf Eindeutigkeit und Testbarkeit ausgerichteten Sprach- und Kulturverständnis orientieren (siehe z.B. das Rahmencurriculum für einen bundesweiten Integrationskurs, Goethe-Institut 2016). Literarischer Textualität und ästhetischer Medialität, die, anstatt Bedeutungen zu fixieren, Reflexionsräume zu öffnen suchen (Hofmann 2006), und nur „schwer messbare Kompetenzen“ (Frederking 2008) vermitteln, kann im Kontext eines solchen Sprach- und Kulturverständnisses kein systematischer Stellenwert im Prozess des Erwerbs sprachlich-kultureller Handlungsfähigkeit zukommen.
Wenn allerdings zutrifft, dass gelingende Integration Fähigkeiten zum „Umgang mit Pluralität, mit Ambiguität, mit Vielfältigkeit und Vieldeutigkeiten“ (Foroutan 2018) erfordert, stellt sich die Frage nach der Funktionalität literarischer Textualität und ästhetischer Medialität im Kontext DaZ neu. Denn literarische Texte und ästhetische Medien vermögen, entsprechende methodisch-didaktische Konzepte vorausgesetzt, sprachliche und kulturelle Komplexität und Mehrdeutigkeit zugänglich zu machen (Kramsch 2006), und zwar schon auf Grundstufenniveau. Außerdem können Lernende mit ihrer Hilfe das „full meaning making potential of language“ (ebd.) entdecken und sich auf diese Weise eine wichtige Ressource für den Prozess ihrer sprachlichen Ermächtigung erschließen.
Zu diskutieren ist allerdings, inwieweit eine solche Funktionalisierung literarischer Textualität und ästhetischer Medialität mit dem den DaZ-Unterricht weithin bestimmenden Sprach- und Kulturverständnis vereinbar ist beziehungsweise – weitergehend – ob sie nicht sogar ein anderes Verständnis von Integration impliziert als das derzeit stillschweigend zugrundegelegte einer Assimilation an eine als normativ gedachte (National-)Sprache und (Leit-)Kultur (vgl. Dirim 2010; Czollek 2018): Eines, das diese vielmehr als kreativ-poetische Mitgestaltung einer „vielheitlichen Gesellschaft“ (Terkessidis 2017) interpretiert.
Der Ansatz der Tagung besteht mithin darin, die Funktionen, die Potenziale und den Stellenwert literarischer Textualität und ästhetischer Medialität in DaZ-Kontexten vor dem Hintergrund der und mit Blick auf die sprach-, gesellschafts- und integrationspolitischen Rahmenbedingungen, Vorgaben und Zielsetzungen der (Zweit-)Sprach(en)vermittlung zu diskutieren; und damit den Umgang mit Literatur und ästhetischen Medien in DaZ in einem Spannungsfeld zu verorten, in dem es um die Grundfragen der Orientierung und Gestaltung der (Zweit-)Sprach(en)vermittlung in den deutschsprachigen Einwanderungsgesellschaften geht.
Literatur:
Belke, Eva; Belke, Gerlind (2006): Das Sprachspiel als Grundlage institutioneller Sprachvermitt-lung: Ein psycholinguistisch fundiertes Konzept für den Zweitspracherwerb. In: Peschel C.; Becker, T. (Hrsg.): Gesteuerter und ungesteuerter Grammatikerwerb. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 174-200.
Belke, Gerlind (2011): Literarische Sprachspiele als Mittel des Spracherwerbs. In: Fremdsprache Deutsch 44, 15-21.
Czollek, Max (2018): Desintegriert Euch! München: Hanser.
DaZ-Sekundarstufe 3/2017: Literatur und Sprache.
Dirim, İnci (2010): „Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent denkt oder so.“ Zur Frage des (Neo-)Linguizismus in den Diskursen über die Sprache(n) der Migrationsgesellschaft. In: Mecheril, Paul u.a. (Hrsg.): Spannungsverhältnisse. Assimiliations-diskurse und interkulturell-pädagogische Forschung. Münster: Waxmann, 91- 114
Eder, Ulrike; Dirim, İnci (Hrsg.) (2017): Lesen und Deutsch lernen. Wege der Förderung früher Literalität durch Kinderliteratur. Wien: Praesens.
Foroutan, Naika (2018): Neue Achse der politischen Unterschiede. Marcus Pindur im Gespräch mit Naika Foroutan. In: Tacheles, 19. 05. 2018. https://www.deutschlandfunkkultur.de/integrationsdebatte-neue-achse-der-politischen-unterschiede.990.de.html?dram:article_id=418329.
Frederking, Volker (2008): Schwer messbare Kompetenzen. Herausforderungen für die empirische Fachdidaktik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Gaul, Magnus; Nagel, Eva (2016): Sprache lernen durch Singen, Bewegung und Tanz. Kassel: Bosse.
Goethe-Institut (2016): Rahmencurriculum für Integrationskurse Deutsch als Zweitsprache. München.
Hofmann, Michael (2006): Interkulturelle Literaturwissenschaft. Eine Einführung. München: Fink.
Kramsch, Claire (2006): From Communicative Competence Competence to Symbolic Competence. In: The Modern Language Journal 90/2, 249-252.
Moraitis, Anastasia u.a. (Hrsg.) (2018): Sprachförderung durch kulturelles und ästhetisches Lernen. Sprachbildende Konzepte für die Lehrerausbildung. Münster: Waxmann (= Sprach-Vermittlungen Band 20).
Rösch, Heidi (2017): Literaturunterricht und sprachliche Bildung. In: Beate Lütke u.a. (Hrsg.): Fachintegrierte Sprachbildung: Forschung, Theoriebildung und Konzepte für die Unterrichtspraxis. Boston, 151-168.
Schweiger, Hannes (2014): Begegnung mit Vielfalt. Sprachliches und kulturelles Lernen mit Literatur im Fremd- und Zweitsprachenunterricht. In: Deutsch als Fremdsprache 51/2, 76-85.
Steinbrenner, Marcus (2018): Sprachliche Bildung, Bildungssprache und die Sprachlichkeit der Literatur. In: Leseräume 4, 7–21.
Terkessidis, Mark (2017): Nach der Flucht. Neue Ideen für die Einwanderungsgesellschaft. Stuttgart: Reclam.
Wieler, Petra (2018): Sprachlich-ästhetische Literaturerfahrung als Beitrag zur Identitäts- und Sprachentwicklung jüngerer Kinder. In: Leseräume 4, 35-48.
Wildemann, Anja (2018): Alltagssprache – Lyrische Sprache – Bildungssprache: Zur Bedeutung des Lyrischen für die Entwicklung von (Bildungs-)Sprachlichkeit. Leseräume 4, 22–34.
Zierau, Cornelia; Kofer, Martina (2015): Literatur in der Sprachförderung – Überlegungen zu einer Neuorientierung im Sprach- und Literaturunterricht am Beispiel von Wolfgang Herrendorfs Adoleszenzromen „Tschick“. In: Deutsch als Fremdsprache 52/1, 3-13.
Referierende: Abstracts und Kurz-CVs
Alle Infos und Abstracts der Referierenden hier
Fotos
TU Dresden, Friday, October 25th, 2019
CONCEPT AND LEADING QUESTIONS: Fatima El-Tayeb (UC San Diego) and Noa K. Ha (TU Dresden)
In this workshop, we aim to bring together several related, but often separate, discourses around the question of the (present) legacies of socialism and colonialism in East Germany, and Eastern Europe more general. Both socialism and colonialism are exiled from dominant (West) European narratives, relegated to the past and spatially to the East and the formerly colonized regions. We are interested in scholarship and activism that challenges this compartmentalization by applying post- and decolonial as well as critical race theory to pre- and post-1990 Europe (East and West), by using postsocialist studies to analyze the relationship between the different parts of Europe and both to complicate the notion that Eastern Europe has been “colonized” by the West after the fall of the Soviet Empire.
Among the questions we are interested in addressing are:
- How is the legacy of European colonialism (not) remembered in the continent’s East and West?
- What are the limits of a decolonial approach to Europe largely based on the Western European experience?
- How can critical race theory fruitfully be applied to processes of racialization in Eastern Europe?
- Can a creolization of postsocialist and postcolonial studies produce an analysis of contemporary Europe attentive to the intersectional vectors of global racial capitalism?
Friday, 25th October
9:00 Panel I: Constructing ‘Race’ in the Socialist and Postsocialist East
Understanding the construction of race as a constitutional founding moment of modernity – according to decolonial theorists such as Mignolo, Grosfoguel and others – racism as such is not confined to the west and/or western societies but relevant for eastern societies too. As such this panel addresses the specific rendering of the racialized Other within cultures of memory for the socialist context and its aftermath.
- Adem Ferizaj, Sciences Po, Paris, "Othering Albanian Muslim masculinities: a case study of Albanian football players"
- Darja Klingenberg, Goethe University Frankfurt, "Conformism and Resilience of Marginalised Middle Classes. Dynamics of remembering and silencing among Russian Speaking Jewish Migrants in a German Post- Migrant Society"
Commentary: Patrice Poutrus, University Erfurt
10:15 Coffee Break and Screening Anna Dasovic
10:40 Panel II: Constructing the East in the West
This panel brings scholars into conversation who have studied cultures of memory in western societies, such as the Netherlands and Switzerland, and specifically speak about the omission and construction of the ‘East’ within Western knowledge production.
- Anna Dasovic, Independent Artist, Amsterdam: "Before the Fall there was no Fall. Thinking and acting between preenactment and reenactment"
- Patricia Schor, Radboud University Nijmegen: “Figures of Race in Western Modernity: Blacks, Jews and Muslims"
- Noémi Michel, University of Geneva: "Black antiracism in Europe: an insurgent archive"
Commentary: Doreen Mende, Genève
12:10 Lunch Break
13:10 Panel III :Memory Politics of Socialist and Colonial Modernity (in Postsocialist Contexts)
Socialist and colonialist momentums are at play within cultures of memory and shape struggles of definition and belonging for local and national narratives. Therefore, this panel looks at theses politics of memory and critically reviews the making of histories of local and national (modern) identity.
- Miriam Friz Trzeciak | Manuel Peters, BTU Cottbus: "Provincializing Cottbus – A Reflection of Postcolonial and Postsocialist Entanglements in the Case of Local Sites of Remembrance"
- Gal Kirn, TU Dresden: “Postsocialist Transition: Othering of Socialism and Memorial Revisonism”
- Urs Lindner, University Erfurt: "The Erfurt Hetzjagd of 1975: Postcolonial Interrogations"
Commentary: Noa Ha, TU Dresden
14:40 Coffee Break
14:50 Panel IV: Intersectionality and Citizenship in Post-socialist Nation-states
The nation-state constructs, regulates and defines citizens through the access to citizenship in its various dimensions of social and cultural life, such as gender, race, ethnicity, disability, sexuality and religion. Within the process of transformation of post-socialist nation-states these intersections are eventually mobilized to define access to or exclusion from citizenship.
- Manuela Boatcă, University Freiburg: "Coloniality of Citizenship and Occidentalist Epistemology"
- Piro Rexhepi, Northampton Community College, US: "Confronting Postsocialist Colorblindness: Queer Imaginaries and Intersectional Solidarities along the Balkan Route"
- Catherine Baker, University of Hull (virtual presence): “The Yugoslav Wars and contemporary racialised Islamophobia”
Commentary: Fatima El-Tayeb, UC San Diego
16:20 Coffee Break
16:30 Joint Discussion
Perspectives for a research network, next steps.
17:40 End
Veranstaltungsreihe: April bis Oktober 2019
Die Zahl rassistischer Übergriffe ist nach einem massiven Anstieg wieder gesunken. Dennoch bleiben rassistische Gewalt und rassistische verbale Verletzungen weiterhin bestehen und machen nicht vor dem Campus halt. Daher: Rassismus geht uns alle an - doch was tun? Die Veranstaltungen von „Courage: Wissen, Sehen, Handeln!“ geben darauf Antworten und bieten Handlungsoptionen an.
Wissen! Was ist Rassismus? Wie macht er sich bemerkbar? In welchen Kontexten tritt er auf? Welche Geschichte hat Rassismus? Was kann eine Universität gegen Rassismus tun? Die Vorträge von und Diskussionen mit Expert*innen helfen Rassismus zu erkennen und zu verstehen.
Sehen! Wie wird Rassismus in Kunst und Kultur verhandelt? Kann Kunst und Kultur denjenigen eine Stimme geben, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind? Welche Denkprozesse kann (nur) die künstlerisch-kulturelle Praxis anstoßen? Zahlreiche Kulturveranstaltungen in Kooperation mit Dresdner Kunst- und Bildungsinstitutionen laden zu einem Perspektivwechsel ein.
Handeln! Was kann ich tun, wenn ich Opfer oder Zeuge*Zeugin eines rassistischen Übergriffs werde? Was darf ich tun? Wie argumentiere ich schlagfertig gegen rechte Parolen? Wie gehe ich als Betroffene*r mit Rassismus um? Workshops geben Antworten und praktische Tipps.
Teil der Veranstaltungsreihe ist in diesem Jahr war die Ringvorlesung "Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie?"
Die Veranstaltungsreihe umfasste 2019 folgendes Programm:
Referent*in: Prof. Dr. María do Mar Castro Varela (Alice-Salomon-Hochschule Berlin )
Termin: 10.04.2019, 18:30-20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
„Nicht umsonst rühmt sich der Halbgebildete seines schlechten Gedächtnisses, stolz auf seine Vielbeschäftigtheit und Überlastung.“ (Theodor W. Adorno)
Es hat lange gedauert, bis die Bundesrepublik Deutschland sich offiziell als Einwanderungsland verstanden hat. Viele halten dies für einen Fehler, andere für eine realistische Einschätzung und wieder andere für eine Utopie. De facto leben in der Bundesrepublik, wie in jeder Demokratie, Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit differenten Vorlieben und diversen Einschränkungen und Möglichkeiten. Es ist ein Kennzeichen einer Demokratie, dass die Diversität der Bürger_innen nicht nur toleriert wird, sondern aktiv daran gearbeitet wird, dass allen die Möglichkeit zur politischen und sozialen Teilhabe eröffnet wird. Pädagogik kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion zu: Wie ermöglicht es Schule, Schüler_innen als mündige Bürger_innen zu formen? Welches Wissen benötigt die Schule, um die Demokratie zu stärken und einen ethischen Aktivismus zu befördern?
Der Vortrag versteht sich als Plädoyer für eine ethische Bildung.
- Kommentar: Anne Lenk & Melanie Pißner (Ausländerrat Dresden e.V., Projekt "Genzen überwinden")
- Moderation: Anna Nikolenko (LAG pokuBi Sachsen e.V.)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Termin: 11.04.2019; 13:00-17:00 Uhr
Ort: 101. Oberschule "Johannes Gutenberg", Pfotenhauerstraße 42, 01307 Dresden, lila Foyer in der 2. Etage
Praxiswerkstatt mit Beiträgen von:
Svenja Hoßbach, Anne Lenk
Welches Wissen wird gelehrt? Umgang mit deutscher Kolonialvergangenheit im Schulbuch
Die Referentinnen werden die Ergebnisse ihrer Analyse eines Geschichtsschulbuchs der 10. Klasse (Gymnasium) vorstellen. Sie untersuchten die Reproduktion impliziter und expliziter Rassismen mit Fokus auf die Darstellung des deutschen Kolonialismus. Es wird betrachtet welche historische Text- und Bildmaterialien im Schulbuch zu finden sind und in welchem Kontext sie stehen. Die Anwendung im Buch beschriebener Aufgabenstellungen soll im Hinblick auf Anforderungen an die Lehrer*innenausbildung diskutiert werden.
Henriette Hammer, Sonja Müller, Lea Piekatz
Wer gehört dazu? Dominanzkultur und Rassismus in sächsischen Lehrplänen
Unter rassismuskritischer Perspektive soll gefragt werden, welches jeweils gültige Wissen in sächsischen Lehrplänen am Beispiel des Fachs Ethik in Grundschulen an die kommenden Generationen weitergeben werden soll. Ein Fokus liegt dabei auf dem darin vermittelten Verständnis von migrationsgesellschaftlichen Zugehörigkeitsverhältnissen und -ordnungen.
Irina Grünheid
Schulbuch-Macht-Subjekte
Welche Resonanzen entwickeln Repräsentationen aus Schulbüchern im Unterricht? Was lernen Schüler*innen mit Hilfe von Schulbüchern über die gesellschaftlichen Zugehörigkeitsordnungen und über ihre eigene soziale Position? Im Rahmen des Vortrags werden Ergebnisse eines Forschungsprojekts mit dem Fokus auf die Verwendung von Schulbüchern an der Grundschule und Effekte migrationsgesellschaftlich relevanter Inhalte für das Unterrichtsgeschehen und für die Schulischen Akterur*innen vorgestellt.
im Anschluss:
Werkstatt-Arbeit mit den Teilnehmenden mit Fokus auf pädagogische Praxis und Konsequenzen für mehr Teilhabe
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis zum 03. April 2019 unter oder telefonisch unter (0351) 850 75 162 an.
Referent*in: Prof. Dr. Paul Mecheril (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Termin: 17.04.2019, 18:30-20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
Können Konzepte "inklusiver Pädagogik" der Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Migration und Bildung einen "post-ausländerpädagogischen" und mithin angemesseneren Weg weisen? Durch die UN-Behindertenrechtskonvention hat auch in Deutschland die Diskussion um das Thema Inklusion an großer Intensität gewonnen und kann als eine der zentralen Bezugspunkte gegenwärtiger schulpädagogischer Bildungsdebatten und Reformdiskussionen verstanden werden. Einer am Ideal der Inklusion orientierten Schule geht es um die Erweiterung und Differenzierung der Resonanzverhältnisse zwischen den (migrations)gesellschaftlich vermittelten Bildungsdispositionen der Schülerinnen und den Bildungserwartungen und -angeboten der Schule: je mehr Resonanz, desto mehr Möglichkeitsräume für Lern- und Bildungsprozesse. Was dies heißen kann, möchte ich in meinem Vortrag erkunden, nicht ohne dabei, erstens eine Kritik der gegenwärtigen Praxis wie auch der allgemeinen Programmatik der Inklusion zu streifen und vor diesem Hintergrund zweitens die Frage nach der angemessenen normativen Ausrichtung des Begriffs inklusiver Bildung zu diskutieren.
- Kommentar: Juliana Dressel-Zagatowski (Leiterin 101. Oberschule Dresden, Mitinitiatorin der Initiative "Lernquartier Johannstadt 2022“)
- Moderation: Dr. Noa K. Ha (TU Dresden)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Termin: 18.04.2019; 13:00-17:00 Uhr
Ort: Rathaus Dresden, Raum 3/200, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Praxiswerkstatt mit Beiträgen von:
René Breiwe
Rahmenbedingungen diversitätsreflexiver Bildung im deutschen Schulsystem – Über die Bedeutung der deutschen Schulgesetze für inklusiv und diskriminierungskritisch orientierte Transformationsprozesse von Schule im Rahmen migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse
Im Beitrag wird diskutiert, inwiefern die deutschen Schulgesetze als Ausdruck bestehender Ordnungen und als zentrales (rechtliches) Steuerungsinstrument im föderalen Bildungssystem ein verkürztes Verständnis von Diversität aufzeigen und einen Beitrag dazu leisten, insbesondere im Rahmen migrationsgesellschaftlicher Verhältnisse Differenzordnungen hegemonial zu (re-)produzieren. Ein besonderer Blick erfolgt dabei auf inklusionsbezogene Aussagen, anhand derer die im Vortrag von Prof. Dr. Paul Mecheril aufgeworfene "Kritik der gegenwärtigen Praxis" der Inklusion diskutiert wird. Demgegenüber werden die Notwendigkeit eines postkategorialen Antidiskriminierungsrechts sowie die Reflexion der Konstruktion sozialer Ordnungskategorien und institutioneller bzw. struktureller Herstellungsmechanismen von Ungleichheitsordnungen als Voraussetzung für Veränderungsprozesse in Richtung diskriminierungskritischer Bildung und der Partizipation Aller in den Blick genommen. Ein besonderer Fokus wird dabei im Vergleich und Abgrenzung zu anderen Schulgesetzen auf das (reformierte) sächsische Schulgesetz gerichtet.
Sotiria Midelia
Diskriminierungsschutz an sächsischen Schulen
Diskriminierung an sächsischen Schulen ist Realität. Das sächsische Schulgesetz sieht keinen expliziten Diskriminierungsschutz für Schüler_innen vor. Aus Perspektive des Antidiskriminierungsbüros Sachsen braucht es ein explizites Diskriminierungsverbot im sächsischen Schulgesetz, um die rechtlichen Schutzlücken zu schließen und einen effektiven Diskriminierungsschutz im Schulgesetz etablieren zu können. Wir wollen u.a. den Fragen nachgehen, wie wirksame Unterstützungsstrukturen für Betroffene aussehen und wie Maßnahmen im Sinne eines effektiven Diskriminierungsschutzes umgesetzt werden können.
im Anschluss:
Werkstatt-Arbeit mit den Teilnehmenden mit Fokus auf pädagogische Praxis und Konsequenzen für mehr Teilhabe
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis zum 11. April 2019 unter oder telefonisch unter (0351) 850 75 162 an.
Referent*in: Dr. Mai-Anh Boger (Universität Paderborn)
Termin: 08.05.2019; 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
In verschiedenen pädagogischen Teildisziplinen hat man sich mit der Frage befasst, was es für eine differenzsensible Professionalisierung braucht. Bis dato wurden die Ansätze aus geschlechter-, migrations-, und behinderungsbezogenen Feldern jedoch häufig sehr getrennt voneinander abgehandelt. Im Vortrag wird herausgearbeitet, welches gemeinsame Grundverständnis heterogenitätssensibler Pädagogik erscheint, wenn man diese Teildisziplinen zusammenführt und vergleicht.
- Kommentar: Prof. Dr. Anke Langner (TU Dresden)
- Moderation: Sotiria Midelia (Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V.)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Referent*in: Prof. Dr. Karim Fereidooni (Ruhr-Universität Bochum)
Termin: 22.05.2019, 17:00-18:30 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0004/H
In seinem Vortrag geht Prof. Dr. Karim Fereidooni auf ausgewählte Ergebnisse seiner Dissertation mit dem Titel "Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Referendar*innen und Lehrer*innen mit Migrationshintergrund‘" ein. Im Fokus des Vortrags steht die folgende Frage: "Warum ist es nach wie vor schwierig über Rassismus(erfahrungen) in Gesellschaft und Schule zu sprechen?"
- Kommentar: Suene Dantas (Support für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt)
- Moderation: Dr. Noa K. Ha (TU Dresden)
Diese Vorlesung kann leider nicht als Webinar angeboten werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Termin: 23.05.2019; 13:00-17:00 Uhr
Ort: Rathaus Dresden, Raum 3.13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Praxiswerkstatt mit Beiträgen von:
Juliane Dieckmann
Pädagogisches Schutzkonzept oder persönlicher Einsatz Einzelner?
Gemeinsame Aufgabe von Schule und Schulsozialarbeit ist, dass Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlichen (§1 (5) Sächsisches Schulgesetz und § 1 (1) SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe) Menschen heranwachsen. Dieser Aufgabe stellt sich Schule tagtäglich in verschiedensten Situationen. Oft ist es vom individuellen Engagement der Lehrer*innenpersönlichkeiten und der Kooperation mit Sozialarbeiter*innen abhängig, wie intensiv das Lernen in „sozialer Gemeinschaft“ (ebd.) unabhängig vom Lehrcurriculum forciert wird. Es gibt ein großes Interesse, Klassen als kleine soziale Gemeinschaften zu begreifen und ihnen in dieser Einheit einen Lernraum für kommunikative Kompetenz und Konfliktfähigkeit zu ermöglichen. Die Methoden die PädagogInnen dabei gemeinsam entwickeln sind kreativ und vielfältig. Können Schutzkonzepte diesen wertvollen Einzelinitiativen einen Rahmen bieten?
Robert Enge
Wie das Benennen von (rassistischer) Diskriminierung heilend wirken kann
In diesem Statement werden die Herausforderungen skizzieren, in der sich Kinder und Jugendliche befinden, die im Kontext Schule rassistische Gewalterfahrungen machen.
Darüber hinaus wird er - gerade angesichts des Mangels in Schule - Interventionen aufzeigen, die heilend und unterstützend wirken können.
Sotiria Midelia
Wie kann eine gelebte Antidiskriminierungskultur im Kontext Schule gelingen?
Schule ist kein rassismusfreier Raum – was höchstproblematisch ist, weil die Schulzeit eine prägende Lebensphase ist. Anders als im Arbeitsbereich ist im Bildungsbereich die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Umfeldes weit weniger klar bzw. gar nicht geregelt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Welche rassismuskritischen Interventionen und Handlungsansätze gibt es, um Rassismus entgegenzuwirken? Was brauchen Schüler_innen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, an Unterstützung/-strukturen?
im Anschluss:
Werkstatt-Arbeit mit den Teilnehmenden mit Fokus auf pädagogische Praxis und Konsequenzen für mehr Teilhabe
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis zum 16. Mai 2019 unter oder telefonisch unter (0351) 850 75 162 an.
Referent*in: Univ.-Prof. Dr. İnci Dirim (Universität Wien)
Termin: 05.06.2019, 18:30-20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
Der Vortrag zeichnet die Entwicklung der Debatten und Regelungen über den Umgang mit Schüler_innen „mit Migrationshintergrund“, die sich Deutsch als Zweitsprache aneignen und in die monolingual deutschsprachigen Bildungssysteme aufgenommen werden, allgemein nach. Im Zentrum stehen die Entwicklungen in Westdeutschland/ dem heutigen Deutschland und in Österreich.
Dabei sollten folgende Schwerpunkte der Entwicklung sichtbar werden:
- 1960-er Jahre: Starke Fokussierung auf „Sprache“ nach Aufnahme der Kinder der Arbeitsmigrant_innen
- 1980-er Jahre: Teilweise programmatische Ablösung durch Fokussierung auf „Kultur“
- 2000-er Jahre: Neuerliche Konzentration auf Deutschvermittlung nach den PISA-Studien, großer forschungsgestützter Professionalisierungsschub (regional sehr unterschiedlich umgesetzt)
- 2010-er Jahre: Verquickung von Deutschvermittlung mit Migrationspolitiken
Interessanter Punkt: Die deutschsprachige Monolingualität der Bildungssysteme wird im Zuge dieser Entwicklungen beibehalten.
Im Vortrag wird auch auf Begriffe eingegangen, die zwar im Laufe der Zeit reflexiver geworden sind und weniger zuschreibend („Ausländer“ – Migranten“/MigrantInnen – „unsere Kinder“), dass aber nicht die gesamte Sicht auf die Situation der Schüler_innen sich damit gewandelt hat.
Beispiele, die eingebracht werden, ist ein Vergleich von Bezeichnungspraktiken in verschiedenen europäischen Ländern und der Wandel des Umgangs mit Sprachstandsdiagnosen in Österreich.
- Kommentar: Uta Reichel (Kompetenzzentrum sprachliche Bildung Dresden)
- Moderation: Dr. Carolin Eckardt (TU Dresden)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Referent*in: Saphira Shure & Dr. Anja Steinbach (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Termin: 19.06.2019, 18:30-20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
Die Frage danach, was Lehrer*innen eigentlich wissen und können soll(t)en, um unter migrationsgesellschaftlichen Bedingungen ‚angemessen‘ zu handeln, ist viel und kontrovers diskutiert. In dem Vortrag möchten wir einerseits aus rassismuskritischer und ableismuskritischer Perspektive über pädagogische Professionalität von Lehrer*innen nachdenken und andererseits die mit diesen Perspektiven verbundenen gesellschaftstheoretischen Überlegungen zur Verantwortung pädagogischen Handelns in der Schule zum Thema machen.
- Kommentar: Juliane Dieckmann (IN VIA Dresden e.V., Schulsozialarbeit)
- Moderation: Juri Haas (GEW Sachsen, Grundschullehrer)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Termin: 03.07.2019; Zeit wird noch bekannt gegeben
Ort: wird noch bekannt gegeben
Empowerment- und Vernetzungsraum, mitgestaltet von:
- Ely Almeida (LAG pokuBi Sachsen e.V./ Steinhaus Bautzen)
- Toan Quoc Nguyen (Bildungswerkstatt Migration und Gesellschaft, Berlin)
- Linh Tran (VSP e.V., Schulsozialarbeit)
Weitere Informationen folgen.
Für die Teilnahme an der Praxiswerkstatt laden wir lehrende und in Schule beschäftigte Personen mit Migrationsgeschichten, Personen, die Rassismuserfahrungen machen sowie migrierte Pädagog*innen ein.
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte melden Sie sich bis zum 25. Juni 2019 unter oder telefonisch unter (0351) 850 75 162 an.
Referent*in: Toan Quoc Nguyen
Termin: 03.07.2019, 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Hörsaalzentrum TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden, Raum HSZ/0003/H
Der Vortrag basiert vornehmlich auf der gleichnamigen Doktorarbeit, welche in einer qualitativen Erhebung Rassismus- Erfahrungen von Schüler*innen sowie ihre Handlungs- und Widerstandsstrategien untersuchte. Inhaltlich werden auf Basis der Erzählungen von befragten Jugendlichen Konzepte, wie z.B. Microaggressions oder das Community Cultural Wealth Konzept vorgestellt.
- Kommentar: Ely Almeida (LAG pokuBi Sachsen e.V., Steinhaus Bautzen) und Linh Tran (VSP e.V., Schulsozialarbeit)
- Moderation: Anna Nikolenko (LAG pokuBi Sachsen e.V.)
Dieser Vortrag findet im Rahmen der Ringvolesung Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft. Handelnde Teilhabe für alle, aber wie? statt.
Leiter: Peggy Piesche und Katja Kinder
Termin: 27.08.2019, 09:00-15:00 Uhr
Ort: Seminargebäude 1, Zellescher Weg 22, 01217 Dresden, Raum SE1-14
In diesem Workshop werden Kernkompetenzen bezüglich eines konstruktiven Umgangs mit Unterschieden, Konflikten und Fehlern gestärkt. Darüber hinaus wird ein ressourcenorientierter und wertschätzender Umgang mit Unterschieden gefördert sowie Wissen um Indikatoren zu Konflikten und Fehlern und um den Gebrauch diskriminierungskritischer Sprache vermittelt. Der Workshop möchte sich für eine diversitätsorientierte und diskriminierungskritische Organisationsentwicklung einsetzen und für eine effektive Konfliktprävention sensibilisieren.Eingebettet in einer gendertheoretischen und rassismuskritischen Perspektive werden Strategien eines konstruktiven Umgangs mit Themenbereichen erarbeitet, in denen sich vielfältige Diskriminierungsstrukturen überlagern.
Eine Anmeldung ist über das Zentrum für Weiterbildung (ZfW) möglich.
Leiter: Rico Schwibs
Termin: 19.09.2019, 9:00-15:00 Uhr
Ort: Seminargebäude 1, Zellescher Weg 22, 01217 Dresden, Raum SE1-25
In diesem Workshop sollen die Teilnehmenden lernen, wie man selbstbewusster in der Öffentlichkeit auftreten kann und Ängste und Unsicherheiten abgebaut werden können. Es werden Handlungsmöglichkeiten vermittelt, um leichter Zivilcourage in der Öffentlichkeit leisten zu können. Darüber hinaus werden gewaltfreie Auswege aus Konfliktsituationen aufgezeigt und Hintergrundwissen über Zivilcourage und Konfliktbewältigung vermittelt. Methodisch wird der Workshop zum einen praktisch via Stop-und Schrei-Übungen sich dem Themenfeld Zivilcourage in der Öffentlichkeit nähern, zum anderen aber auch über gemeinsamen Austausch von Erfahrungen und verschiedenen Situationsanalysen theoretisch angeleitet. Inhaltlich wird nach verschiedenen Arten von Gewalt gefragt und thematisiert, wie man Zivilcourage befördern kann und welche Aspekte diese vielfach hemmen. Außerdem wird gefragt, wie ich mich in gefährlichen Situationen gewaltfrei schützen kann.
Eine Anmeldung ist über das Zentrum für Weiterbildung (ZfW) möglich.
Referentin: Prof. Dr. Naika Foroutan (Humboldt-Universität zu Berlin)
Termin: 25.09.2019; 15:30-16:00 Uhr
Ort: TU Dresden, Bergstr. 53, 01069 Dresden, Von-Gerber-Bau, Raum: GER/038
n.n.
Referenten: Petra Köpping, Max Czollek, Aladin El-Mafaalani
Termin: 25.09.2019, 16:00-17:00 Uhr
Ort: TU Dresden, Bergstr. 53, 01069 Dresden, Von-Gerber-Bau, Raum: GER/038
Moderation: No K. Ha
n.n.
Leiter: Robert Enge
Termin: 02.10.2019, Uhrzeit 9:00-15:00 Uhr
Ort: Seminargebäude 1, Zellescher Weg 22, 01217Dresden, Raum SE1-24
In diesem Workshop geht es um einen fachlichen Austausch zwischen den einzelnen Fachkräften, die im universitären Kontext beratend tätig sind. Vor allem die Unterstützung von Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden, die möglicherweise von Diskriminierung oder rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen sind bzw. potentiell gefährdet sind, steht im Vordergrund des Workshops. Der Referent wird einen Einblick in die Arbeit der Fachberatungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt geben. Arbeitsschwerpunkte und Herausforderungen des entsprechenden Beratungsfelds sollen im Laufe der Veranstaltung skizziert werden. Die Inhalte sollen den Teilnehmenden Handlungssicherheit, vor allem in ihrem jeweiligen Beratungsalltag, vermitteln.
Inhaltliche Themenfelder:
- Fachlicher Austausch
- Wissenstransfer
- Netzwerk
- Vertiefung und Erweiterung eigener Handlungskompetenzen
- Interventionsstrategien
Eine Anmeldung ist unter diesem Link möglich.
Leitung: Sebastian Seelig
Termin: 08.10.2019; 10:00-18:00 Uhr
Ort: Seminargebäude 1, Zellescher Weg 22, 01217Dresden, NEU: Raum SE1-24
Wie entsteht und wirkt Menschenfeindlichkeit (z.B. Rassismus, Homophobie, ...)? Der Workshop will typische Interventionen bei menschenfeindlichen Äußerungen und deren Chancensowie Risiken aufzeigen. Außerdem soll eine Anwendung auf eigene und modellhafte Beispiele vollzogen werden. Ziel des Workshops ist es, das Handlungsrepertoire im Umgang mit menschenfeindlichen Äußerungen zu erweitern.
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Typische Interventionen bei menschenfeindlichen Äußerungen und deren Chancen sowie Risiken
- Anwendung auf eigene und modellhafte Beispiele
Methoden:
- Theoretischer Input
- Konkrete mitgebrachte oder modellhafte Situation im Rollenspiel praktisch beleuchten
Eine Anmeldung ist über das Zentrum für Weiterbildung (ZfW) möglich.
Die Veranstaltungsreihe, die mit Workshops, Vorträgen, Gesprächen und Kulturprogramm Angehörige der TU Dresden für den Umgang mit Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus sensibilisierte und empowern wollte – fand im Zeitraum Mai bis Oktober 2019 statt. Die Veranstaltungsreihe wurde vom Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden organisiert.
Die Veranstaltenden behielten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.
Ringvorlesung und Praxiswerkstätten im Sommersemester 2019: "Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft" - Handelnde Teilhabe für alle, aber wie?
Die Schulen in Dresden und Sachsen stehen vor der Aufgabe, inklusive Schulen zu werden, das heißt das Recht aller Schüler*innen auf diskriminierungsfreie Bildung zu realisieren. Die Institution Schule in der Migrationsgesellschaft ist damit herausgefordert, bestehende Ordnungen, Routinen sowie das Verhältnis zwischen Voraussetzungen der Schüler*innen und institutionellen Erwartungen und Angeboten zu überprüfen und anzupassen. Die Situation an den Schulen ist jedoch durch einen gravierenden strukturellen Mangel an Lehrpersonal und Ressourcen gekennzeichnet, der die bisherige Bewältigung des Schulalltags eher erschwert anstatt die neuen Herausforderungen zu unterstützen.
Im Rahmen der Ringvorlesung sind Wissenschaftler*innen eingeladen zur Frage zu referieren, was es bedeutet, die Schule in der Migrationsgesellschaft als einen inklusiven Ort zu verstehen. Durch ergänzende Kommentierungen von lokalen Praxisakteur*innen soll diskutiert werden, wie aus der Situation des strukturellen Mangels Veränderungsprozesse in Richtung diskriminierungsfreier Bildung und handelnder Teilhabe für alle angestoßen und realisiert werden können.
Die Ringvorlesung steht dem wissenschaftlichen Fachpublikum und der interessierten Praxisöffentlichkeit offen und kann voraussichtlich darüber hinaus virtuell im Rahmen eines Online-Ringvorlesung verfolgt werden.
Die Vorlesungsreihe wird ergänzt von vier Praxiswerkstätten, um gemeinsam die vorgestellten Analysen in Hinsicht auf konkrete Handlungsfelder für eine Schule in der Migrationsgesellschaft zu diskutieren, zu reflektieren sowie Handlungsansätze und nachhaltige lokale Arbeitsstrukturen zu entwickeln.
Programm
Im Folgenden finden Sie das Programm der Veranstaltungen zu Inklusive Schule in der Migrationsgesellschaft - Handelnde Teilhabe für alle, aber wie?
Weitere Informationen und Abstracts zu den Vorlesungen und Praxiswerkstätten finden Sie hier.
| Vorlesung 1 10. April 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
Braucht Schule in der Migrationsgesellschaft ein spezifisches Wissen? |
| Praxiswerkstatt 11. April 2019 13:00 - 17:00 Uhr |
Praxiswerkstatt SchulWissen |
| Vorlesung 2 17. April 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
Die Illusion der Inklusion. Migrationspädagogische Überlegungen |
| Praxiswerkstatt 18.04.2019 13:00 - 17:00 Uhr |
Praxiswerkstatt SchulStruktur |
| Vorlesung 3 08. Mai 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
Ambivalenztoleranz als Kernkompetenz in inklusiven Schulen |
|
Vorlesung 4 |
Rassismus im System Schule |
|
Praxiswerkstatt |
Praxiswerkstatt SchulKultur |
| Vorlesung 5 05. Juni 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
Vom Defizit zur Bedrohung - Mehrsprachigkeit und Deutschförderung als Verhandlungsmassen der Migrationspolitik -> entfallen! Nachholtermin: 04. Juli 2019 (nur als Webinar) |
| Vorlesung 6 19. Juni 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
"Je unterschiedlicher die Schüler sind, desto unterschiedlicher sind natürlich auch die Probleme, die sie mit sich bringen“ - Kritische Anfragen an pädagogische Selbstverständlichkeiten in der Schule der Migrationsgesellschaft |
| Praxiswerkstatt, Empowerment, Vernetzung 03. Juli 2019 13:00 - 17:00 Uhr |
Empowerment- und Vernetzungsraum |
| Vorlesung 7 03. Juli 2019 18:30 - 20:00 Uhr |
"Outside the box" - Rassismuserfahrungen und Empowerment von Schüler*innen of Color |
|
Nachholtermin |
Vom Defizit zur Bedrohung - Mehrsprachigkeit und Deutschförderung als Verhandlungsmassen der Migrationspolitik Vortrag: Prof. Dr. İnci Dirim Kommentar: Uta Reichel Moderation: Dr. Carolin Eckardt Die Veranstaltung findet nur als Webinar statt! |
Das Programm erscheint auch als Flyer sowie als Plakat und ist als pdf zu Ihrer Verwendung abrufbar.
Konzeption und Durchführung
Eine gemeinsame Veranstaltung von:
-
Landesarbeitsgemeinschaft politisch-kulturelle Bildung Sachsen e. V. (LAG pokuBi) - Projekt »Migration-Flucht-Bildung. Bildungsorte einer sich öffnenden Stadt«
-
Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden (ZfI)
VERANTWORTLICHE MITARBEITER*INNEN:
Noa K. Ha, Anna Nikolenko, Karoline Oehme-Jüngling
Irina Grünheid, Bozzi Schmidt
Carolin Eckardt, Rico Ehren, Almut Gelenava, Nora Zeising, Huda El Husein
IN Kooperation mit:
-
Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen
-
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband Sachsen
-
CMC - Center for Migration, Education and Cultural Studies der Universität Oldenburg
-
Antidiskriminierungsbüro (ADB) Sachsen e. V.
-
Ausländerrat Dresden e. V., Projekt ‚Grenzen überwinden'
-
IN VIA Katholischer Verein für Mädchen- und Frauensozialarbeit Diözesanverband Dresden-Meißen e.V.
-
Landeshauptstadt Dresden - Geschäftsbereich Bildung und Jugend - Jugendamt
-
Support für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt / RAA Sachsen e. V.
Förderhinweis
Das Projekt "Migration-Flucht-Bildung. Bildungsorte einer sich öffnenden Stadt" wird gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz aus Mitteln der Richtlinie Integrative Maßnahmen.
Diese Ringvorlesung findet im Rahmen von Courage: Wissen, Sehen, Handeln statt.
Das ZfI beging gemeinsam mit dem Bereich Geisteswissenschaften der TU Dresden am 25. September 2019 sein dreijähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde zu einer Veranstaltung mit spannenden Gästen eingeladen.
Prof. Dr. Naika Foroutan (DEZIM) gab mit einem Vortrag Einblicke in die derzeitige deutsche Integrations- und Migrationsforschung. Im Anschluss diskutierten drei prominente Gäste über Integrationsvorstellungen, Integrationsverhältnisse und Grenzen der Integration: Petra Köpping, Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani und Dr. Max Czollek.

Das Programm beinhaltete:
15:00 Uhr: Begrüßung und Grußworte
-
Prof. Dr. Christian Prunitsch, Sprecher des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften, TU Dresden
-
Dr. Eva-Maria Stange, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst
-
Svetlana Vishek, Kinder- und Elternzentrum Kolibri e.V.
15:15 Uhr: Rückblick
Drei Jahre ZfI – Dr. Karoline Oehme-Jüngling (ZfI)
15:30 Uhr: Vortrag
Ost-Migrantische Integrationsperspektiven – Grenzen und Potentiale des Integrationsbegriffs in Deutschland – Prof. Dr. Naika Foroutan (DEZIM)
16:00 Uhr: Podiumsdiskussion: Drei Positionen zu Integration
Wen meint Integration? Und wollen wir alle integriert werden?
-
Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping („Integriert doch erst mal uns!“)
-
Dr. Max Czollek („Desintegriert Euch!“)
-
Prof Dr. Aladin El-Mafaalani („Das Integrationsparadox“)
Moderation: Dr. Noa K. Ha
17:00 Uhr: Empfang und Posterausstellung
Wir danken allen Interessierten für die Teilnahme!
Workshop: „Postkoloniale Invektive: unbenannte Invektive als Rassismus in der deutschen Gesellschaft“
mit Prof. Dr. Fatima El-Tayeb (DRESDEN Fellow) und Dr. Noa K. Ha
Zeit: 26.09.2019; 13:00-16:00 Uhr
Ort: Zellescher Weg 17, 01069 Dresden; Raum: B401
Dieser Workshop betrachtete rassistische Invektive in ihrer postkolonialen Historizität, die in einer longue durée eingeübt, routiniert und als unsichtbare Schmähungen und Beleidigungen rassistische soziale Ordnungen stabilisieren. Rassistische Herabsetzungen und Herabwürdigungen sind eine Form der subtilen Gewaltkommunikation, die in der rassismuskritischen Forschung auch als ‚Mikroaggressionen‘ benannt werden. Erst aus einer postkolonialen und rassismuskritischen Perspektive wird die Normalität und Invisibilität rassistischer Invektive sowohl im Alltagswissen als auch in den Epistemologien kolonialer Gesellschaften sichtbar und aussprechbar. Zentrales Anliegen des Workshops war die Analyse anhaltender unbenannter Invektive, die die zeitgenössische deutsche Gesellschaft als rassistisch formierte soziale Ordnung aufrechterhält.
Zu Prof. Dr. Fatima El-Tayeb
Seit 2004 ist die Schwarze Deutsche Historikerin Professorin für Literatur und Ethnic Studies an der University of California, San Diego. Sie arbeitet interdisziplinär zu afro-diasporischen, postkolonialen und rassismuskritischen Fragestellungen im europäischen Kontext, mit Fokus auf Widerstandstrategien rassifizierter Communitys, insbesondere solche, die eine intersektionale, queere Kunstpraxis mobilisieren. 2001 erschien ihr erstes Buch: Schwarze Deutsche. Der Diskurs um ›Rasse‹ und nationale Identität 1890–1933 (Campus). Weitere Buchveröffentlichungen: European Others. Queering Ethnicity in Postnational Europe, University of Minnesota Press 2011 (deutsch als Anders Europäisch. Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa, Unrast 2015) und Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen in der postmigrantischen Gesellschaft, Transcript 2016. Als promovierte Historikerin mit einer Dissertation zu deutscher Kolonialpolitik und nationaler Identität verfügt sie über ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen und europäischen Kolonialgeschichte und als kulturwissenschaftliche Professorin setzt sie sich mit den aktuellen Debatten und gesellschaftlichen Aushandlungen europäischer Gesellschaften im Kontext von Migration, Diaspora und Flucht auseinander. Ihre Projekte wurden unter anderem von der Volkswagenstiftung, der Alexander von Humboldt Stiftung und der Mellon Foundation gefördert. Mit ihren Texten, Büchern und Vorträgen liefert sie wichtige Beiträge zum Verständnis der postkolonialen Bedingungen im deutschen und europäischen Kontext. Neben ihrer akademischen Arbeit ist sie in antirassistischen, migrantischen und queer of color Zusammenhängen aktiv. Während des Aufenthaltes wird sie zu Fragen der migrationspolitischen und postkolonialen Dimensionen einer nationalen Erinnerungskultur forschen, die eine heterogene Gesellschaft nur bedingt inkluiert, und vor der Herausforderung steht, Diversität, plurale Narration und heterogene Repräsentation im Kontext europäischer postkolonialer Debatten zu beantworten.
- Zeit: Mittwoch, der 22. Mai 2019, 9:00-13:00 Uhr
- Ort: TU Dresden, Universitätsgebäude August-Bebel-Str. 20, 01219 Dresden,
Hörsaal ABS E08 - Veranstalter: Prof. Dr. Heike Greschke (Zentrum für Integrationsstudien + Institut für Soziologie, TU Dresden) & Forschungsteam
Das Forschungsprojekt „Kunst und Kultur in der polarisierten Stadt. Dresdner Kultureinrichtungen als Vermittelnde zwischen den Polen 'Weltoffenheit' und 'Ethnopluralismus' (KupoS)“ unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Greschke wurde abgeschlossen.
Im Workshop wurden Ergebnisse des Projekts diskutiert, das sich im letzten Jahr mit Polarisierungsdynamiken im künstlerisch-kulturellen Feld beschäftigt hatte. So wurden neben einer Bestandsaufnahme kultureller Veranstaltungen im Raum Dresden zwischen 2014 und 2017 unter anderem sich neu herausbildende Netzwerkstrukturen in den Blick genommen sowie eine Diskurs- und Positionierungsanalyse der Ausstellung „Rassismus – die Erfindung von Menschenrassen“ im Deutschen Hygiene-Museum Dresden durchgeführt.
Der Workshop sollte allerdings nicht allein der Ergebnispräsentation dienen. Er sollte vielmehr den Erfahrungen von Kulturvertreter*innen in Dresden und Region Raum geben. Befunde der Studie sollten zur Verfügung gestellt werden, um aus der Perspektive von Kulturvertreter*innen problematische Sachverhalte der Polarisierung und der Vermittlung zu reflektieren und Lösungsansätze zu diskutieren.
Es ergaben sich neue, fruchtbare Perspektiven, die ein besseres Verständnis der Rolle und Funktion kultureller Institutionen in der „Debattenhauptstadt“ Dresden ermöglichen.
Internationale Wochen gegen Rassismus vom 11.03. bis 06.04.2019
Motto: „Europa wählt Menschenwürde“
Am Mittwoch, den 3. April 2019 wurde im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom ZfI eine Lesung des Buches "Desintegriert euch!" von und mit Max Czollek über das deutsche Integrationsnarrativ und rassistische Exklusionen veranstaltet. Anschließend fand ein Publikumsgespräch statt.
Veranstaltungsort war die Zentralbibliothek der städtischen Bibliotheken Dresden.
Veranstaltungen 2018
- Zeitraum: 29. November 2018
- Veranstalter: Professur für Didaktik der Philosophie und für Ethik an der Technischen Universität Dresden
- in Kooperation mit dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden und dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden sowie der Aktion Courage: Wissen, Sehen, Handeln!
- im Rahmen der Sonderausstellung "Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen" (19. Mai 2018- 6. Januar 2019, Deutsches Hygiene-Museum Dresden)
Die Tagung am 29. November 2018 wollte beitragen, die gesellschaftliche Diskurskultur im Allgemeinen und den Schulunterricht im Besonderen für die Erörterung ethischer Fragen zu Migration, Menschenrecht und Rassismus zu nutzen.
Neben Vorträgen wurden Workshops zur konkreten Unterrichtsgestaltung angeboten. Weitere Informationen hier
- Zeitraum: August bis Dezember 2018
- Veranstalter: Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden in Kooperation mit dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften der TU Dresden
Die Zahl rassistischer Übergriffe ist nach einem massiven Anstieg im letzten Jahr wieder gesunken. Dennoch bleiben rassistische Gewalt und rassistische verbale Verletzungen weiterhin bestehen und machen nicht vor dem Campus halt. Daher: Rassismus geht uns alle an - doch was tun? Die Veranstaltungen von „Courage: Wissen, Sehen, Handeln!“ geben darauf Antworten und bieten Handlungsoptionen an.
Wissen! Was ist Rassismus? Wie macht er sich bemerkbar? In welchen Kontexten tritt er auf? Welche Geschichte hat Rassismus? Was kann eine Universität gegen Rassismus tun? Die Vorträge von und Diskussionen mit Expert*innen helfen Rassismus zu erkennen und zu verstehen.
Sehen! Wie wird Rassismus in Kunst und Kultur verhandelt? Kann Kunst und Kultur denjenigen eine Stimme geben, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind? Welche Denkprozesse kann (nur) die künstlerisch-kulturelle Praxis anstoßen? Zahlreiche Kulturveranstaltungen in Kooperation mit Dresdner Kunst- und Bildungsinstitutionen laden zu einem Perspektivwechsel ein.
Handeln! Was kann ich tun, wenn ich Opfer oder Zeuge*Zeugin eines rassistischen Übergriffs werde? Was darf ich tun? Wie argumentiere ich schlagfertig gegen rechte Parolen? Wie gehe ich als Betroffene*r mit Rassismus um? Workshops geben Antworten und praktische Tipps.
Das Programm kann hier eingesehen werden.
- Zeitraum: Oktober 2018 bis Januar 2019
- Veranstalter: Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden und der Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden
Durch Internationalisierung, Globalisierung und Migration sind die europäischen Gesellschaften mehrsprachiger geworden. Diese Entwicklung wird bekanntlich kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite löst sie (Überfremdungs-)Ängste aus; es wird befürchtet, dass Mehrsprachigkeit junge Migrant*innen kognitiv überfordert und ihre Integration behindert; die Bildungsinstitutionen, die mit ihr konfrontiert sind, stellt sie vor enorme (ideologische wie praktische) Probleme. Auf der anderen Seite wird von Seiten der Spracherwerbsforschung betont, dass individuelle Mehrsprachigkeit eine wichtige, noch zu wenig gewürdigte kognitiv-kreative Ressource darstellt; und die Sprachwissenschaft weist darauf hin, dass gesellschaftliche Mehrsprachigkeit – die nicht nur durch Minderheiten- und Migrationssprachen repräsentiert wird, sondern auch durch das Nebeneinander von nationalen und regionalen Varietäten, von Schriftlichkeit und Mündlichkeit – nur scheinbar die Ausnahme, in Wahrheit jedoch linguistische Normalität sei. Diese sei nur deshalb aus den Augen geraten, weil diese gesellschaftliche Mehrsprachigkeit lange Zeit nicht anerkannt oder sogar – im Zeichen einer national motivierten linguistischen Homogenisierung, deren Ursprünge bis weit in die frühe Neuzeit zurückreichen – unterdrückt wurde. Aus sprachenpolitischer Sicht lässt sich ergänzen, dass die Europäische Union linguistischer Diversität zwar grundsätzlich positiv gegenübersteht und diese fördert; allerdings beschränkt sie sich dabei auf einige wenige (vermeintliche) Hochwertsprachen, wohingegen die eigentlichen Migrationssprachen viel weniger Aufmerksamkeit beziehungsweise Wertschätzung erfahren. So kann es zu der paradoxen Situation kommen, dass sich der bereits vor über zwanzig Jahren diagnostizierte „monolinguale Habitus“ (Gogolin 1994) des (deutschen) Schulsystems bis heute kaum verändert hat, während sich in der Wissenschaft die Einzelsprachen zunehmend vom Englischen verdrängt sehen; beides ist problematisch und nicht zukunftsweisend.
Die Ringvorlesung will vor dem Hintergrund dieses komplexen Panoramas „Mehrsprachigkeit“ aus verschiedenen Perspektiven als vielschichtiges und kontroverses Thema in den Blick nehmen; die leitenden Stichworte dafür lauten „Diversity as opportunity“ – „Diversity as challenge“ (Jessner/Kramsch 2015).
Im Zeichen von „Diversity as opportunity“ soll Mehrsprachigkeit als Chance thematisiert werden, d.h. als semiotische Ressource, die die Zugänge zur und die Perspektiven auf Realität vervielfältigt; als kognitiv-kreative Ressource, die die sich in neuen urbanen Dialekten, in den „Sprachliche(n) Wurmlöcher(n)“ (Hinrichs), im Codeswitching und Codemixing manifestiert; und nicht zuletzt auch in der Literatur.
„Diversity as challenge“ meint demgegenüber die sich mit der Mehrsprachigkeit verbindenden Herausforderungen der Institutionen und der in ihnen sedimentierten Sichtweisen und Routinen, der eingespielten (linguistischen) Hierarchien und Machtbalancen, des geläufigen homogenen Sprachbegriffs; die Angst aber auch vor Fragmentierung, Inkommunikabilität und Verlust von (kultureller) Identität, auf die wiederum mit neuen linguistischen Essentialismen reagiert wird. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf den Bildungsinstitutionen (= Schule/Hochschule) liegen: Was bedeutet es für sie, wenn die Gesellschaft linguistisch immer diverser wird?
Kooperationspartner der Ringvorlesung waren weiterhin das Institut für Bildungsforschung der Bergischen Universität Wuppertal sowie das Institut für Germanistik der Universität Wien.
Finanziert wurde die Ringvorlesung durch die Fakultät Sprach, Literatur- und Kulturwissenschaften der TU Dresden und die Gesellschaft von Freunden und Fördereren der TU Dresden e. V.
Veranstaltungen 2017
- Zeitraum: Wintersemester 2017/18
- Veranstalter: Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden in Kooperation mit der Kontaktstelle We Care und dem Zentrum für Weiterbildung (ZfW) der TU Dresden
Die Zahl rassistischer Übergriffe ist in den letzten Jahren in Dresden massiv gestiegen. Auch Studierende und Mitarbeiter*innen der TU Dresden sind davon betroffen - vereinzelt sogar auf dem Campus. Rassismus geht uns alle an - doch was tun? Die Veranstaltungen von "Courage - wissen, sehen, handeln!" gaben darauf Antworten.
...Workshops: Was kann ich tun, wenn ich Opfer oder Zeuge*Zeugin eines rassistischen Übergriffs werde? Was darf ich tun? Wie argumentiere ich schlagfertig gegen rechte Parolen? Wie gehe ich als Betroffene*r mit Rassismus um? Die Workshops gaben Antworten und praktische Tips.
...Vorträge: Was ist Rassismus? In welchen Kontexten tritt er auf? Was kann eine Universität gegen Rassismus tun? Die Vorträge von namhaften Expert*innen halfen Rassismus zu verstehen und zu erkennen.
...Kulturprogramm: Zahlreiche Veranstaltungen in Kooperation mit Dresdner Kultur- und Bildungsinstitutionen luden zu einem Perspektivwechsel ein.
...Bürgergespräch: Dozierende der TU Dresden gaben Antworten auf Fragen von Bürger*innen unter der allgemeinen Fragestellung "Wie wollen wir zusammen leben?"
Das Programm kann hier eingesehen werden.
- Zeitraum: Wintersemester 2017/18
- Veranstalter: Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden
Gesellschaftliche Machtverhältnisse sind konkret und realisieren sich in unmittelbaren Beziehungen zwischen Menschen. In jeder Interaktion zwischen Menschen spielen Machtasymmetrien, Hierarchien, Privilegien, Status, Dominanzkultur und Marginalisierung eine Rolle. Was das in Bezug auf Sprache(n) bedeutet, war das Thema dieser interdisziplinären und internationalen Ringveranstaltung des Lehrstuhls Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden in Zusammenarbeit mit dem ZfI. Zur angesprochenen Zielgruppe gehörten u.a. (angehende) Lehrer*innen und Erzieher*innen, die zu den Personen gehören, die im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen an Macht überlegen sind und deren Wertvorstellungen und Normorientierungen sich als sehr einflussreich erweisen. Macht zeigt sich u.a. in der Verwendung von und im Umgang mit Sprache(n). Aus diesem Grund erschien es wichtig, sich selbst gerade im pädagogischen Kontext als sprachlich Handelnde zu reflektieren. Die Perspektiven und Fachdisziplinen, aus denen heraus das geschah, gingen bewusst über Germanistik, DaF/DaZ und Kulturwissenschaften hinaus und bezogen politische und mathematische Bildung, biblische Theologie, Slavistik, Migrationspädagogik und Erziehungswissenschaft ein. Die Veranstaltung war so angelegt, dass der Reflexion viel Platz eingeräumt wurde: In jeder Sitzung gab es zwei Inputvorträge à 45 Minuten, weitere 45 Minuten standen dann für die Diskussion zur Verfügung.
Die Ringvorlesung wurde durch die Fakultät Sprach, Literatur- und Kulturwissenschaften der TU Dresden sowie durch Mittel des Lehrpreises 2014 der Gesellschaft von Freunden und Fördereren der TU Dresden e. V. an Dr. Ulrich Zeuner, Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache, TU Dresden, finanziert. Weitere Kooperationspartner waren das Institut für Bildungsforschung der Bergischen Universität Wuppertal sowie das Institut für Germanistik der Universität Wien.
Das Plakat der Ringvorlesung kann hier eingesehen werden.
- Zeitraum: September bis Dezember 2017
- als Kooperationspartner, veranstaltet durch LAG pokuBi Sachsen e. V.
Die Veranstaltungsreihe wollte sich mit Dresden als Stadt der Migration auseinandersetzen. Es wurden städtische Akteur*innen zu einem Austausch über Konzepte und Perspektiven an der Schnittstelle zwischen Stadt, Migration und Zugehörigkeit eingeladen. Zum einen ging es darum, die Prozesse, Praxen und Räume des Rechte-Nehmens und Zugehörig-Machens in Dresden in den Blick zu nehmen. Zum anderen sollten Kollaborationen gestärkt werden, um zusammen eine vielfältige und nachhaltige, Stadt- und Akteure verändernde, auf zeitgemäße Solidarität gründende (Stadt-) Bildungsarbeit zu gestalten.
Die Veranstaltungsreihe fand im Rahmen des Projektes "Migration-Flucht-Bildung. Bildungsorte einer sich öffnenden Stadt" der LAG pokuBi Sachsen e. V. in Kooperation mit Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen und vielen anderen Kooperationspartnern (u.a. dem Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden) statt.
Der Programmflyer kann hier eingesehen werden.
- Termin: 24.11.2017
- als Kooperationspartner
Die Zusammenarbeit zwischen Migrantenselbstorganisationen (MSOs) und Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Bereich der frühkindlichen Bildung ist eines der Ziele des Projektes "Interkulturelle Bildungslandschaft" am Kinder- und Elternzentrum "Kolibri" e.V. – einem Kooperationspartner des Zentrums für Integrationsstudien an der TU Dresden. Durch Faktoren wie Globalisierung und die Fluchtsituation steigt die Vielfalt in Kitas und damit die Notwendigkeit eines Wissenstransfers sowie einer Kooperation zwischen MSOs und Kitas. Dazu fand am 24.11.2017 die Fachtagung "Interkulturelle Bildungslandschaft: Migrantenselbstorganisationen und Kitas im Dialog" statt.
Weitere Informationen zum Projekt "Interkulturelle Bildungslandschaft" und zur Fachtagung sind hier einsehbar.
- Termin: 23.09.2017
- Veranstalter: Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden in gemeinsamer Trägerschaft mit Dresden für Alle
Der 2. Fachtag "Deutsch für Geflüchtete von Anfang an" gestaltete eine Schnittstelle zwischen ehrenamtlichen und institutionellen Sprach(lern)angeboten, indem Erfahrungs- und Forschungswissen systematisiert aufeinander bezogen wurde. Geboten wurde ein Tag strukturierten Austauschs zwischen ehrenamtlichen Sprach(lern)begleiter*innen, Geflüchteten, (angehenden) Fachwissenschaftler*innen aus den Bereichen DaF und DaZ, (angehenden) DaF- und DaZ- Lehrkräften sowie Ansprechpartner*innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Des Weiteren erfolgte eine Reaktion auf die Inhalte des ersten Fachtages dieser Art am 26. August 2016.
Zum zweiten Fachtag haben der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth, die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Dr. Eva-Maria Stange, die Integrations- und Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden Kristina Winkler und die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen. Ihre schriftlichen Grußworte können hier nachgelesen werden.
Programm
Das Rahmenprogramm der Veranstaltung begann bereits am Abend des 22.09.2017 mit dem Come and Get Together, in dessen Rahmen der Film "Willkommen auf Deutsch" vorgeführt wurde. Das Fachtagsprogramm am Veranstaltungstag bestand neben einem Eröffnungspanel mit Inputvorträgen von Akteuren aus verschiedenen Bereichen der Spracharbeit auch aus einem vielfältigen Workshopangebot zu verschiedenen Fragen und Herausforderungen.
Das Programm der Veranstaltung kann hier abgerufen werden.
Das Eröffnungspanel
Das Eröffnungspanel begann mit einem Inputvortrag von Dr. Micheal Dobstadt, Lehrstuhlvertretung für die Professur Deutsch als Fremdsprache der TU Dresden. Auf diesen Input, verfasst aus der Perspektive der Fachwissenschaft Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, reagierten
- Elisabeth Schmidt, Lehrkraft für Deutsch als Fremdsprache,
- Jens Jansen, ehrenamtlicher Sprach(lern)begleiter,
- Olesia Lukashevich, Geflüchtete mit Erfahrungen in ehrenamtlicher Sprach(lern)begleitung und professioneller Sprachlehre,
- Marcus Oertel, Koordinator für Erwachsenenbildung für Neuzugewanderte bei der Landeshauptstadt Dresden
aus jeweils der eigenen Perspektive, um damit den Auftakt zum gemeinsamen Austausch zu gestalten. Das Eröffnungspanel wurde moderiert von Dr. Torsten König.
Die Workshopphase
Anschließend fanden folgende Workshops statt:
- (Selbst)Reflexion zu Zuschreibungen, Kategorisierungen und Rollenverständnissen in Angeboten sprachlicher Bildung (auch) für Geflüchtete
Sophia Röder, Dr. Rebecca Zabel - Alphabetisierung von Erwachsenen in der Zweitsprache Deutsch
Dr. Claudia-Elfriede Oechel-Metzner, Ahmad Muhebbi - Herausforderungen und Lösungsansätze auf dem Weg in die Ausbildung und Arbeit
Dr. Janice Biebas-Richter, Dr. Solveig Buder, Prof. Dr. Michael Kobel - Deutsch-Lernmaterialien in der ehrenamtlichen Sprachbegleitung
Dominic Böckling, Stefanie Studnitz - Regelangebote Spracherwerb für Personen mit Migrationshintergrund – Prozesse, Akteure und Anknüpfungspunkte für Ehrenamtliche
Dr. Ute Katja Enderlein, Kristin Kossatz - Fit für ehrenamtliche Sprachlernangebote - Qualifizierungsmaßnahmen in der Diskussion
Dr. Anja Centeno García, Robert Sobotta - Zielgruppengerechte digitale (Lern-)Angebote für Ehrenamtliche erstellen
Thomas Unterholzer, Angelika Güttl-Strahlhofer - Zwischen Erfahrungswissen und Empirie - Wissenschaftliches Arbeiten im Kontext der Spracharbeit mit Geflüchteten und Migranten
Dorothea Reeps, Dorothea Spaniel-Weise, Dr. Janette Uhlmann - Grammatik schon beim Start? Ja, gut dosiert und visualisiert!
Marlis Schedler, Veronika Seidel
Der "Markt der Möglichkeiten" und das Abschlussplenum
An die Workshopphase anschließend wurden die Ergebnisse der einzlnen Arbeitsgruppen im Markt der Möglichkeiten präsentiert. Zusätzlich hatten die Fachtagsteilnehmenden die Möglichkeit Materialien verschiedener Verlage zu sichten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Den Abschluss des Fachtags bildete das von Dr. Annegret Middeke moderierte Abschlussplenum.
Dank
Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden dankt insbesondere dem House of Resources Dresden und der Gesellschaft von Freunden und Förderen der TU Dresden e.V. sowie Dr. Ulrich Zeuner für die finanzielle Unterstützung des Fachtags sowie der OPPACHER Mineralquellen GmbH & Co. KG und der Bäckerei Möbius OHG als Sponsoren der Veranstaltung. Des Weiteren möchten wir unseren Kooperationspartner*innen danken, welche die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung auf unterschiedliche Art und Weise unterstützten.
Finanzierungshinweis
Unterstützt aus Mitteln des Zukunftskonzepts der TU Dresden, finanziert aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder sowie aus Mitteln der Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden e. V. (Lehrpreis 2014 an Dr. Ulrich Zeuner, Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache, TU Dresden).
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.
Das Weiteren erfolgt eine Projektförderung durch das House of Resources Dresden.
- Zeitraum: 03.07. – 07.07.2017
- als Veranstalter
Als eine der größten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben im Einwanderungsland Deutschland gilt die Integration von Menschen jeglicher Zugehörigkeiten (Ethnie, Alter, Geschlecht etc.) in eine als inklusiv verstandene Gesellschaft, insbesondere die Herausforderung, die Potenziale einer pluralistischen Gesellschaft zu nutzen und zu fördern. Eine für unterschiedliche Diversitäten offene Gesellschaft ist im Fokus sogenannter post-migrantischer Ansätze, die die Perspektive von der Migration hin auf die daraus resultierenden Prozesse – soziale und politische Transformationen, Konflikte und Identitätskonstruktionen – richten (Foroutan 2015). Das Themenfeld Integration und Arbeit in der post-migrantischen Gesellschaft ist in diesem Zusammenhang von enormer Bedeutung, da hier wesentlich gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und angesichts von Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes verbessert werden kann. Um diesbezügliche Praktiken und Konzepte eingehend zu diskutieren setzte sich die Summer School 2017 intensiv mit dem Thema der Integration mit besonderem Fokus auf die (Weiter-)Entwicklung von Strukturen und Prozessen beruflicher Bildung und Beschäftigung unter der Bedingung von Diversität auseinander.
Das Plakat der Summer School können Sie hier einsehen.
Das Programm der Summer School können Sie hier einsehen.
- Termin: 22.06.2017
- als Veranstalter
Das Thema Tabu und Transgression ist eines, das unterschiedliche Aspekte der Gesellschaft betrifft, alleine dadurch, dass unterschiedliche Ebenen betroffen sind: Die Handlungsebene (Handlungstabus und Handlungsüberschreitungen), die Kommunikationsebene (Kommunikationstabus und Kommunikationsüberschreitungen) und die Sprachebene (Sprachtabus und Sprachüberschreitungen).
Die Gleichzeitigkeit von Tabus und Transgression einer demokratischen Gesellschaft ist erklärungsbedürftig, offenbaren sich hier doch Phänomene des Verschweigens und des Überschreitens, die der freiheitlichen Werteordnung entgegenstehen. Genau diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hat aber Einfluss auf Integrationsprozesse in einer diversen Gesellschaft, die es im Detail, das heißt in Bezug auf ihre ursächlichen und kontextuellen Bedingungen, Funktionen und Wirkweisen sowie Konsequenzen zu erklären und zu verstehen gilt.
Vor diesem Hintergrund sind Tabu und Transgression im Kontext von Integrationsprozessen hochgradig relevant und zwar sowohl in ihrer Schutzfunktion als auch in der Notwendigkeit, sie zu überwinden, damit gesellschaftliche Prozesse stattfinden können. Im Rahmen der internationalen Konferenz wurden folgende Fragen diskutiert:
- Welche Tabus und Transgressionen tauchen v.a. in Migrations- und Integrationsprozessen auf?
- Welche Tabus stellen Hemmnisse für Integrationsprozesse dar?
- Welche Tabus gibt es in einer als mitunter tabulos geltenden Gesellschaft wie Deutschland?
- Welche Tabus gibt es im Kontext von Flucht und Migration?
- Welche Tabudiskurse und Euphemismen sind hilfreich?
- Wie verhalten sich Tabu und Transgression zueinander?
- Welche Form von Transgression hemmen Integration? Welche fördern sie?
- Wer ist in der Position, Tabugrenzen überschreiten zu können?
- Welche Konsequenzen haben transgressive Akte für wen und wie hängt dies mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammen?
Das Plakat der internationalen Konferenz können Sie hier einsehen.
- Zeitraum: 16.03. - 06.04.2017
- als Kooperationspartner
Die Landeshauptstadt Dresden veranstaltete vom 16. März bis 6. April 2017 die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto „100 % Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus“.
Programmflyer Deutsch
Programmflyer Arabisch
Programmflyer Englisch
Das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden beteiligte sich daran mit dem Workshop „Von der Zuschreibung zum Rassismus“ (30.03.2017):
- Inwiefern tragen wir alle dazu bei, dass sich gewisse Zuschreibungen innerhalb der Gesellschaft manifestieren?
- Wie entwickeln sich daraus Rassismen und wie gehen wir und jeder Einzelne damit um?
Der Workshop "Von der Zuschreibung zum Rassismus" bot den Teilnehmenden interaktive Übungen, welche sich mit unterschiedlichen Ausprägungen von – zum Teil versteckten – Zuschreibungen, Stereotypen bis hin zu offener Diskriminierung und mit Rassismen auseinandersetzen. Abwechslungsreiche Ergebnissicherungen und die dazugehörige Reflexion zwischen den Übungen dienten den Teilnehmenden als indirektes Protokoll des Workshops. In vier Übungen sollte das Bewusstsein für das eigene Denken, Sprechen und Handeln innerhalb der multikulturellen Gesellschaft reflektiert und geschult werden.
Leitung: Ann-Kathrin Kobelt, Laura Rind-Menzel
- Zeitraum: Sommersemester 2017
- als Kooperationspartner
Unsere Gegenwart ist von tiefgreifenden Verunsicherungen geprägt. Gesichert geglaubte Weltbilder, Wertvorstellungen und tradierte Wissensordnungen wurden erschüttert, und die Euphorie der Jahre 1989/90 ist verflogen. Das gilt für den vermeintlichen Siegeszug der Demokratie ebenso wie für die bisherige Selbstwahrnehmung des „Westens“ als Impulsgeber für Fortschritt und Entwicklung. Hinzu kommen geopolitische Krisen, die das Empfinden von unkontrollierbaren Veränderungen verstärken.
Die Ringvorlesung „Politik und Kultur in Zeiten der Ungewissheit“ war ein gemeinsames Projekt der TU Dresden (Zentrum für Integrationsstudien), des Deutschen Hygiene-Museums Dresden, des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden und der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Rahmen von DRESDEN-concept – Kultur und gesellschaftlicher Wandel.
Das Projekt wurde durch das Zentrum für Integrationsstudien und von DRESDEN-concept e.V. gefördert.
Veranstaltungen 2016
- Zeitraum: Wintersemester 2016/17
- als Kooperationspartner, veranstaltet durch das Büro für Internationales des Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die Zahl rassistischer Übergriffe ist in den letzten Jahren in Dresden massiv gestiegen. Auch Studierende und Mitarbeiter*innen der TU Dresden sind davon betroffen - vereinzelt sogar auf dem Campus. Rassismus geht uns alle an - doch was tun? Die Veranstaltungen von "Courage - wissen, sehen, handeln!" gab darauf Antworten.
Workshops: Was kann ich tun, wenn ich Opfer oder Zeuge*in eines rassistischen Übergriffs werde? Was darf ich tun? Wie argumentiere ich schlagfertig gegen rechte Parolen? Wie gehe ich als Betroffene*r mit Rassismus um? Die Workshops gaben Antworten und praktische Tips.
Vorträge: Was ist Rassismus? In welchen Kontexten tritt er auf? Was kann eine Universität gegen Rassismus tun? Die Vorträge von namhaften Expert*innen halfen Rassismus zu verstehen und zu erkennen.
Lesungen, Filme, Poetry Slam: Zahlreiche Veranstaltungen in Kooperation mit Dresdner Kultur- und Bildungsinstitutionen luden zu einem Perspektivwechsel ein.
Das Programm kann hier eingesehen werden.
- Zeitraum: Wintersemester 2016/17
- als Veranstalter
Mit der Ringvorlesung setzte sich das neu gegründete Zentrum für Integrationsstudien (ZfI) mit aktuellen Perspektiven der Migrations- und Integrationsforschung auseinander. Die Ringvorlesung richtete sich an Studierende und Mitarbeitende der TU Dresden und anderer akademischer sowie öffentlicher Einrichtungen in der Stadt und war offen für alle am Thema Interessierte.
Die Ringvorlesung „Europa im Fluss - Perspektiven auf Migration und kulturellen Wandel in Europa“ des Zentrums für Integrationsstudien (ZfI) fand in Kooperation mit dem Kunsthaus Dresden, dem Societaettheater, der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) statt. Das Zentrum für Integrationsstudien (ZfI) wurde aus Mitteln des Zukunftskonzepts der TU Dresden unterstützt, aus der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder finanziert, und durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) gefördert.
Den Flyer der Ringvorlesung können Sie hier einsehen.
- Termin: 26.08.2016
- als Veranstalter
DaF-Angebote für Geflüchtete im Spannungsfeld von Theorie und Praxis, Institution und Ehrenamt
Deutschunterricht für Geflüchtete ist eine besondere Herausforderung. Gerade in den ersten Aufenthaltswochen erhalten Geflüchtete Sprachlernangebote durch Ehrenamtliche, zumeist Laien, in vielfältigen Formen. Die ehrenamtlichen Praktiker_innen verfügen mittlerweile über umfangreiche Erfahrungen mit der Zielgruppe. Zudem zeigen Versuche der selbstorganisierten Professionalisierung ohne Rückbindung an fachliche Diskurse, dass teilweise überholte oder unzweckmäßige Schwerpunkte/Prinzipien dominieren (beispielsweise Grammatiklastigkeit).
Das Engagement ist somit groß, doch das spezifische Fachwissen ist sowohl auf ehrenamtlicher als auch auf professioneller Seite verstreut, unbekannt und lückenhaft, gerade auch was die Arbeit mit und von Ehrenamtlichen, die Gestaltung von Transfer und Differenzierung sowie die Spezifik der Unterrichtssituation angeht. Vor allem die Übergänge zwischen sprachlicher Erst- bzw. Laienbetreuung und institutionalisiertem DaF/DaZ-Unterricht sind oft unkoordiniert.
Der Fachtag verstand sich als Beitrag zur Systematisierung und Fundierung des Deutschunterrichts für Geflüchtete in den ersten Aufenthaltsmonaten. Dabei sollte gelebte Deutschpraxis sichtbar gemacht und mit professionellen Ansätzen, Theorie sowie Forschung in Dialog gebracht werden, um auf dieser Grundlage Strukturen, Unterrichtsprinzipien und -ansätze für die Spezifik der Zielgruppe angemessen weiterzuentwickeln.
Die Ziele waren:
- Koordination von Fachwissen aus Theorie und Praxis
- Professionalisierung der Schnittstellen zwischen Ehrenamt und fundiertem DaF/DaZ-Unterricht
- gemeinsames Entwickeln von praxisnahen Lösungen
- Aufdecken von Forschungsbedarfen
Das Poster des Fachtags können Sie hier einsehen.
Die Dokumentation des Fachtags können Sie hier gratis beziehen.



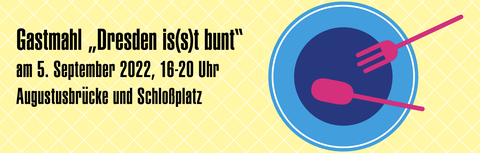












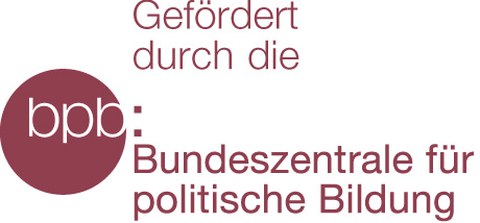








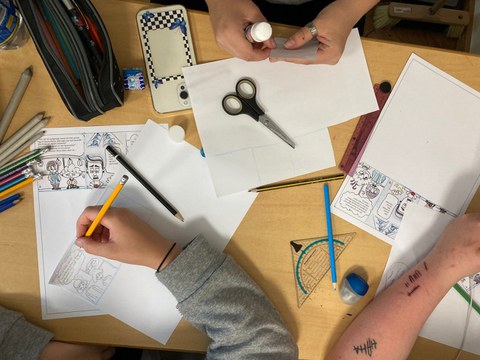
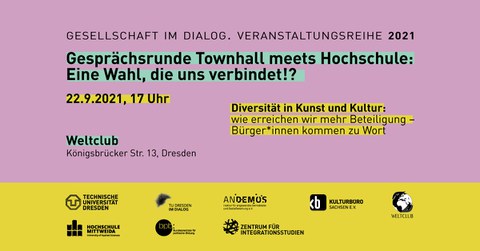





![Gesellschaft_im_Dialog_facebook_Frauenstimmen_in_Bildern_gross[1].jpg](https://tu-dresden.de/gsw/ressourcen/bilder/zentrum-fuer-integrationsstudien/veranstaltungen/gesellschaft-im-dialog/gesellschaft-im-dialog-2021/Gesellschaft_im_Dialog_facebook_Frauenstimmen_in_Bildern_gross-1.jpg/@@images/afd91ce6-e1d0-4f98-8345-f3c0256f49c7.jpeg)