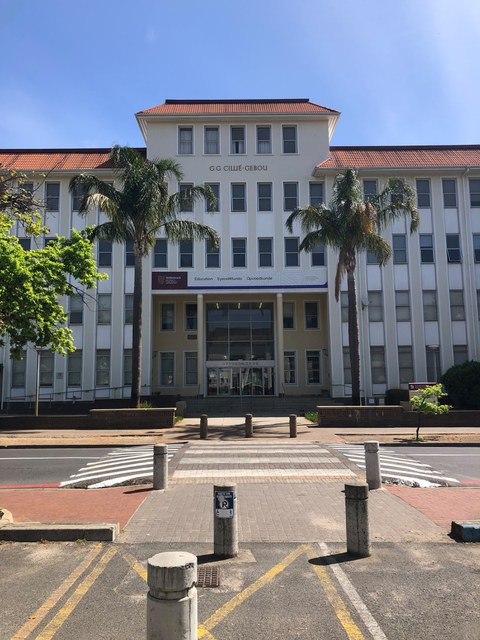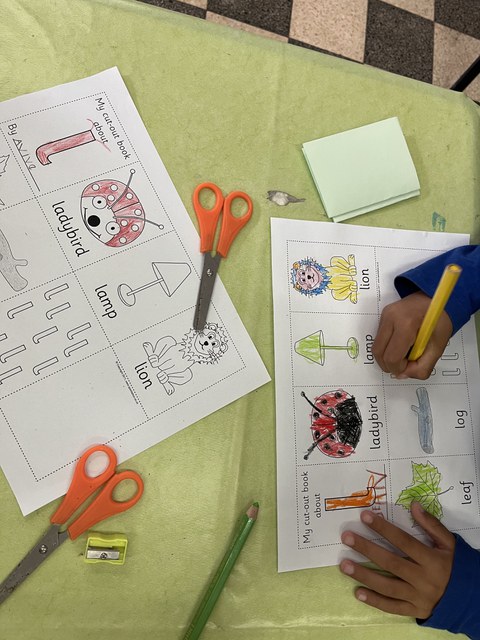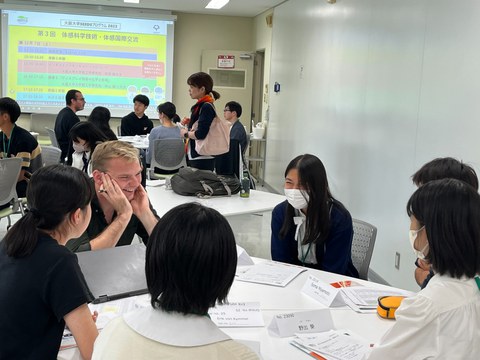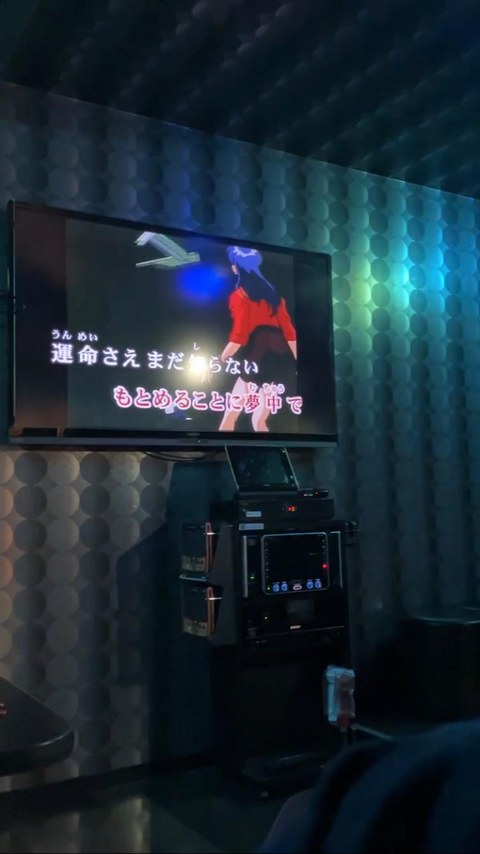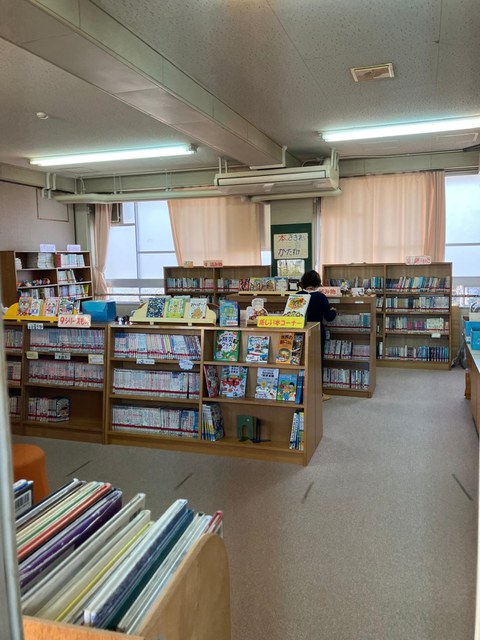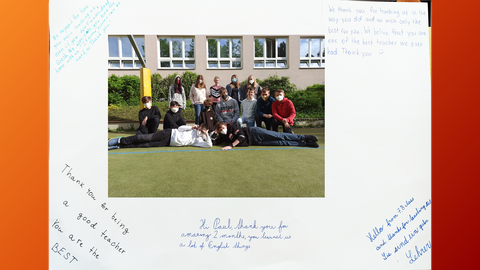Auslandserfahrungen
„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt“
Ernst Ferstl (österreichischer Lehrer und Schriftsteller)
Inhaltsverzeichnis
Internationale Erfahrungen
Entdecken Sie die Welt durch die Augen angehender Lehrkräfte. In den Auslandsberichten unserer Studierenden erwarten Sie spannende Geschichten über interkulturelle Erfahrungen, innovative Lehrmethoden und bereichernde Begegnungen.
Selina studiert die Fächer Kunst und Englisch für das Lehramt an Gymnasien und absolvierte einen Auslandsaufenthalt in Stellenbosch und Kapstadt (Südafrika) von September 2021 bis März 2022.
Südafrika
Chaotisch bin ich in dich gestolpert
Du hast mich gefangen
Du hast mir erlaubt
Ich zu sein
Ich habe geliebt, gelacht, umarmt,
entdeckt, geschwitzt, gestaunt, geatmet
Du bist dort
Ich bin hier
Du bist bei mir
Für immer ein Teil von dir, von mir.
Gründe für eine Reise nach Südafrika
Trotz vieler besorgter Stimmen aus meinem Familienkreis entschloss ich mich, im Wintersemester 2021/2022 nach Südafrika zu reisen. Es gab einfach zu viele gute Gründe dafür! Einige erreichte Ziele sind: Ich wollte unbedingt die riesige und einzigartige Biodiversität und die szenischen Landschaften des Landes entdecken. Im Kontext von Diversität, Inklusion und sozialem Ungleichgewicht wollte ich auch mehr über Lehr-Lern-Strategien und das Schulsystem in Südafrika erfahren. Ich wollte meine Stereotype reflektieren und das möglichst nicht nur als Touristin an “angenehmen” Orten, sondern in einer vollen Bandbreite, um ein möglichst echtes Bild vom Land zu erhaschen. Ich wollte Menschen treffen und Freundschaften schließen, verschiedene Lebensweisen miterleben,
individuelle Lebenserfahrungen hören und südafrikanische Kunst, Musik und Speisen
genießen.
Ankunft und Uni
Planlos ging der Plan los: Nach meinem Visumssticker im Reisepass buchte ich ein One- Way-Ticket von Frankfurt nach Kapstadt für September 2021. Das war schon aufregend! Jetzt geht es bald los. In Kapstadt wurde ich dann von einem Studenten der Stellenbosch University begrüßt und per Auto nach Stellenbosch gefahren. Dort wurde ich von der Internationals-Abteilung der Uni herzlich willkommen geheißen. Ich studierte die letzten eineinhalb Monate des Studienjahres in Stellenbosch. Ich genoss die bunte Frühlingsvielfalt und konnte sehr leicht Freundschaften schließen und viele Beziehungen knüpfen. Ich habe mich nie allein gefühlt!
Die Vorlesungen an der Stellenbosch University hatten eine andere Struktur und Dynamik als die der deutschen Universitäten, die ich kenne. Auch Inhalte und Fokus waren verschieden: Soziales Ungleichgewicht, Strategien der strukturellen Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen, Politik und Werte wurden reziprok besprochen. So gab es etliche rege Diskussionen zu kontroversen Themen und es wurde sich nicht gescheut, die eigenen Sichtweisen im großen Saal beizutragen und auch mal laut zu widersprechen. Das war sehr interessant und ich konnte aus der Vielfalt der Sichtweisen viel lernen. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier sehr Wichtiges für meine Bildung als Person und auch als Lehrerin lernen konnte. Später habe ich auch in Eigeninitiative summer school Kurse von der University of Cape Town (UCT) besucht. Es gab eine Vielzahl an thematisch interessanten Kursen, die nur einen oder wenige Tage dauerten – empfehlenswert!
In meiner Unizeit in Stellenbosch wurde ich im gut bewachten Wohnheim „Concordia” mit
anderen internationals zu einer 3er-WG zusammen gewürfelt, mit etlichen locals als Nachbar*innen. In der Mitte der Gebäude gibt es einen sozialen Treffpunkt mit Braaistelle.
Sobald ich mich dort niederließ, kamen nach wenigen Minuten andere Studierende dazu –
ähnlich wie beim Volleyballplatz des Wohnheims. Uni, student mall, Stadtzentrum und botanischer Garten sind sehr nah. Stellenbosch ist eine recht kleine Studentenstadt mit vielen niedlichen Restaurants, einem regen Nachtleben (bis circa 2 a.m.) und einigen
Möglichkeiten zusammen zu wandern. Es ist jeden Tag etwas los und es gibt fast jede
Woche thematisch zusammenhängende, kulturelle Events. Langeweile gab es nicht, aber
irgendwann habe ich verstanden, dass Stellenbosch doch wirklich klein ist und nur eine
Prestige-Seite vom Land widerspiegelt.
Schulen
Schulpraktika zu organisieren ist recht schwer ohne connections, u.a. aufgrund der recht
hohen Kriminalitätsrate im Land. Ich habe immer wieder andere darauf angesprochen,
dass ich gern ein Schulpraktikum machen möchte, weshalb sich meine Professor*innen
und Freund*innen für mich umgehört haben. Mit ihrer Hilfe und ihrem Netzwerk konnte ich Praktika an zwei Schulen und einem Lernzentrum organisieren.
An der Wynberg Girls’ High School in Kapstadt wurde ich sehr warmherzig begrüßt und durfte sogar in einem der Internatszimmer übernachten. Ich heftete mich an ein paar Füße und konnte im chaotischen Schulalltag erkennen, dass lebensnah und mit vielfältigen digitalen Methoden unterrichtet wird. Im Kunstunterricht wurde ich überrascht: Die Jugendlichen arbeiteten selbstständig an ihren Abschlussarbeiten und bereits die Zwischenergebnisse waren meiner Einschätzung nach auf einem universitären Level. Die Schule ist zwar staatlich, aber besser betucht. Daher gibt es auch viel Platz und ausreichend gutes Material zum Arbeiten – im Gegensatz zur staatlichen Masiphathisane Primary School am Westkap, einer Schule für Xosa-Muttersprachler*innen.
Die Spirale des generationalen Traumas durch die südafrikanische Geschichte ist in dieser Gegend im scheinbaren Nirgendwo sehr deutlich zu spüren: Um die Schule herum sind Hütten, eng aneinander stehend und zusammengebaut aus Wellblech und verschiedenen anderen Materialien, hier und da Müllberge zwischen Blumen. Ab und zu werden Kabel oder Zaunpfähle von der Schule entwendet. Schwarze Kinder in weißer Uniform laufen auf langen, staubigen Wegen. Ein feeding scheme der Masiphathisane sichert so manchem Schulkind das Überleben. Bis zu 57 Kinder bilden mit einer Lehrkraft eine Klasse und lernen wie Sardellen gestapelt in Räumen, die für die Hälfte gebaut wurden. Aufgrund dieses Platzmangels in Kombination mit staatlichem Versagen mussten zusätzlich zum Schulgebäude mobile homes aus Metall errichtet werden, in denen die heiße Luft steht und ich nach 5 Sekunden meinen Fokus verlor. Kinder, Lehrkräfte und Schulleitung leisten hier beeindruckende Arbeit. „Ich könnte aus so vielen Gründen nicht an dieser Schule unterrichten”, denke ich zum ersten Mal. Und dann im Sportunterricht schwingen bunte Hoola Hoops und ich erlebe das schönste gemeinsame Lachen dieser Erde, weit weg von Problemen. Ein Erlebnis, das mich tief geprägt hat.
Freude und soziale Ungleichheit erlebte ich auch im Stranddorf Paternoster. Als eine der deutschen Volunteers holte ich Kinder zu Fuß aus der Schule ab und verbrachte die Nachmittage mit ihnen im Hoopsig Learning Center: Die Hausaufgaben wurden erledigt und es gab verschiedene Skillworkshops wie Backen, Tanzen oder Programmieren von Robotern. In Hoopsig wird auf spielerische Art gelernt.
Reisen
Ich bin sehr viel gereist und nie lange geblieben. Am schönsten war mein Garden Route Trip mit drei Freund*innen, die ich bei einem Tagesausflug nach Muizenberg beim Surfen kennen gelernt habe. Auf der Rückfahrt beschlossen wir: Wir machen einen road trip! Dann haben wir ein Auto gemietet und sind, erstmal völlig überfordert vom Linksverkehr, von Stellenbosch nach Gansbaai gefahren, um dort die Marine Five von einem Boot aus zu sehen. Am beeindruckendsten waren die Wale, die sich auf das Wasser fallen ließen oder mit Seetang spielten. Über eine Fahrt ins Landesinnere erreichten wir die Congo Caves, die wir über eine adventure tour erkundet haben, und eine Straußenfarm. Am nächsten Tag habe ich mein Herz an den Strand von Wilderness verloren, ein wirklich paradiesischer Ort. In Knysna ist plötzlich ein riesiger Baboon (Affe) in unser Bad geklettert, den wir erstmal zu verscheuchen versuchten, um dann beim Tsitsikamma blackwater tubing im Reifen umher schwimmen und von Klippen springen zu können. Am Tag danach erreichten wir nicht nur die Ostküste, wir erkundeten auch von unserem Auto aus den Addo Elephant Park und versuchten, so viele Tiere wie möglich zu erspähen bis schließlich ein paar Elefanten zwei Armlängen um uns herum an Büschen fraßen. Nach vielen weiteren unvergesslichen Erinnerungen kehrten wir wieder nach Stellenbosch zurück.
Auf meinen Reisen habe ich auch viel über die Geschichte und Probleme Südafrikas gelernt, besonders durch locals (profs, hosts, flatmates, friends) und das alltägliche Leben. Ich habe neue Wasserrecyclingstrategien angewandt, Plastikflaschen gekauft statt Leitungswasser getrunken, dank load shedding (stundenlange power cuts) Gespräche im
Dunkeln geführt und mich dabei über die rohen Eier in meiner Pfanne geärgert und sprachlos den Berichten von Familiengeschichten zugehört. Südafrika hat letztlich viele
Seiten.
Der Tag, an dem ich meinen Rückflug buchte, war kein schöner. Vom heißen Strand zum verregnet-grauen Deutschland ging es Ende Februar 2022. Ich vermisse Südafrika bis zum nächsten Besuch. Ich vermisse besonders die (Bio)Diversität, die Berge und das Meer, meine Freundinnen und nicht zuletzt die Warmherzigkeit und die leichte, bunte, sarkastische Stimmung der Menschen. Auf der anderen Seite fühlt es sich an, als hätte ich in einem halben Jahr ein ganzes Leben gelebt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Tipps
- Road Trips (Garden Route, Chapman's Peak Drive) und besondere Orte (Wilderness Beach, The Commons in Muizenberg, The Watershed in Kapstadt)
- Safaris (Addo Elephant Park, Marine Five in Gansbaai, Pinguine in Bolders Beach)
- Wandern und botanische Gärten (Kirstenbosch)
- Konzerte und Kultur (Chor der Stellenbosch Uni, Zeitz Museum)
- Essensvielfalt (Madam Taitou, Oranjezicht, V&A Food Market, Mojo Market)
- Unbedingt warme Kleidung für das Wohnheim in Stellenbosch mitnehmen, auch im Sommer
- Batteriebetriebenes Licht mitnehmen wegen load shedding
Willst du noch mehr über meine Erfahrungen in Südafrika erfahren? Dann empfehle ich dir meinen Podcast „Cosmic Cheeseballs” auf Spotify, Ep1 Part 2 (ab 19min.) und Ep 2 Part
6. https://open.spotify.com/show/4VErDAfEAoB0VaHNUfol9i?si=3ccaaf1ef3f049c0
Sanya studiert Englisch, WTH/S und Deutsch als Zweitsprache für das Lehramt an Oberschulen und entschloss sich, ein Praktikum an der Partnerschule des ZLSB, der Tabeetha School Jaffa in Tel Aviv, zu absolvieren. In ihrem Bericht erzählt sie von ihren Erfahrungen in der Schule und ihrem intensiven Kontakt mit der israelischen Kultur und Natur.
Die ersten Wochen - Ankommen
Die Anreise war gedanklich für mich nicht ganz so unbeschwert, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Berichterstattungen der zunehmenden Konflikte im Land lösten Sorge bei Familie und Freund*innen aus, was meine Vorfreude etwas trübte. Trotzdem verspürte ich große Aufregung je näher ich Tel Aviv kam. Die Einreise verlief problemlos und vermeintliche Befragungen hinsichtlich meines Aufenthaltes blieben aus. Und schon war ich da - mittendrin in einem neuen Land.
Tel Aviv empfing mich allerdings nicht wie erwartet mit Sonnenschein und blauem Himmel und so stand ich an meinem ersten Tag wortwörtlich im Regen. Vom Flughafen gelangt man unproblematisch mit der Bahn ins Stadtzentrum. Öffentliche Verkehrsmittel sind dank der aufladbaren Travel Card sehr einfach zu nutzen. Im Bus wurde ich allerdings schon vor die nächste Herausforderung gestellt: die hebräische Sprache. Dank Google Maps und sehr hilfsbereiten Israelis konnte ich zumindest verfolgen, an welcher Haltestelle ich aussteigen musste und dadurch recht einfach meine Unterkunft finden.
Spannend war, dass ich genau zur Zeit des Pessachfestes ankam und ich so überraschenderweise meine Frühstücksgewohnheit anpassen musste. Auf Getreide basierendes und gesäuertes Essen wird zu Pessach nicht verzehrt. Konkret heißt das: bei meiner Ankunft waren Brot und Müsli tabu. Die entsprechenden Regale im Supermarkt waren sogar abgedeckt. So gab es die ersten Tage zunächst Omelette zum Frühstück und natürlich Hummus en masse. Aufgrund der neuen Währung Schekel hatte ich außerdem absolut kein Gefühl für Preise und die Gewöhnung hat sehr lange gebraucht. Dass vieles verhältnismäßig teuer ist, merkte man allerdings recht schnell.
Die erste Woche konnte ich aufgrund der Osterferien noch entspannt zum Ankommen nutzen. Das Wetter wurde leider nicht besser und so verbrachte ich die ersten beiden Tage fast ausschließlich im Haus. Umso schöner war der erste sonnige Abend an der Promenade in Tel Aviv. Alle waren draußen, trieben Sport, saßen zusammen, quatschten und ich fühlte mich direkt sehr wohl und sicher. Schnell wurde klar, dass viele Israelis ihre Freizeit am liebsten draußen verbringen. Überraschenderweise gibt es viele Outdoor Gyms und gute Radwege, wodurch ich direkt Lust bekommen habe, die Stadt mit dem Rad zu erkunden.
Ich konnte mich schnell vom Lebensstil der Israelis inspirieren lassen und freute mich auf den Beginn meines Praktikums an der Tabeetha School, einen geregelten Alltag und viele sonnige Tage.
Schulalltag und Nahostkonflikt
Die ersten Wochen meines Praktikums habe ich genutzt, um im Schulalltag anzukommen. Robin und Jessi, die beiden anderen Studierenden aus Dresden, haben mich zu Beginn mitgenommen und mir dadurch den Start an der Tabeetha School erheblich erleichtert. Generell hatten wir sehr viele Freiheiten im Rahmen des Praktikums: Wir durften uns völlig eigenständig unseren Stundenplan erstellen und ganz nach Interessen und Fachrichtungen in verschiedenen Klassen und Fächern hospitieren. In Absprache mit den Lehrkräften waren natürlich auch eigene Unterrichtseinheiten möglich. Zusätzlich hat Robin einen German Club gegründet, der fortgeführt werden soll.
Die Sprachenvielfalt ist extrem spannend und gerade für mich als zukünftige Englischlehrerin eine besondere Erfahrung. Die Muttersprache der meisten Schüler*innen ist Hebräisch oder Arabisch. Darüber hinaus gibt es einige russisch-, chinesisch-, spanisch- und deutschsprachige Schüler*innen, sodass man auf dem Schulhof unterschiedliche Gespräche verfolgen konnte. Alle werden ab der Vorschule hauptsächlich in Englisch unterrichtet und haben zusätzlich Hebräisch- und Arabischunterricht.
Im Gegensatz zu deutschen Schulen fiel mir direkt auf, dass vieles etwas weniger strenggenommen wird. So war es kein Problem, wenn eine Stunde mal ein paar Minuten später anfing oder eine Stunde anders verlief als geplant. Dies kam auch uns als Praktikant:innen zugute da ich es bisher nicht erlebt habe, dass so viel Freiheit hinsichtlich Hospitationen und Unterrichtsversuchen gegeben wurde.
Im April wurde außerdem der nationale Feiertag „Jom haAtzma’ut“, der Tag der Unabhängigkeit Israels, gefeiert. Am Vorabend gedenkt das Land seiner gefallenen Soldaten, indem die Sirenen für zwei Minuten heulen und das ganze Land wortwörtlich stillsteht. Am Feiertag selbst spielte sich das Leben hauptsächlich draußen ab: Die meisten Israelis trafen sich im Park Hayarkon oder an einem der zahlreichen Strände zum Grillen und Picknicken.
Der Feiertag hat mir jedoch auch zum ersten Mal aufgezeigt, wie kompliziert und komplex der sogenannte Nahostkonflikt ist. Während die meisten meiner israelischen Freund*innen am Unabhängigkeitstag die Staatsgründung feiern, spricht mein arabischer Freund von der „Nakba“ (arabisch: Katastrophe) und erinnert damit an die Flucht der Palästinenser*innen aus dem heutigen Staatsgebiet Israels. Und wie real und anhaltend der Konflikt zwischen beiden Parteien nach wie vor ist, haben wir selbst miterlebt als am 10. Mai die Luftalarm-Sirenen in Tel Aviv heulten. Natürlich wurden wir auf eine solche Situation vorbereitet und uns versichert, dass die Gefahr durch das israelische Raketenabwehrsystem relativ gering ist. Nichtsdestotrotz war es für mich eine surreale Erfahrung. Für viele war es allerdings nicht der erste Raketenalarm und so ging der Alltag anschließend mehr oder weniger normal weiter. Mein israelischer Mitbewohner empfing mich später seelenruhig: „Das gehört bei uns leider auch dazu.“
Besonderer Schulalltag, Tel Aviv & Haifa
In der Tabeetha School war oft neben dem täglichen Unterricht viel los und wir wurden meistens in Events und Ausflüge eingebunden. Im Mai haben wir einen Freitag eine “Spring Fair“ mit der gesamten Grundschule veranstaltet, bei der Spiele und Essen angeboten wurden. Die Eltern haben verschiedene nationale Gerichte mitgebracht, sodass ein riesiges vielfältiges Buffet entstand. Einen anderen Tag durfte ich Klasse 7 auf ein Fußballturnier für Mädchen und ab Mitte Mai die sechste Klasse jeden Freitag zu einem spannenden Podcast-Workshop begleiten.
Wie in der Schule ist auch in Tel Aviv immer etwas los. Und wenn ich immer sage, dann meine ich wirklich jeden Tag, jeden Abend und jede Nacht – 24/7. Die Stadt ist entsprechend dynamisch, jung, modern und divers. Die Menschen sind offen, freundlich und hilfsbereit. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten Woche noch kein Bargeld hatte und bei einem kleinen Falafel-Laden nicht mit Karte zahlen konnte. Als ich deshalb gerade wieder gehen wollte, bot ein Israeli an für mich in bar zu zahlen, da es nur eine kleine Summe sei.
Auch mein Fahrrad habe ich übrigens über Kontakte von einem Israeli kostenlos ausleihen dürfen. Dabei hatte dieser weder meinen vollen Namen noch irgendeine Garantie dafür, dass ich das Rad am Ende wirklich wiederbringen würde. Wann ich die Miete genau überwies, war meinem Mitbewohner auch relativ egal und einen Putzplan braucht hier niemand. Ich könnte weitere Beispiele auflisten, aber beeindruckt war ich auf jeden Fall von dieser unglaublichen Gelassenheit und dem mir entgegengebrachten Vertrauen in vielen Situationen.
Tel Aviv ist busy aber gleichzeitig übersichtlich und man kommt innerhalb des Zentrums in weniger als einer halben Stunde mit dem Fahrrad überall hin. Ich war großer Fan der ausgebauten Fahrradwege und habe die tägliche Fahrt zur Schule entlang des Strands immer sehr genossen. Nach der Schule sind wir meistens zum Jaffa Flea Market gegangen, haben uns in den kleinen Gassen Jaffas treiben lassen. Die meisten Israelis gehen am Donnerstag oder Freitag aus, denn Freitagnachmittag beginnt der Ruhetag Shabbat.
Da wir an der Schule jedoch von montags bis freitags arbeiten, blieb normalerweise nur der Freitag zum Ausgehen.
Meine Mitbewohnerin aus Dresden hat mich für eine Woche besucht und gemeinsam sind wir einen Tag in den Norden Israels gefahren, um uns die Stadt Haifa anzuschauen. Fährt man einmal raus aus Tel Aviv, merkt man erst was Israel landschaftlich zu bieten hat. Die Zugfahrt dauert etwa eine Stunde und man befindet sich in einer komplett anderen Umgebung. Alles ist grüner, ruhiger und überraschenderweise bergiger. Das Klima ist angenehmer und wir hatten einen wunderschönen Blick über die Stadt und das Mittelmeer vom Bahai Garden am Berg Karmel aus.
Unterrichtserfahrung, Tayyibe & Dead Sea Tour
Im Laufe des Praktikums durften wir uns im Team-Teaching im Geschichtsunterricht ausprobieren und ich habe bspw. eine Stunde in Englisch zur Martin Luther King Speech gehalten. Generell habe ich mich während der Arbeit an der Tabeetha School mit vielen unterschiedlichen Themen befasst, die mich sonst eher weniger beschäftigen. Zudem wurden wir des Öfteren für Vertretungsstunden eingesetzt, in denen wir entweder vorbereitete Inhalte unterrichten konnten oder auch improvisieren mussten. Dabei habe ich vor allem viel hinsichtlich behaviour und classroom management gelernt.
Gerade das hat mir persönlich viel gebracht, da wir uns ja normalerweise in Praktika hauptsächlich auf das Unterrichten und die Inhalte fokussieren. Eine sehr herausfordernde, aber auch erkenntnisreiche Erfahrung!
Nach der Schule hat uns einer der arabischen Lehrer für einen Nachmittag seine Heimatstadt Tayyibe gezeigt. Tayyibe liegt nordöstlich von Tel Aviv an der Grenze zum Westjordanland und ist hauptsächlich durch eine arabische Bevölkerung geprägt. Gefühlt kennt dort jeder jeden und meine Mitbewohnerin, Jessi und ich wurden super freundlich empfangen. In einer kleinen Bäckerei wurde extra für uns eine große frische Portion des arabischen Desserts Knafeh zubereitet. Knafeh wird warm serviert und besteht aus einem überbackenen süßen Käse, der sich in sehr langen Fäden zieht, und mit Rosenwasser und Pistazien serviert wird.
Nachdem meine Mitbewohnerin Tel Aviv wieder verlassen hat, kam meine beste Freundin zu Besuch und gemeinsam haben wir eine Tour zum Toten Meer gemacht. Die Landschaft verändert sich wieder völlig sobald man in Richtung Totes Meer fährt. Es wirkt wie eine endlose, heiße, steinige Wüste und manche sprechen von einer „marsähnlichen“ Landschaft. Wir besichtigten den Masada National Park. Von der auf einem Bergplateau erbauten Felsenfestung kann man das gesamte Tote Meer überblicken. Masada hat bis heute eine ganz besondere Bedeutung, da es den zentralen Ort des jüdischen Widerstands gegen die römische Besatzung symbolisiert.
Nachdem wir einen Zwischenstopp im Naturreservat „En Gedi“ gemacht haben und uns dort an den vielen Wasserfällen abgekühlt hatten, ging es weiter zum Toten Meer.
Rückblickend bin ich super froh an die Tabeetha School in Tel Aviv gegangen zu sein. Die Erfahrungen in Israel, der Austausch mit internationalen Lehrenden und den Schüler:innen vor Ort waren mehr als bereichernd und haben mich in meiner zukünftigen Rolle als Lehrperson bestärkt. Darüber hinaus ist Israel eines der spannendsten Ländern, in denen ich je war und ich habe mich nach kürzester Zeit wirklich wohl und heimisch gefühlt. Ich würde dort jederzeit wieder ein Praktikum machen und kann es allen, die offen für Neues sind und sich in (internationalen) Lehr-Lernkontexten ausprobieren wollen, wärmstens ans Herz legen!
Jan studiert Geographie und Geschichte für das Lehramt an Oberschulen und entschloss sich, ein Auslandssemester an der Catholic University of Saint Augustine of Hippo in Indonesien zu absolvieren. In seinem Bericht spricht er von seinen Erfahrungen an der kleinen abgelegenen Unviversität, in den ortsansässigen Schulen und allgemein vom Leben auf Borneo.

Begrüßungszeremonie
Im Wintersemester 23/24 ergriff ich die Möglichkeit, ein Auslandssemester in Indonesien zu verbringen. Das dreieinhalbmonatige Programm fand auf der Insel Borneo in einer Kleinstadt namens Ngabang statt. Die hier vor einigen Jahren gegründete Universität befindet sich im Inland Borneos und ermöglicht somit, dass auch in dieser ruralen Region Zugang zu höherer Bildung etabliert wird. Das Hauptaugenmerk des Programms stellt der kulturelle Austausch dar, welcher in dieser Region aufgrund seiner Abgeschiedenheit bisher nur schwer möglich ist. Nur selten verlieren sich Touristen in diese Region. Umso authentischer war der Einblick in die Lebenswelt der Menschen.
Um in dieser Hinsicht einen Austausch zu erleichtern, bekamen wir Unterricht in deren Sprache „Bahasa Indonesia“. Diese Sprache lernen alle Kinder ab dem ersten Schuljahr und dient zur allgemeinen Verständigung. Die Bedeutung dieser einheitlichen Sprache zeigt sich nicht nur an unserem Beispiel. Allein in dem Kulturkreis der Dayak, welcher eine Vielzahl von Stämmen auf Kalimantan umfasst, wie die Einheimischen die Insel nennen, gibt es um die 400 verschiedenen Sprachen. Diese sind gänzlich unabhängig voneinander und nicht als Dialekte zu verstehen. Um die Sprachbarriere zu umgehen, erhielten wir an der Universität Indonesisch Unterricht, in welchem wir auch das A1 – Niveau erreichen konnten.
In den drei Monaten erlangte man Einblicke in das Universitäts- und Schulleben der dortigen Bevölkerung. Die Universität diente ausschließlich der Ausbildung von Lehrpersonal in den Bereichen Englisch, Sport und Mathematik. Die Lehrkräfte und Student*Innen hatten erstaunliche Biografien. Während die Lehrkräfte in einer solch abgeschlagenen Region universitäre Strukturen erschaffen, nehmen sie allerlei Entbehrungen und Kompromisse in Kauf. Die Student*innen hatten alle eine sehr beeindruckende Geschichte zu erzählen, wenn es um ihren Weg für universitäre Bildung ging. Hierbei spielten oft traditionelle Werte und finanzielle Mittel eine große Rolle, welche den Zugang erschwerten und deren Willenskraft nur noch mehr unterstrichen.
Auch die Bildungsebene der Schulen konnten wir in dieser Zeit ausgiebig besichtigen. Dies wurde durch ein Praktikum an einer Schule, welche unseren Gymnasien gleicht, ermöglicht.

Unterricht in einer Senior High School 1
Trotz der vorhandenen Sprachbarriere konnte ich hier im Unterricht hospitieren und selbst Unterrichtsversuche halten. Ermöglicht wurde dies durch einen Übersetzer, welcher mir die Zeit in der Schule beiwohnte. Die Unterrichtsversuche stellten mich vor viele Herausforderungen. Den indonesischen Lehrplan auszuarbeiten, meine Stunden mit indonesischem Vokabular zu ergänzen oder vor 40 Schüler*Innen zu unterrichten sind dabei nur einige ausgewählte Aspekte.
Die Kultur dieser Region war für mich etwas gänzlich Neuartiges. Mit einer Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen ist Indonesien der größte muslimische Staat der Erde. Wir hatten jedoch viel mit dem christlichen Anteil der Bevölkerung zu tun, da besagte Universität einen katholischen Träger hat. Religion ist in dieser Region ein besonders wichtiger Bestandteil des Lebens. Neben der häufigsten Frage, ob man denn ein Foto mit uns machen könnte, war die Frage der Religionszugehörigkeit ebenfalls ein dauerhaftes Thema. Wenn ich mich dann als Atheist bekannte, wurde mir viel Erstaunen entgegengebracht. Dieser Status ist dort unmöglich, da es existenzieller Bestandteil des Lebens vor Ort darstellt.
Die Identifikation mit den eigenen Wurzeln ist weiterhin jedoch auch ein Thema. Die dunkle Geschichte der Stämme wurde uns ebenfalls in Gesprächsrunden am Lagerfeuer mitgeteilt. Die Dayak-Kultur ist im indonesischen Raum für seine Kriegerstämme bekannt. Diese wurden in der Vergangenheit mit Traditionen der Kopfjagd oder auch Kannibalismus in Verbindung gebracht. Es gibt jedoch auch noch Traditionen aus dieser Kultur, welche bis heute gepflegt werden. So kam man häufig mit der Kunst dieser Volksgruppe, deren Musik und Tänzen in Berührung. Besonders bei Empfängen wurden uns diese Tänze zu Ehren mit vollem Stolz vorgetragen.
Häufig wurden wir gefragt, wie wir denn mit dem Kulturschock zurechtkämen. Natürlich lässt sich nicht leugnen, dass man sich in einer Umgebung befand, welche viele Unterschiede zu unserem normalen Umfeld aufweist. Beispielsweise ist das Klima ein Faktor, welcher nicht zu unterschätzen ist. Durch die Lage am Äquator findet man dort ganzjährig hohe Temperaturen vor. Wir waren zur Regenzeit vor Ort, was sich durch äußerst starke Regengüsse auszeichnete, welche nahezu immer pünktlich am späten Nachmittag stattfanden. Die Temperaturen waren täglich über 30 Grad Celsius und gepaart mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Ich gewöhnte mich recht schnell an das Wetter und konnte es auch gut genießen. Jedoch brauchte man dauerhaft Sonnencreme, um seiner Haut keinen Schaden zuzufügen, und häufiger Pausen.
Ich mache regelmäßig Sport, was ich in dieser Zeit auch beibehielt. Dabei muss man sich jedoch auf extreme Voraussetzungen einstellen. Tagsüber ist höchstens Schwimmen eine Tätigkeit, welcher man nachgehen kann. Ansonsten sind klimatisierte Räume unausweichlich für sportliche Tätigkeiten. Ich bevorzugte immer nach Sonnenuntergang zu trainieren, da dann die Temperatur merklich angenehmer wurde. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird jegliche Aktivität jedoch erschwert. Der Schweiß kann nur sehr schwer verdunsten, was einerseits dazu führt, dass man nach 15 Minuten Aktivität komplett durchgeschwitzt ist und die natürliche Kühlung der Haut aufgrund der schlechten Verdunstung nur schlecht funktioniert. Somit muss man mit Einschränkungen rechnen.

Palmölfarmer
Was das Essen betrifft, so muss man sich auf eine sehr scharfe Küche einstellen. Chili gehört zu den Grundlagen der meisten Gerichte und führte für mich teilweise zur Ungenießbarkeit der Speisen. Im Laufe der Zeit erhöhte sich meine Akzeptanz für dieses scharfe Essen, jedoch war dies noch lange nicht das Level der Einheimischen. Diese essen alles mit Sambal, was eine Art Paste aus zerquetschtem Chili ist. Nicht nur warme Mahlzeiten werden damit verfeinert, sondern beispielsweise auch unreife Mango oder andere Früchte.
Andererseits findet man auch eine Vielzahl von Früchten und Gemüse vor, welches endemisch auf Borneo ist und somit nirgendwo sonst auf der Welt anzutreffen ist. Darunter sind sehr schmackhafte Früchte wie Rambutan und Lansat, welche durch gänzlich neue Geschmacksrichtungen bestechen. Es gab aber auch sehr gewöhnungsbedürftige Früchte, worunter Durian zählt. Gewarnt wurde ich schon vor meinem Besuch, was mich auf dieses Ereignis gewissermaßen vorbereitete. Die Frucht hat einen süßlichen fauligen Geruch und ist daher in vielen Einrichtungen verboten. Die Konsistenz ist sehr fettig und dem Geruch recht ähnlich. Diese Frucht gilt bei den meisten Indonesiern als Delikatesse und wird bis zur Fruchtzeit immer sehnsüchtig erwartet. Die Eindrücke, welche wir als Europäer bei dieser Frucht bekommen haben sind möglicherweise ähnlich, wie wenn wir den Indonesiern eine Art Blauschimmelkäse präsentieren. Ich kostete die Frucht jedoch auch und lehnte bei anschließenden Gelegenheiten dankend ab. Insgesamt war eine Kostprobe der verschiedensten Lebensmittel aber meist sehr gewinnbringend, da man häufig gänzlich neue Geschmacksrichtungen entdecken konnte.
Einen Kulturschock konnte ich dementsprechend nicht ausmachen. Das lag vielleicht aber auch an den Menschen, welche mir eine selten erlebte Herzlichkeit entgegenbrachten. Auch wenn die Kommunikation durch die Sprachbarriere meist sehr rudimentär war, so wurde man in deren Häuser eingeladen und dort bewirtet.
Mittels des Smartphones wurde sich dann zu gewissen Themen ausgetauscht. Dies zeigte einem meist, dass man auch diese großen Unterschiede überwinden kann und mit der richtigen Einstellung sehr viel möglich ist. Für mich als Mitteleuropäer war auch die Natur sehr interessant. Mir wurde dabei die Möglichkeit zu Teil, einige Nationalparks zu besuchen und dort die ursprüngliche Flora und Fauna zu begutachten und zu erleben. Auf der anderen Seite wurde deutlich, was das Palmöl für diese Region für eine Rolle spielt in Hinsicht auf wirtschaftlichen Aufschwung und damit verbundene Verbesserungen in deren Lebenswelt. Dieses Dilemma regte diverse Überlegungen an.
Abschließend möchte ich hinzufügen, dass es eine einmalige und bereichernde Erfahrung war. Die Möglichkeit für über drei Monate in einem Land wie Indonesien zu leben, hat mich viel hinzulernen und dabei auch die eigenen Zustände hinterfragen lassen. Die Privilegien, welche wir genießen, sind definitiv nicht selbstverständlich. Deren Wertschätzung wurde einem in solchen Momenten bewusst. Wenn man sich jedoch die Voraussetzungen der dortigen Bevölkerung anschaut, so machte es einen auch ab und an etwas nachdenklich und traurig. Auf der anderen Seite konnte man eine Lebensfreude und Freundlichkeit beobachten, welcher unsere Verhältnisse hinterherhinken. Dieser Umstand machte einen dann doch wieder glücklich. Für die Ermöglichung dieser Erfahrungen bedanke ich mich bei allen beteiligten Personen und Institutionen.
Sophie studiert Geographie und Musik für das Lehramt an Gymnasien und entschloss sich, ein Auslandssemester an der Catholic University of Saint Augustine of Hippo in Indonesien zu absolvieren. In ihrem Bericht spricht sie von ihren Erlebnissen zwischen Palmölplantagen und der neu gebauten Universität.
In Ngabang fiel mir sehr schnell die Lebensfreude der Menschen positiv auf. Es wird viel gelacht, die Menschen freuen sich über Kleinigkeiten und sind dankbar dafür, was sie haben. Dies lässt sich wahrscheinlich nicht auf Alle übertragen und doch ist es ein Grund, warum ich mich in Ngabang so wohlfühlte. Ich erlebte es selten, dass sich über Sachverhalte aufgeregt wurde. Wenn der Strom ausfiel, wurde gewartet bis er wieder funktionierte. Wenn das Wasser im Wohnhaus nicht lief und alle sich im Fluss duschen mussten, war das okay. Ich fragte mich oft, was die Ursache für diese positive Lebenseinstellung ist. Sicherlich spielen die zahlreichen Sonnenstunden oder auch einige durch Religion vermittelte Werte wie Dankbarkeit eine Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass ein Zusammenhang mit dem ständigen Aufführen von Musik besteht. Sei es durch Karaoke Abende, Singpausen bei Bildungsveranstaltungen, das Tanzen von traditionellen und nicht traditionellen Tänzen oder das Singen im Kirchenchor. Überall singen die Menschen in Ngabang.
Während des Borneo Mobility Programms absolvierte ich ein Praktikum an der „SMK Maniamas Ngabang“. Dort lernen Schüler:innen von der zehnten bis zwölften Klasse. Ich unterrichtete Musik und durfte während der Hospitationen und Nachmittagsangebote die indonesische Musikkultur besser kennenlernen. Die Schülerinnen zeigten mir ihre traditionellen Tänze und brachten mir die Handbewegungen und Schritte bei. Außerdem stellten sie mir ihre traditionellen Instrumente vor, die ich alle spielen durfte. In der Schule wurde ich viel eingebunden und meine Mentorin informierte mich über zahlreiche musikalische Veranstaltungen, die ich anschließend besuchte. So leitete ich auch einmal das Einsingen und die Chorprobe eines Erwachsenenchors. Unvergesslich bleiben die beiden Projekttage an der Schule, an denen ich Jurorin sowohl für den Gesangs- als auch Tanzwettbewerb sein durfte. Am Freitag, den 08.12.2023, sangen die Schüler*innen vor, ich vergab Punkte und lernte viele neue indonesische Lieder kennen.
Beim Tanzwettbewerb am darauffolgenden Tag traten Tanzgruppen gegeneinander an, die entweder zu moderner oder traditioneller Musik tanzten. Mir wurde ein weiteres Mal bewusst, wie stolz die Menschen auf ihre Kultur sind und wie diese auch an die junge Generation weitergegeben wird.
Weihnachten 2023 war etwas ganz besonderes. Dieses für mich sehr bedeutsame Fest in einem anderen Land, in einer anderen Kultur zu feiern, wird mir wohl immer in Erinnerung bleiben. In Indonesien gehen die Menschen von Haus zu Haus, überall stehen Dosen mit den verschiedensten Snacks bereit und es wird sehr viel gegessen. Einer unserer Freunde lud uns zu seiner Familie in ein kleines Dorf ein. In dem bunt bemalten Holzhaus schliefen wir Frauen zu dritt und die Männer nebenan zu acht in einem Raum. Abends grillten wir, ein Freund spielte Gitarre und alle sangen gemeinsam. Während der Mahlzeiten saßen wir immer in einem Kreis auf dem Boden. In der Mitte befand sich das Essen und ein Großteil der Anwesenden aß mit Fingern.
Wir brachten ein bisschen die deutschen Weihnachtstraditionen nach Indonesien, indem wir deutschen Kartoffelsalat zubereiteten und den Stollen schnitten, den wir aus Deutschland mitbrachten. Geschenke sind zu Weihnachten nicht typisch, trotzdem verteilten wir unsere mitgebrachten Geschenke, um uns für die Gastfreundlichkeit zu bedanken. Am 26.12.23 fuhren wir mit drei unserer indonesischen Freunde nach Singkawang. In dieser Stadt leben viele Chines*innen, sodass wir auch über deren Kultur Einiges lernen konnten. Singkawang liegt direkt am Meer. Bei einem Strandbesuch sah einer unserer Freunde, der in einem kleinen Dorf aufwuchs, das erste Mal das Meer. Die Faszination in seinen Augen war so schön zu sehen und machte mir einmal mehr klar, wie viel Glück ich habe, so viele Möglichkeiten zu haben. Er lebt sein ganzes Leben auf einer Insel und sieht mit 21 Jahren das erste Mal das Meer!
Auch von Ngabang unternahmen wir zahlreiche Tagesausflüge. Ein Highlight war der 9km entfernte Wasserfall. Schon die Scooterfahrt dorthin gefiel mir sehr und als wir allein, mit einem indonesischen Mittagessen vor diesem kraftvollen Wasserfall saßen, war die Faszination sehr groß. Nach dem Essen kletterten wir die Felsen entlang, um näher ans Wasser zu gelangen und schlussendlich mit ausgebreiteten Armen unter dem nach unten strömenden Wasser zu stehen. Neben dem Wasserfall besuchten wir auch ein traditionelles Haus, in dem auch heute noch Menschen leben. Während wir gemeinsam mit dem Bewohner:innen in einem Raum saßen und die Snacks von Weihnachten aßen, ging plötzlich das Licht aus. Die jungen Menschen im Raum aktivierten ihre Handytaschenlampe, während die älteste Frau im Raum aufstand und eine Kerze anzündete. So unterhielten wir uns bei Kerzen- und Taschenlampenschein über die kulturellen Unterschiede und befragten die Bewohner:innen des traditionellen Hauses über ihr Leben und ihre Gewohnheiten. Eine weitere schöne Erinnerung ist der Besuch eines Dorfes vier Stunden entfernt von Ngabang. Ein Mitarbeiter der Universität lud uns zu seiner Familie ein und wir lernten mehr über das einfache Leben auf dem Land. Am Abend luden uns die Dorfbewohner:innen auf eine Karaoke- und Nachbarschaftsparty ein. Wir aßen , was wir noch nie vorher gesehen haben und sangen „Kling Klang“ von Keimzeit in das Mikrofon, während all die lieben Menschen um uns herum tanzten und klatschten.
Eine Neubeantragung unserer Visa führte uns auf den malaysischen Teil von Borneo, wir verbrachten eine Woche in Kucing. Von dort aus besuchten wir verschiedene Nationalparks, wanderten durch den Regenwald, sahen unterschiedliche Affenarten, besuchten ein kulturelles Dorf und lernten auch deren Kultur besser kennen. Singapur konnten wir ebenfalls für fünf Tage besuchen, was sehr aufregend und spannend war! Diese Ausflüge taten sehr gut, da wir an den anderen Orten zwei Touristen von Vielen waren. In Ngabang bekamen wir sehr viel Aufmerksamkeit. Wir wurden täglich und überall nach Fotos gefragt, an einigen Tagen fühlten wir uns wie eine Celebrity und am nächsten Tag wie ein Zootier. Die Menschen waren immer sehr nett und doch tat es manchmal gut, die Wege zwischen den Palmölplantagen allein entlang zu laufen.
In Ngabang fuhr ich mit dem Scooter von Ort zu Ort. Anfangs musste ich mich sowohl an den Linksverkehr, als auch an die nicht vorhandenen Verkehrsregeln gewöhnen. Kurz darauf genoss ich jede Scooterfahrt. Oft fuhr ich nachmittags in ein Café namens Kana. Dort plante ich Unterricht und trank nebenbei einen günstigen Matcha Latte oder einen der vielen verschiedenen Kaffee. Ebenso plante ich dort oft den Lerninhalt für „English for everyone“. Jeden Freitag unterrichteten wir in der Universität Englisch. Die Englischstudent:innen dort lernen zwar die Grammatik und Vokabeln kennen, sprechen allerdings sehr wenig Englisch. Oft haben sie Angst davor, Fehler zu machen. In unserem Englischunterricht stand daher zum einen im Fokus die Student*innen zum Sprechen zu ermutigen, und zum anderen deren Vokabular und Aussprache zu verbessern. Ich konnte verschiedene Unterrichtsmethoden ausprobieren in einem Fach, welches ich eigentlich nicht studiere - eine sehr spannende und bereichernde Erfarung. In der Universität erhielten wir indonesischen Sprachunterricht. Dieser war sehr individuell und half uns, im Restaurant und in alltäglichen Situationen mit den Menschen Indonesisch zu sprechen.
Abschließend möchte ich unterstreichen, wie schön die Zeit in Ngabang für mich war und wie dankbar ich für diese sehr wertvolle Erfahrung bin. Ich würde jeder Person empfehlen, für einige Zeit ins Ausland zu gehen und eine neue Kultur kennenzulernen. Das „Borneo Mobility Program“ ist sehr empfehlenswert, um sich selbst weiterzuentwickeln und eine schöne Zeit im Ausland zu verbringen.
Erik studiert Geographie und Geschichte für das Lehramt an Oberschulen und absolvierte für drei Monate ein Auslandssemester an der Osaka University in Japan.
Von Ende September bis Mitte Dezember hatte ich das Privileg, dank der Förderung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), an einem kombinierten Studien- und Praxisaufenthalt in Japan teilzunehmen. Dieses Programm wurde durch das IMPRESS Team des ZLSB vermittelt, was es mir ermöglichte, tiefgreifende akademische und praktische Erfahrungen zu sammeln.
Meine Ankunft in Japan war eine Herausforderung, bedingt durch die lange Flugzeit, den Jetlag, eine um 90 % höhere Luftfeuchtigkeit und um 20 Grad höhere Temperaturen. Trotzdem empfing mich Prof. Nomachi, der mir Aufgaben an der Universität vermitteln und mich während meines Aufenthalts betreuen sollte, herzlich. Er holte mich persönlich von der nahegelegenen Bahnstation ab, obwohl ich aufgrund der beeindruckenden, aber anfangs verwirrenden Osaka U-Bahn, die sich wie eine Stadt unter der Stadt anfühlte, 10 Minuten zu spät kam. Dieses erste Missgeschick brach sofort das Klischee über die Pünktlichkeit der Deutschen, was Prof. Nomachi jedoch gelassen nahm.
Meine Wohnsituation in Osaka war im Gästehaus des RCNP auf dem Universitätscampus, etwa 45 Minuten mit der U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt. Obwohl es sich nicht um ein traditionelles Wohnheim handelte, war das Zusammenleben mit vielen Masterstudierenden und Doktoranden in dieser Unterkunft eine bereichernde Erfahrung. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, und trotz der etwas kleinen Gemeinschaftsküche bot die Nähe zum stets geöffneten Family Mart Convenience Store, der 24/7 alles Nötige bereit stellte, einen erheblichen Komfort.
Das erste Wochenende nutzte ich, um mich von der Reise zu erholen und gleichzeitig meine neue Umgebung zu erkunden. Osaka bei Nacht war ein atemberaubender Anblick, der eine Flut von Eindrücken hinterließ, die ich kaum verarbeiten konnte. Die Leuchtreklamen, insbesondere die von Glyco, waren ein unvergesslicher Teil dieser für mich neuen, überwältigenden Welt.
Am Sonntag, noch gezeichnet vom Jetlag, trat ich die Reise zum nationalen Flughafen an, von wo aus ich nach Sendai flog, um nach Fukushima zu gelangen. Schon am Flughafen knüpfte ich erste Kontakte zu anderen, die ebenfalls auf ein Auslandssemester in Japan waren, darunter Niederländer aber auch mit Japanern. Gemeinsam teilten wir die Aufregung und die Neugier auf das, was die kommenden Tage bringen würden.
Die Teilnahme am Workshop der Hamadori-Schule in Fukushima war eine tiefgreifende Erfahrung, die meine Sichtweise auf Strahlung und ihre Folgen nachhaltig verändert hat. Vor diesem Workshop war mein Wissen über Strahlung begrenzt; jedoch führten die intensiven Diskussionen und der Austausch mit den Einheimischen, die in dieser von der Nuklearkatastrophe betroffenen Region leben, zu einer erheblichen Erweiterung meines Verständnisses.
Die Einführung in die Verwendung von Strahlungsmessgeräten und entsprechender Software war nur ein Teil der Lernkurve. Besonders eindrucksvoll waren die Gespräche mit den Menschen vor Ort, die daran arbeiten, ihre Gemeinschaften wieder aufzubauen. Diese Interaktionen widerlegten mein anfängliches Bild von der Gegend als verlassene Geisterstadt. Die praktischen Bodenmessungen, bei denen wir feststellten, dass sich Cäsium-137 hauptsächlich in den obersten 5 cm des Bodens ansammelt.
Der Umfang der Bodensanierung, bei der 137 Millionen Kubikmeter kontaminierter Erde entfernt wurden, unterstrich die Notwendigkeit, Nachrichten und Informationen kritisch zu betrachten und die Bedeutung der Einordnung von Strahlungs- und Verschmutzungsgrenzwerten in einem globalen Kontext zu verstehen. Die Diskussionen mit internationalen Kollegen während des Workshops brachten mich dazu, meine bisherigen Ansichten über die Rolle der Kernenergie als potenzielles Mittel zur Reduzierung von CO₂-Emissionen zu überdenken.
Insgesamt hat der Aufenthalt in der Hamadori-Schule mein Verständnis für die komplexen Aspekte der Strahlung, ihre Auswirkungen und die damit verbundenen Herausforderungen der Kernenergie erweitert und mich dazu angeregt, meine früheren Überzeugungen kritisch zu hinterfragen.
Nach dieser intensiven Lernwoche, in der ich Freundschaften von Indonesien bis Finnland schließen konnte, kehrte ich nach Osaka zurück. Dort stand am nächsten Tag ein Kennenlerntreffen für eine neue Aufgabe an der Osaka University auf dem Programm. Ich wurde als Assistent für das SEEDs-Programm engagiert, ein Bildungsprojekt, das sich der Förderung hochbegabter japanischer Jugendlicher widmet. Dieses Engagement gab mir die Gelegenheit, mein Wissen und meine Fähigkeiten in einem internationalen Bildungsumfeld anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Ich hielt Vorträge über Deutschland, begleitete Jugendliche zu einem Wissenschaftsfreizeitpark, wo spielerisch Naturwissenschaften vermittelt wurden, und unterstützte bei der Präsentation eigener Forschungsprojekte, die die Schüler zusammen mit ihren Professoren erarbeitet hatten. Selbst bei der dreistündigen, komplett auf
Japanisch gehaltenen Zeremonie des Wissenschaftspreises der Universität, von der ich sprachlich wenig verstand, gewann ich wertvolle Einblicke. Meine Bitte um Übersetzung an die japanischen SEEDs-Assistenten wurde mit einem lakonischen „Mhm... it was lame, don't worry“ quittiert, was die Situation auflockerte.
Die Arbeit im SEEDs-Programm ermöglichte es mir, Orte in Osaka zu besuchen, die normalerweise für Touristen unzugänglich sind, immer mit dem Privileg, einen Übersetzer zur Seite zu haben. Trotz sprachlicher Barrieren – viele Japaner sprechen nur zögerlich Englisch – gelang es mir, mich zu verständigen und sogar alltägliche Konversationen zu führen. Gegen Ende meines Aufenthalts konnte ich sogar in einem Convenience-Store auf Japanisch nach einer Tüte fragen und um das Aufwärmen meines Essens bitten.
Im Oktober war ich intensiv damit beschäftigt, Daten aus Fukushima auszuwerten und Proben zu analysieren, was mir die Möglichkeit bot, mit verschiedenen Fakultäten zusammenzuarbeiten. Prof. Nomachi lud mich zu einer Party des RCNP ein, bei der neue Mitarbeiter willkommen geheißen wurden. Dort genoss ich japanische Hausmannskost und nahm an einem spielerischen Wettbewerb teil, bei dem der „deutsche“ natürlich beim Bier-erraten aus Shotgläsern siegte – eine Anekdote, die mir nebenbei einen 1500 Yen Amazon-Gutschein einbrachte.
Im November kehrte etwas Ruhe ein, da nur noch die Wochenenden durch SEEDs-Veranstaltungen ausgefüllt waren. Diese freie Zeit nutzte ich, um die Kansai-Region zu erkunden. Ich besuchte das historische Kyoto, sah die berühmten Rehe in Nara, durchstreifte einen Freizeitpark der Universal Studios und kaufte Weihnachtsgeschenke im Pokémon Center – ein Paradies, in dem es alles erdenkliche zu diesem Anime gibt und ich zum Helden meiner Neffen wurde.
Außerdem verlor ich mich gelegentlich in den Gassen Osakas, die zwischen Wolkenkratzern versteckt liegen. Eine Freundin aus der Gruppe in Fukushima lud mich ein, ihren Freundeskreis zu treffen, was zu regelmäßigen Karaoke-Abenden führte. Da sie zu dieser Zeit Deutsch lernte, sangen wir zusammen „Moskau“, ein Lied, dessen Text niemand verstand, aber alle fröhlich mit klatschten und summten.
Ende November besuchte Prof. Dr. Gehrmann während einer Dienstreise seine Schützlinge in Kobe und Osaka. Nach einem Gespräch mit Prof. Nomachi genossen wir gemeinsam ein Essen in der Professoren-Mensa der Universität, ein Ort, der mir zuvor zwei Monate lang verwehrt geblieben war und mehr einem Restaurant als einer Mensa glich.
Während meines Aufenthalts nutzte ich die Gelegenheit, mich intensiv mit dem japanischen Schulsystem und der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Diese Interaktionen führten zur Entwicklung der Idee für meine Staatsexamensarbeit, die ich derzeit schreibe. Leider war die Zeit für tiefere Diskussionen begrenzt, denn ich musste mich bald zum Itami Flughafen begeben, um erneut nach Sendai zu fliegen. Diesmal war ich in Begleitung eines Kommilitonen. In Sendai wurden wir von einem unserer Dozenten abgeholt und verbrachten den Abend in einer Izakaya, wo wir eine Vielzahl von japanischen Delikatessen probierten – ein unvergesslich lustiger Abend, der mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Am folgenden Tag führte uns unser Dozent nach Okuma, eine kleine, nahe des Unglücksorts gelegene Gemeinde, die inzwischen wieder bewohnt wird. Am Nachmittag präsentierten verschiedene japanische Universitäten ihre Forschungsprojekte und Workshops, die sie in Fukushima durchgeführt hatten. Der Vormittag war geprägt von einem kleinen Dorffest, bei dem wir die Möglichkeit hatten, die beeindruckende Farbenpracht der Bäume zu bewundern. Besonders in Erinnerung bleibt der Schreiwettbewerb, bei dem gemessen wurde, wer „Okuma“ am lautesten rufen konnte – leider ohne Sieg meinerseits.
Die Erkundungen in Tokyo, Kyoto und Hiroshima hätten alleine schon ausreichend Stoff für diesen Bericht geboten, jedoch möchte ich mich auf meine Erfahrungen während der Schulbesuche konzentrieren, die im Dezember stattfanden. Diese Besuche und die Gespräche mit den Lehrkräften, oft vermittelt durch japanische Freunde, waren besonders aufschlussreich. Ich hatte die Chance, mit einem japanischen Highschool-Lehrer zu essen, wobei unsere Unterhaltungen teilweise durch einen Dolmetscher oder den Übersetzungsdienst Deepl geführt wurden. Diese Gespräche über die Schwächen und möglichen Verbesserungen des Schulsystems haben mir Hoffnung gegeben, dass unsere Generation global noch einen Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit bewirken kann.
Meine Schulbesuche fanden im Süden Osakas statt, an einer Grund- und Mittelschule, wo mir sofort auffiel, dass es keine Reinigungskräfte gibt; stattdessen sind die Kinder selbst für die Sauberkeit ihrer Schule verantwortlich. Auch die Essensausgabe wird von den Schülern für Klassen von etwa 40 Kindern selbst organisiert. Ab der siebten Klasse tragen die Schüler Schuluniformen und sind mit Tablets ausgestattet. Die Kinder, besonders in der Grundschule, waren außerordentlich aufgeweckt und interessiert, was die Besuche dort zu einer Freude machte. Die Lehrerzimmer waren so chaotisch, wie man es sich nur vorstellen kann, doch der herzliche Empfang in den Schulen sowie an der Universität, der typisch für ganz Japan zu sein scheint, sobald man die anfängliche Sprachbarriere überwindet, führte zu wunderbaren Momenten – ob bei Konzerten, in Restaurants oder anderen Begegnungen. Während ich diesen Bericht schreibe, muss ich immer wieder lächeln und nehme mir vor, einige der Menschen, die ich während dieser drei Monate kennenlernen durfte, erneut zu kontaktieren.
Martin studiert die Fächer Geographie und Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/
Wirtschaft für das Lehramt an Gymnasien und bekam die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt in Kobe (Japan) von Ende September 2023 bis Anfang Februar 2024 zu absolvieren.
Die Stadt Kobe liegt in der Region Kansai in Westjapan und hat etwa 1,5 Millionen Einwohner. Sie erstreckt sich entlang eines schmalen Küstenstreifens von der Seto Binnensee im Süden bis an die steilen Hänge des Rokkogebirges im Norden.

Blick von der Kobe Universität über die Stadt Kobe nach Südosten
Der Auslandsaufenthalt kam aufgrund intensiver Kooperation zwischen der TU Dresden einerseits und der Kobe Universität andererseits zustande, im Rahmen dessen ich in Japan studieren sowie Praktika an verschiedenen Schulen und einem Kindergarten absolvieren durfte.
Vor der Reise nach Japan galt es jedoch, zahlreiche Formalitäten zu klären wie beispielsweise den Immatrikulationsprozess an der Kobe Universität, die Finanzierung über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), aber auch die Beantragung des Visums bei der Botschaft von Japan in Berlin. Dies gelang dank der umfangreichen Unterstützung der jeweiligen Teams des Zentrums für Lehrerbildung und Berufsbildungsforschung (ZLSB) der TU Dresden und der Kobe Universität reibungslos.
Finanzielles
Die finanzielle Unterstützung seitens des DAAD umfasste eine Reisekostenpauschale sowie eine monatlich ausgezahlte feste Summe in Euro, die sich für den Aufenthalt in Japan als auskömmlich erwies. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Reisekostenpauschale gemeinsam mit der ersten Monatsrate ausgezahlt wurde, weshalb es notwendig war, zunächst sämtliche Vorbereitungs- und Reisekosten selbst zu übernehmen. Im Alltag in Japan wird insbesondere Bargeld in Form von Japanischen Yen (JPY) benötigt, auch zum Beispiel, um die Miete sowie die Wasser- und Stromkosten des Wohnheimes zu bezahlen. Daher ist der Besitz einer Kreditkarte unabdingbar. Das Abheben des Geldes mit ausländischen Kreditkarten funktioniert in Japan insbesondere an den Geldautomaten (ATM) der großen Convenience-Store-Ketten wie Family Mart und Seven Eleven ohne Probleme. Diese Geldautomaten unterstützen mittlerweile sogar eine Spracheinstellung auf Deutsch.
Darüber hinaus vereinfacht der Besitz einer IC-Card (beispielsweise Suica oder ICOCA) die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs erheblich. Diese wird in der Regel einmal beim Einsteigen (Check-in) an ein IC-Lesegerät gehalten und einmal beim Aussteigen (Check-out). Die Entsprechenden Transportkosten werden automatisch vom Guthaben der Karte abgebucht. Auch die Nutzung einer digitalen Karte auf dem Smartphone ist möglich. So kann zum Beispiel auf dem iPhone eine digitale Suica-Karte direkt in der Apple-Wallet-App erworben und immer wieder mit dem gewünschten Betrag aufgeladen werden.
Ankommen in Japan
Nachdem ich in Japan angekommen war und bei der Einreise am Flughafen nach Vorlage des Certificate of Eligibility meine Residence Card erhielt, wurde mir in Kobe weitere sehr zuvorkommende Hilfe zuteil. Einerseits erhielt ich zahlreiche organisatorische Informationen zu den Abläufen an der Kobe Universität vom dortigen Studierendenbüro. Andererseits unterstützten mich stets mein Mentor in Japan sowie ein studentischer Tutor, insbesondere bei Behördengängen im Rahmen des Ankommens in der Stadt Kobe wie zum Beispiel bei der Registrierung meines neuen Wohnortes auf meiner Residence Card im Bürgerbüro des Nada Ward Office.
In Japan lebte ich in einem Wohnheim der Kobe Universität, der Kokui Residence, welches sich im Norden unweit der bewaldeten Berghänge inmitten eines ruhigen Wohngebietes befindet und einen herrlichen Blick über die gesamte Stadt bietet. Das Einzelapartment ist sehr klein und die Ausstattung einfach, jedoch der Preis mit derzeit umgerechnet etwa 120,-€ im Monat unschlagbar. Da ließ es sich auch verkraften, dass bei Ankunft im Wohnheim zunächst Futons, Kissen und Bettwäsche gekauft werden mussten, da lediglich ein einfaches Klappbettgestell vorhanden war. Eine Information vorab darüber wäre von Vorteil gewesen, auch aufgrund dessen, dass dadurch zunächst weitere Kosten entstehen.
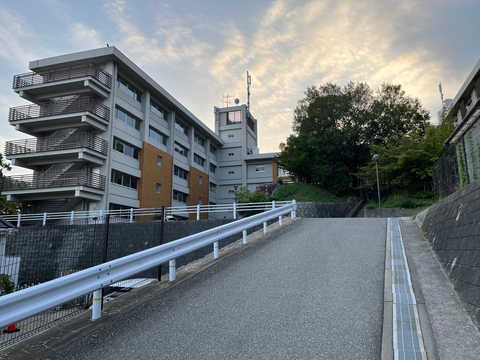
Wohnheim Kokui Residence
Studieren an der Kobe Universität
An der Kobe Universität selbst konnte ich Lehrveranstaltungen zu internationalen und historischen Aspekten des japanischen sowie von internationalen Bildungssystemen besuchen. Bestand dabei insbesondere am Anfang die Herausforderung der Sprachbarriere, da ich des Japanischen nur in sehr geringem Maße mächtig bin, konnte der Einsatz moderner Technik doch in erheblichem Maße eine Teilnahme an den Seminarveranstaltungen ermöglichen. Bei einem Vergleich der Seminare, welche ich in Japan erleben durfte, mit jenen in Deutschland, so fällt auf, dass die Teilnehmerzahl in Japan durchaus viel geringer ausfällt und auf diese Weise ein intensiver Austausch über den Unterrichtsgegenstand zwischen den einzelnen Teilnehmern zustande kommt. Auch trägt eine „eher familiäre“ und sehr wertschätzende Atmosphäre zu einem angenehmen Austausch im Rahmen der Lehrveranstaltungen bei. Ein anschließender abendlicher Besuch eines Izakayas ist dabei nicht ausgeschlossen, welcher zum weiteren Austausch über allerlei Dinge einlädt.

Gebäude der Kobe Universität, in dem unter anderem die Lehrerausbildung stattfindet
Die Praktika
Ich bekam jedoch nicht nur die Möglichkeit, die Kobe Universität selbst zu besuchen, sondern auch die ihr angegliederten Schulen und den Kindergarten im Rahmen von Praktika.
Der Universität sind dabei vier Schulen angegliedert: die Kobe University Secondary School, die Kobe University Elementary School, der Kobe University Kindergarten sowie die Kobe University School of Special Needs Education.
Mein erstes Praktikum in Japan fand an der Kobe University Secondary School statt. Für mich war es unter anderem besonders wertvoll, dass ich in diesen drei Wochen Teil einer studentischen Praktikumsgruppe sein durfte, welche außer mir aus japanischen Studierenden bestand, die ihre Teacher Licence erwerben wollen. Auf diese Weise konnte ich bereits am ersten Praktikumstag im Oktober zahlreiche persönliche Kontakte knüpfen, die sich im weiteren Verlauf meiner Zeit in Japan als besonders wertvoll erwiesen – nicht nur in Bezug auf universitäre und organisatorische Angelegenheiten, sondern auch auf Freizeitaktivitäten.
An der Secondary School durfte ich von morgens bis abends frei Unterricht hospitieren, einige Ansprachen während der „Homeroom Class“ halten, bei Clubs am Nachmittag teilnehmen oder hospitieren, mich mit Lehrern und Schülern austauschen und sogar auch selbst einmal Unterricht halten, was eine komplett neue Erfahrung für mich darstellte. Ich verstand, was es bedeutet, vor 42 Schülern der nach sächsischem Bildungssystem umgerechnet zwölften Klasse zu stehen und diese in einem Klassenraum zu unterrichten und, inwiefern sich dies auf den Unterrichtsstil und die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung auswirkt. Auch für die Schüler war diese Erfahrung völlig neu, da sie, wie sie berichteten, bis dahin noch nie eine Geographiestunde in englischer Sprache erlebt haben.

Kobe University Secondary School

Klassenzimmer einer japanischen Schule
Im Dezember konnte ich die Kobe University Elementary School in der Stadt Akashi westlich von Kobe für drei Wochen besuchen, wo ich hospitieren und auch an der einen oder anderen Unterrichtssession mitwirken durfte. Ich stellte fest, dass auch ein Grundschultag in Japan von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr für die Schüler dauert und das Soziale Miteinander noch stärker im Fokus steht als in Deutschland. Dabei waren die Klassenleiterstunden (Homeroom Class) genauso interessant wie dem Mittagessen beizuwohnen, welches die Schüler aus der Schulküche holen, dann gemeinsam im Klassenzimmer aufteilen und zu sich nehmen.
Die Unterrichtsgestaltung, welche ich in der Grundschule beobachten konnte, unterschied sich interessanterweise nicht maßgeblich von meinen Erfahrungen und Beobachtungen in Sachsen.
Knapp zwei Wochen am Kobe University Kindergarten in der Stadt Akashi im Januar haben mir wie bereits in der Elementary School gezeigt, dass Kinder keinen größeren Unterschied machen, wo jemand herkommt, solange dieser Jemand mit ihnen spielt, rennt, bastelt und baut. Die gegenseitige Wertschätzung, die bereits in jungen Jahren gelehrt und gelernt wird, entgeht einem auch bei wenigen Kenntnissen in Japanisch nicht. Insbesondere dann nicht, wenn eine freundliche Mentorin dem deutschen Gast sogar in deutscher Sprache das Gesehene erläutern und einordnen kann. Ich durfte zum Beispiel beobachten, dass es wie in Deutschland auch im besuchten japanischen Kindergarten individuelle und gemeinsame Spiel- und Aktivitätszeiten während des Aufenthalts der Kinder gibt und diese aufeinander aufbauen. Allerdings wurde auch erläutert, dass das, was den Kindern an Lernmöglichkeiten geboten wird – ebenfalls wie in Deutschland – sehr stark von Kindergarten zu Kindergarten variieren kann.
Wertschätzung wird auch an der Kobe University Special Needs Education School großgeschrieben, welche ich an mehreren Tagen gemeinsam mit meinem Mentor der Kobe Universität besuchen konnte. Hier zeigt sich ganz besonders, dass Schule viel mehr ist als nur ein Ort, um Wissen zu vermitteln, sondern es vielmehr auch darum geht, auf das Leben in der Welt und das soziale Miteinander in dieser abhängig von den persönlichen Möglichkeiten bestmöglich vorzubereiten.

Blick über die Stadt Akashi
Reflexion
Generell lässt sich feststellen, dass das japanische Schulsystem stärker darauf ausgerichtet ist, Uniformität unter der Schülerschaft herzustellen, als es in Deutschland der Fall ist. Ein nicht zu übersehendes Merkmal dafür ist die an den allermeisten Schulen zu tragende Schuluniform, aber auch das überall beobachtbare Bestreben, Harmonie und gegenseitige Wertschätzung als wichtige Werte der Gesellschaft weiterzugeben.
Das Widerspiegeln der Gesellschaft in der Schule bedeutet aber auch einen Fokus auf Leistung sowie lange Arbeits- und Lernzeiten. Japan wirkt auf den ersten Blick, als hätte es ein einheitliches Schulsystem mit Grundschule über Mittelschule bis zur Oberschule. Ich lernte jedoch in vielen Gesprächen, dass der Hensachi – eine Bewertung für das Leistungsniveau von Schulen und deren Schülern – wirkt wie die Entscheidung für Oberschule und Gymnasium in Sachsen. Dieser Wert dient der Differenzierung, welche in Deutschland das gegliederte Schulsystem leistet. So konnte ich selbst beobachten, dass an zwei unterschiedlichen Schulen, in denen jeweils die Klassenstufen zehn bis zwölf unterrichtet werden, ganz unterschiedliche Atmosphären herrschten.
Abschließend möchte ich nicht nur festhalten, dass es interessant ist, die Bildungseinrichtungen Japans kennenzulernen, sondern darüber hinaus auch sdas Land, seine Geographie, die Kultur und Religion. Nur wenn man mehr über diese Aspekte erfährt, können sich einem weitere Facetten des Schulalltags erschließen. Das persönliche Erleben eines Erdbebens beispielsweise lässt einen unmittelbar die Notwendigkeit von Katastrophenschutzübungen von Kindesbeinen an klar werden.
Dass ich Japan und seine Menschen im Rahmen dieses Auslandsaufenthaltes etwas näher kennenlernen durfte, betrachte ich als höchst wertvolle Erfahrung und Bereicherung – sowohl für meine fachliche Entwicklung in Bezug auf das Lehramtsstudium als auch auf persönlicher Ebene als Mensch.

Gedenkstätte im Hafen von Kobe in Bezug auf das verheerende Erdbeben von 1995
Ägidius studiert Geschichte und Mathematik für das Lehramt an Gymnasien und reiste für vier Monate nach Ngabang, Indonesien, um den Alltag an der Universitas St. Agustin Hippo hautnah zu erleben.
Leben auf einer Insel mit 30°C im Schatten und umgeben von Palmen und immergrünen Pflanzen. Was wie ein Traum klingt, wurde für ein paar Monate meine Wirklichkeit.
Das Sommersemester 2024 durfte ich als einer von zwei Studenten in Ngabang, einer dörflich geprägten Stadt im Westen von Borneo, verbringen.
Im Vorfeld ist es schwierig sich ein wirkliches Bild von einer Welt zu machen, die so anders ist als man es aus Deutschland gewöhnt ist. Doch durch die Lage der Universität, der Ausrichtung des Programmes und vor allem der dort lebenden Menschen hatte ich das Gefühl, ein Teil des Alltages und ein Teil des Lebens dort zu sein.
Bereits direkt nach der Ankunft wurden wir angenommen und umsorgt. So hatten wir besonders in den ersten Tagen immer eine Begleitung von der Universität, uns wurden besondere Orte gezeigt, beispielsweise das Äquator-Monument in Pontianak, und wir wurden mit den lokalen Essensgewohnheiten vertraut gemacht.
Dass diese Freundlichkeit und dieses Willkommen-Heißen prägend sein würde für die gesamte Zeit, zeigte sich jedoch immer wieder. Bereits am ersten Wochenende nach unserer Ankunft in Ngabang nahmen uns Studenten mit, ein Stück wunderschöne Natur in Form eines Wasserfalls zu sehen und anschließend das Herkunftsdorf eines Studenten zu besuchen, in dem an diesem Tag ein Erntefest stattfand.
Erntefeste sind in unserer Erfahrung durchaus prägend für die Kultur der Dayak, des die Kultur prägenden Volksstammes, zumindest zu dieser Zeit des Jahres. Neben Tänzen, Silataufführungen (indonesische Kampfkunst) und Zeremonien sind diese Feste vor allem von einem allgemeinen Zusammenhalt und der gemeinsam verbrachten Zeit geprägt. So wurden wir, wann immer wir ein solches Dorf besuchten in sämtliche lokale Häuser eingeladen und mit interessanten Gesprächen, positiven Emotionen und traditionellem Essen überrascht.

Zu Gast bei einem Erntefest.
Die Ernährung der Region allgemein basiert auf Reis. Im Selbstverständnis der Menschen dort hat man zum Beispiel erst dann eine Mahlzeit gegessen, wenn diese Reis enthielt. Dieser wurde in verschiedenen Formen zubereitet, wobei meine persönlichen Favoriten in Bambusblättern zubereiteter, klebriger Reis oder Tuak, ein von den meisten Haushalten selbst zubereiteter Reiswein, waren. Doch auch darüber hinaus findet man Reis überall. Man kann jedoch auch für uns exotische Nahrungsmittel, wie beispielsweise Schlange, finden, wenn man aktiv danach sucht. Generell sollte man sich jedoch darauf einstellen, dass eine vegetarische Ernährung in der Region nicht verbreitet ist und man diese dadurch nur unter Schwierigkeiten dort ausleben kann.
Neben Essen und Begegnungen bestand das Programm selbst primär aus drei Eckpfeilern: Unterrichtsstunden in der indonesischen Amts- und Kunstsprache, das Leben an der Universität, sowie das Besuchen und Unterrichten an einer lokalen Highschool, jeweils unter der Prämisse des kulturellen Austausches.
„Bahasa Indonesia“ oder nur kurz Bahasa ist die in Indonesien geltende Amts- und offizielle Landessprache. Es handelt sich dabei um eine Kunstsprache und wird von einem Großteil der Bevölkerung – vor allem auch auf Borneo – als Zweitsprache neben der Muttersprache gelernt. In der besuchten Region gibt es dutzende Sprachen, welche auch als eigenständige Sprachen und nicht als Dialekte einer Sprache zu verstehen sind und sich zum Teil zwischen benachbarten Dörfern deutlich unterscheiden. Laut Wikipedia gibt es in Indonesien selbst über 700 einheimische Sprachen, was die Bedeutung von Bahasa als verbindendes Element und zur allgemeinen Verständigung unterstreicht. Die Menschen versuchten sich dabei auch meist sich mit uns auf Englisch zu unterhalten, wofür die Sprachkenntnisse jedoch häufig nicht ausreichten. Daher konnten wir kontinuierlich miterleben, wie die Verständigung mit eigenen steigenden Sprachkenntnissen immer einfacher wurde und man auf technische Hilfsmittel wie Übersetzer-Apps zunehmend verzichten konnte. Im von einer Dozentin der Universität gehaltenen Unterricht konnten wir ein dem A1-Niveau entsprechendes Zertifikat erhalten.
Den Unterricht selbst sollte man sich dabei weniger strikt vorstellen als dies aus Deutschland bekannt ist. Für uns war unsere Sprachlehrerin, die auch für unseren Austausch im Allgemeinen Verantwortung trug, wie auch andere Dozenten, eher auf einem freundschaftlichen Niveau zugänglich. Und dies scheint im mindesten an der Universität auch zwischen heimischen Studenten und Dozenten der Fall zu sein, jedenfalls im Vergleich zu westlichen Ländern.
Neben Unterricht fanden an der Universität auch häufiger kulturelle Veranstaltungen statt: lokale Gesangswettbewerbe, die Feier des Geburtstages der Universität oder eine Art Tag der offenen Tür für umliegende Highschools und deren Schüler seien hier als Beispiele genannt. Dadurch wurde die Universität weniger als Arbeitsort denn als Lebens- und Zusammenkunftsort empfunden. Dies gilt wohl auch für das nahe der Universität gelegene Wohnheim, in welchem wir untergebracht waren. Von dem Willkommen-Heißen, gemeinsamen Abendessen und Unterhaltungen fühlte man sich dort vollkommen wohl und als Teil der Gemeinschaft.
Besonders spannend war für mich ansonsten die Möglichkeit an einer nahen Highschool zu unterrichten. Dabei war vor allem die Wertschätzung der eigenen Person und Unterrichtsideen deutlich wahrnehmbar. Der zugewiesene Lehrer versuchte mich dabei immer zu unterstützen, wenn auch die Kommunikation außer mit den Englisch unterrichtenden Lehrern zum Teil schwierig war. Da die Universität einem jedoch englischsprechende Studenten zur Unterstützung an die Hand gab, konnten Sprachbarrieren in der Organisation und im Unterricht überwunden werden.
Schüler und Schulklassen in Indonesien unterscheiden sich zum Teil doch sehr von Schulklassen in Deutschland. Zum Beispiel können Klassen auch eine Stärke von bis zu 40 Schülern aufweisen, und auch wenn ich diese Herausforderung in meinen Klassen nicht hatte, so waren auch die von mir unterrichteten Schüler deutlisch schüchterner und es weniger gewohnt individuell zu arbeiten. Dieser Faktor sorgte dafür, dass ich meine persönliche Unterrichtsart anpassen musste, was auch zukünftig sicherlich helfen wird auch Klassen individueller eingehen zu können. Hilfe hatte ich dabei vor allem von der Studentin, welche eigentlich nur als Übersetzerin fungieren sollte, deren Beiträge und Anmerkungen jedoch für mich sehr hilfreich waren und die Dynamik fast einer Art Teamteaching entsprach.
Darüber hinaus waren wir an der Schule auch außerhalb des Unterrichtens sehr willkommen und hatten die Möglichkeit an Schulzeremonien, Festtages, Zeugnisausgaben oder Lehrertraining teilzunehmen.

Abschiedsfoto mit unterrichteter Klasse.
Neben diesen offiziellen Teilen war es einfach beeindruckend in einer anderen Kultur zu leben, teilzuhaben und Menschen zu treffen, die Welten entfernt einem hoffentlich in Freundschaft verbunden bleiben werden. So sehr Borneo und Indonesien auf dem ersten Blick einem klischeehaften Traum gleichen, heißt dort zu leben nicht unbedingt nur am Strand in der Sonne zu liegen. Es heißt sich auf ein Leben einzulassen, dass verschieden und doch beeindruckend und schön ist.
Internationale Erfahrungen während der Pandemie
Der Ausbruch der Coronapandemie 2020 veränderte unseren Alltag plötzlich und zwang uns, unser Leben auf vielen Ebenen umzugestalten. Internationale Reisen waren von einem Tag auf den nächsten nicht mehr möglich und somit beeinträchtigte die Pandemie auch die Mobilitätsvorhaben zahlreicher Studierender.
In dieser Reihe erfahren Sie, wie die Lehramtsstudierenden Lilly, Ulrike, Lisa, Axel und Paul trotz der äußeren Umstände ihren individuellen Auslandsaufenthalt planten und durchführten. Ob in Präsenz oder digital, ob als Praktikum oder Studienaufenthalt – lesen und hören Sie, wie sich die Studierenden den unsicheren Umständen stellten und dadurch einzigartige und wertvolle Aufenthalte erleben durften.
Lilly studiert Englisch und Musik für das Lehramt an Gymnasien. 2019 entschied sie sich, für ein Jahr nach Irland zu gehen. Ihr erstes Semester verlief somit noch unter präpandemischen Bedingungen. In ihrem Erfahrungsbericht erzählt sie, was sich mit dem Ausbruch der Pandemie veränderte.
Der Hauptgrund, warum ich mich an der NUIG in Galway bewarb, war die Tatsache, dass ich zwei Semester bleiben konnte. Ich glaube, je mehr Zeit man in einem Land verbringt, desto mehr bekommt man ein Gespür für Land, Leute und Alltag, und genau darauf freute ich mich. Die internationale Ausrichtung der Uni und die gesamte Stadt Galway mit ihrer bunten und kreativen Gemeinschaft waren für mich sehr reizvoll. Außerdem passte das große Angebot an Literatur- und Kulturkursen perfekt zu meinem Studium an der TU Dresden und schien sich eher akkreditieren zu lassen als das Angebot am Institute of Technology in Tallaght. Ein weiteres Argument für die Bewerbung an der NUIG war das umfangreiche Angebot an Societies und Clubs, die sowohl Studenten als auch Dozenten im sportlichen und kulturellen Bereich zusammenbrachten. Nach der Abgabe meiner Bewerbungsunterlagen am 4. Januar 2019, bekam ich am 11. März die Zusage für mein Erasmus. Am 15. August 2019 begann meine wunderbar aufregende Zeit in Galway an der NUIG.
Auch wenn die Uni Wohnheimplätze anbot, fand ich schnell auf eigene Faust ein kleines, voll möbliertes Zimmer im Haus einer netten Dame, ihres Sohnes und deren Hund. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut und ich genoss viele offene Konversationen und gemeinsame Abende mit Hot Whiskey vor dem Kamin. Auch bekam ich ein Fahrrad gestellt und war somit innerhalb von fünf Minuten auf dem Campus und innerhalb von zehn Minuten im Stadtzentrum.

Spanish Arch © L. Kindler

Mein Zimmer © L. Kindler

Ein Blick auf den Campus © L. Kindler
Das Studienjahr begann mit einer großen Feier in einem der größten Säle der Universität. Dort bekamen wir alle wichtigen Termine, Informationen über unsere Kurse und das Campusleben mit allen Einrichtungen und Clubs. Die Einschreibung für meine Kurse in Literatur, Kulturwissenschaften und Psychologie, die ich bereits vorab im Handbuch gefunden und im Learning Agreement verzeichnet hatte, war sehr unkompliziert und fand über ein Online-Portal, ähnlich dem der TU Dresden, statt – mit dem Unterschied, dass man automatisch für die jeweiligen Prüfungen angemeldet war. Gab es ein Problem oder eine Frage, war der Erasmus-Koordinator Nigel immer erreichbar und half meist prompt. Als Erasmus-Student für Anglistik durfte man so viele Vorlesungen besuchen, wie man wollte, aber nur ein Seminar, um die Gruppen möglichst klein zu halten. Jeder Kurs fand zweimal pro Woche für je 60 Minuten statt, manchmal auch am späten Nachmittag. Ich habe alle von mir gewählten Kurse mit großem Vergnügen besucht, da sie alles in allem viel interaktiver waren als das, was ich aus Dresden gewohnt war. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden führte oft zu lebhaften Diskussionen, die bis in die Pausen andauerten und bei Tee fortgesetzt wurden.
Alle Prüfungen in den Literatur- und Kulturwissenschaften waren in Essayform zu absolvieren, was angesichts der Kürze des Semesters als Nicht-Muttersprachlerin recht anspruchsvoll war. Die Psychologiekurse wurden mit schriftlichen Prüfungen am Ende des Semesters beendet. Glücklicherweise gab es eine umfangreiche Bibliothek mit hervorragenden Arbeitsplätzen, viele Tutoren, die man konsultieren konnte, und die Dozierenden selbst waren auch sehr hilfsbereit und luden ihr Material auf Blackboard hoch.
Zu Beginn des Jahres nahm ich an mehreren Stadt-Rallys teil, meldete mich in verschiedenen Sportclubs an und fand so schnell wunderbare Freunde, mit denen ich die Nachmittage beim Studieren in der Bibo, beim Kaffee- oder Teetrinken in der Stadt, beim Spaziergang entlang der Panoramaküste oder abends beim gemeinsamen Essen (Potluck) verbrachte. Es wurde zur Gewohnheit, dass wir uns jeden Samstag auf dem Wochenmarkt trafen, um Lebensmittel einzukaufen und zum Mittagessen ein Curry oder Dahl in unserer Lieblingskneipe zu uns nahmen.

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler

© L. Kindler
Anfangs traf ich hauptsächlich Erasmus- und internationale Studierende, aber mit dem Eintritt in den Mountaineering Club fand ich auch viele irische Freunde, die mich aus erster Hand mit der irischen (Pub-)Kultur vertraut machten. Gemeinsam machten wir atemberaubende Sonntagswanderungen nach Connemara und Mayo, kletterten regelmäßig in der Kingfisher-Turnhalle und gingen gelegentlich im Meer bei Salthill trotz klirrender Kälte schwimmen. Jeden Donnerstag gab es ein Clubtreffen mit allen Mitgliedern im Pub 7, und jeder konnte Freunde mitbringen zu Fingerfood, Bier, Live-Musik und Tanz. Durch all die gemeinsamen Aktivitäten und Englisch als einziges Kommunikationsmittel wurde ich immer sicherer im Sprechen und mein Wortschatz verbesserte sich erheblich. In Kombination mit der Menge an Aufsätzen, die ich in relativ kurzer Zeit schreiben musste, begann ich irgendwann auf Englisch zu denken und nicht mehr in meinem Kopf zwischen zwei Sprachen hin und her zu springen. Da ich in einem irischen Haushalt lebte, hatte ich sofort einen Einblick in die warmherzige und freundliche irische Kultur. Meine Vermieterin zeigte mir, wie man einen guten Shepherds Pie oder einen Beef Stew kocht, und ich lernte warme Hausschuhe und schwarzen Tee mit Milch zu schätzen, denn dies war das Erste, was einem angeboten wurde, wenn man das Haus betrat.
Durch die Pub-Kultur lernte ich nicht nur, was ein gutes Guinness ausmacht, welche Lieder zu welcher Region gehören und welche Rugbyteams die berühmtesten waren, sondern auch über die verschiedenen irischen Dialekte. Manchmal konnte man Gälisch auf der Straße hören, was ich bedauerte, weil ich es weder sprechen noch verstehen konnte. Vor meinem Aufenthalt hatte ich wenig über die alte Geschichte Irlands und die anhaltenden politischen Konflikte im Norden der Insel gewusst. Ich erfuhr nun, dass die Religion immer noch eine bedeutende Rolle in der irischen Gesellschaft spielt, da die Ungleichheiten zwischen dem protestantischen Norden und dem katholischen Süden in Diskussionen zwischen meinen irischen Kommilitonen oft spöttisch zur Sprache kamen. Durch den Besuch von Kulturseminaren und die Teilnahme an Erasmus-Trips erhielt ich einen wunderbaren Einblick in die keltische Geschichte, Mythologie und natürlich die malerische Landschaft mit ihren zahllosen Hecken, flauschigen Schafen und kleinen Dörfern. Wo auch immer wir anhielten, waren die Menschen freundlich und immer zu einem Gespräch bereit – Wettergespräche inklusive.

Mein Arbeitsplatz während des Lockdowns um Ostern
Mit dem Beginn des Lockdowns aufgrund von Covid-19 endete meine wunderbare Zeit in Galway und an der NUIG abrupt. Fast alle Freunde waren innerhalb eines Tages abgereist, die Uni und alle Einrichtungen geschlossen und die Stadt war wie leergefegt.
Ich verlies die Insel jedoch nicht, sondern zog mit meinem Partner zu seiner Familie nach Rosses Point in Sligo, einem County im Norden der Republik. 4,5 Monate lang lebte ich bei der sechsköpfigen irischen Familie und obwohl wir nirgendwohin reisen durften, möchte ich sagen, dass ich in dieser Zeit am meisten darüber gelernt habe, was es bedeutet, Ire zu sein. Der Gemeinschaftssinn nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch für alle anderen war eine Priorität. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Solidarität gegenüber allen Mitbürgern kannte ich aus Dresden nicht. Jeder leistete einen Beitrag, um sich und andere zu schützen, um die schwierige Zeit gut zu überstehen. Wir kochten täglich für die Großeltern und andere ältere Leute aus der Stadt, halfen beeinträchtigten Nachbarn bei der Gartenarbeit und beim Einkaufen. Glücklicherweise war das Wetter die ganze Zeit über warm und es regnete so selten, sodass wir die meiste Zeit, wenn wir nicht gerade vorm Rechner saßen, im Freien verbrachten.

Strandspaziergänge und Beach clean-ups © L. Kindler

Campen im eigenen Garten zur Abwechslung © L. Kindler

Bouldern am Strand © L. Kindler

Einer von vielen Sonnenuntergängen © L. Kindler
Fünf von sieben Familienmitgliedern saßen täglich gemeinsam um den Küchentisch vor ihren Laptops und lernten, was es bedeutete, Homeoffice zu betreiben. Keine spontanen Treffen mit Freunden mehr, keine Sportveranstaltungen, kein Kino, keine Samstagsbummel über den Markt mehr. Dazu die bedrückende Unsicherheit und Angst vor dem, was da draußen passierte und was es für uns und unsere Zukunft bedeuten würde. Meine insgesamt acht Prüfungen für das zweite Semester absolvierte ich alle am Küchentisch, was alles andere als einfach war, und ohne die Unterstützung meines Freundes, seiner Familie und meiner Freunde und Familie über Zoom und Face Time hätte ich es nicht geschafft. Es gab Tage, an denen mir das Aufstehen angesichts der Tristesse schwer fiel, wo ich vollkommen lustlos war, noch irgendeinen Gedanken für meine schier endlosen Essays zu verfassen. So wie der Rest der Gesellschaft versuchten auch wir trotz des Lockdowns immer wieder Glanzpunkte zu schaffen, um während der 4,5 Monate unter einem Dach nicht verrückt zu werden.
Ich muss sagen, dass die NUIG in dieser Umstellungsphase von Präsenz- zu Onlineveranstaltung sehr kompetent reagiert hat und auch uns Erasmusleuten bis zum Ende unserer Mobilität bei allen Belangen zur Seite stand. Wir bekamen regelmäßig Angebote für verschiedene Online-Kurse, um uns auszutauschen, gegenseitig aufzubauen und somit dem Alltag einfach ein wenig mehr Farbe zu verpassen. Meine Erasmusfreunde und ich standen und stehen bis heute in regelmäßigem Kontakt, was mich mit großer Freude und Stolz erfüllt. Ich denke, dass uns gerade diese schwierige Zeit zusammengeschweißt hat und wir jedem gemeinsam erlebten Moment eine große Bedeutung beimessen. Mein Erasmusjahr war zweifellos eine einzigartige und lebensverändernde Erfahrung für mich. Jeder Moment war kostbar und ich habe mehr gelernt, als ich mir je hätte vorstellen können. Ich fand meinen Partner und wunderbare Freunde aus Irland und der ganzen Welt, mit denen ich noch immer in Kontakt stehe und hoffe, sie eines Tages wieder zu treffen. Ich bin unendlich dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben und würde es auf jeden Fall – trotz Pandemie – noch einmal tun.
Ulrike ist angehende Grundschullehrerin und bereitete sich lange auf ihren Traumpraktikumsaufenthalt in Singapur vor. Wie sie sich durch pandemiebedingte Hindernisse kämpfte und was ihr Praktikum für ihre Zukunft bewirkte, hat sie für uns in ihrem Erfahrungsbericht festgehalten.

Cloud Forest Singapore
Schon seit frühester Kindheit bin ich fasziniert von Asien und den dazugehörigen Ländern, Städten und der Landschaft. Seit einem längeren Aufenthalt 2017 in Thailand hegte ich den Wunsch, für einige Monate in einem asiatischen Land zu leben und dadurch die Kultur, Lebensweise und Mentalität dort besser kennenzulernen und selbst zu erleben. Als Zielland für meinen Auslandsaufenthalt habe ich Singapur aus vielen Gründen gewählt. Besonders beeindruckt hat mich die Architektur und das Erscheinungsbild der Stadt gekoppelt mit dem erfolgreichen Bildungssystem, welches im internationalen Vergleich exzellente Ergebnisse erzielt. Insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften gelten die Schulen in Singapur als außerordentlich leistungsfähig.
Als angehende Grundschullehrerin wollte ich gern einen tieferen Einblick in das Bildungssystem erhalten.
Besonders interessierte mich auch der Umgang mit Heterogenität und Vielfalt, welchen Singapur aufgrund seiner multikulturellen Bevölkerung und dem guten Konzept der Integration bietet. Des Weiteren weckte der fortschrittliche Umgang mit digitalen Medien und die Innovationsbereitschaft des Landes mein großes Interesse. Der Name Singapur setzt sich aus den Worten Singha = Löwe und Pura = Stadt zusammen und heißt somit „Stadt des Löwen“.

Marina Bay Sands und Merlion
Durch die weltweite Corona-Pandemie wurden mir viele Steine in den Weg gelegt, welche mein Vorhaben wiederholt verhindert und verschoben hatten.
Bereits zwischen September und November 2020 stand ich bezüglich eines Praktikums mit einer deutschen Schule in Singapur, der German European School Singapore, im E-Mail-Kontakt und führte ein längeres Interview. Gemeinsam mit meinem Partner plante ich einen längeren Auslandsaufenthalt in Singapur, da er von seiner Firma aus die Möglichkeit bekam, dort für mehrere Monate zu arbeiten. Er unterschrieb im Oktober einen Vertrag für ein Jahr in Singapur, beginnend zum Jahr 2021. Leider platzten all meine Pläne im November 2020, da mein Visum, der Work Holiday Pass, abgelehnt wurde. Um diesen zu erhalten, muss man mehrere Kriterien erfüllen und es werden weltweit lediglich zweitausend Stück pro Jahr vergeben.
Nach wiederholten Bewerbungen wurde mir mein Work Holiday Pass für Singapur zu meiner großen Freude im März 2021 endlich genehmigt. Durch erneute Kontaktaufnahme mit der Schulleitung der German European School Singapore war es mir möglich, einen Praktikumsplatz für sechs Monate, zwischen Mai und Oktober 2021, zu erhalten. Des Weiteren bewarb ich mich erfolgreich um ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes im Programm Lehramt.International. Meine Koffer waren gepackt, eine Betreuung für meine beiden Katzen organisiert und passende Flugdaten herausgesucht. Die letzte Formalität war lediglich noch die Einreisegenehmigung, welche für die 14-tägige Quarantäne in Singapur nötig war. Da man diese in speziellen begrenzten Hotels zu absolvieren waren, musste man sich auf einen konkreten Tag bewerben. Mir war beim erstmaligen Ausfüllen des Formulars im März 2021 nicht bewusst, dass anschließend insgesamt 72 Ablehnungen auf meine Anträge folgen würden. Nach insgesamt über einem Jahr der Planung, des Kämpfens und vielen Tränen, kam am 3. September 2021 endlich die Zusage für meine Einreise.

Flug nach Singapur
Der 23. September 2021 war einer der aufregendsten Tage meines Lebens, als ich überglücklich in den Flieger Richtung Singapur stieg. Nach anderthalb Jahren der extrem harten Einreisebeschränkungen saß ich in dem Flieger mit 250 Plätzen mit insgesamt 17 Mitreisenden in einem quasi leeren Flugzeug.
Am 24. September 2021 reiste ich als eine der ersten via Vaccinated Travel Lane (Geimpfte Reiselinie) in Singapur ein, und durch dieses neue Konzept musste ich lediglich mehrere PCR-Tests machen, die Quarantäne blieb mir jedoch glücklicherweise erspart. Leider war die German European School Singapore zunächst noch im Home Based Learning und danach waren Herbstferien, weshalb mein Praktikum erst zum 18. Oktober 2021 endlich starten konnte.

German European School Singapore
Meine Hauptaufgabe als Schulassistenz an der German European School Singapore war die integrative Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf innerhalb und außerhalb des Klassenverbandes. Ich war den Großteil meines Deputats in der Eingangsstufe der Schule eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Sonderform der 1. Klasse, bei welcher die Kinder bereits mit fünf Jahren eingeschult werden und zwei Jahre Zeit für den Stoff der ersten Klasse haben. Dadurch ist mehr Zeit zum Spielen und es kann differenzierter auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Es ermöglicht einen sanfteren Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule. Durch die große Heterogenität der Kinder wird die Eingangsstufe regulär von zwei Lehrkräften unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen fünf und sieben Jahren lernen miteinander und voneinander. Ich unterstützte die Lehrkräfte in Form von Co-Teaching, um den Anforderungen von Inklusion und Heterogenität gerecht zu werden und die individuelle Förderung der einzelnen Kinder zu optimieren. Besonders Schülerinnen und Schüler mit Rechenschwächen, Lese-Rechtschreibschwächen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen sowie Autismus-Spektrum-Störung betreute ich individuell. Zu meinem Aufgabenbereich gehörte außerdem die Unterstützung im Schwimmunterricht, die eigenverantwortliche Leitung der Hausaufgabenbetreuung und die eigenständige Betreuung eines Schülers der dritten Klasse in den Geigenstunden im Rahmen des Musikunterrichts. Ein weiterer Schwerpunkt war die Unterstützung des sprachsensiblen Unterrichts an der Schule, da die Schülerinnen und Schüler der deutschen Sektion mehrsprachig aufwachsen.

Hawker in Jurong East
Die Zeit in Singapur war eine absolut einmalige und eindrucksvolle Erfahrung für mich. Das Leben ist ganz anders als in Deutschland; in vielen Hinsichten ist Singapur sehr fortschrittlich, gerade was Digitalisierung und Architektur angeht. Besonders geliebt habe ich auch die kulinarische Vielfalt. Die Hawker (kleine traditionelle Garküchen) haben alle denkbaren asiatischen Köstlichkeiten zu bieten und ich hatte großen Spaß daran, alles auszuprobieren. Da die Hawker Center Singapurs zum Weltkulturerbe gehören und staatlich gefördert werden (vgl. UNESCO, 2020), können sich die sehr günstigen Preise für die Gerichte halten und man erhält eine vollwertige Mahlzeit schon ab 1,80 S$ (ca. 1,18 €).
Besonders gut gefällt mir der Kontrast zwischen der Großstadt mit beeindruckender Architektur und riesigen, naturbelassenen Parks mit vielen wilden Tieren wie Affen, Waranen, Ottern und Wildschweinen. Annähernd die Hälfte der Fläche Singapurs besteht aus Grünflächen (vgl. Visitsingapore, 2022). Ebenso die kleinen Inseln, die zu Singapur gehören, laden zum Baden am Strand, Schnorcheln und Sonnen ein.
Im Gegensatz dazu gibt es auch einige Aspekte, die ich an Singapur sehr kritisch sehe. Es gibt kaum Meinungsfreiheit, die Medien sind stark eingeschränkt und dürfen praktisch nur Aussagen des Ministry of Manpower oder Ministry of Health zitieren. Des Weiteren gibt es keine Lobby für die LGBTIQ+-Community. Homosexualität wird nicht geduldet und ist sogar verboten (vgl. Auswärtiges Amt, 2022). Während der Corona-Pandemie wurden die Menschen dazu angehalten, andere Bürger und Bürgerinnen bei der Regierung zu melden, die sich nicht an die Regeln halten, was bei erfolgreicher strafrechtlicher Verfolgung sogar finanziell belohnt wurde.

Henderson Waves Brigde
Zusammenfassend ist dennoch zu sagen, dass ich die Erfahrung jederzeit wiederholen würde und mich sehr gern an die Zeit zurückerinnere. Sowohl privat als auch beruflich konnte ich mich durch meine Zeit in Singapur weiterentwickeln und meinen Horizont erweitern. Ich konnte in eine andere Kultur eintauchen und meine Sprachkenntnisse der englischen Sprache signifikant verbessern, da Englisch eine der Landessprachen Singapurs ist. Ebenfalls konnte ich sehr viel praktische Unterrichtserfahrung durch meine Schulassistenz sammeln und erfahren, wie eine deutsche Auslandsschule funktioniert. Durch die Internationalität Singapurs und die deutsche Community, an die ich durch mein Praktikum an der German European School Singapore Anschluss finden konnte, fühlte ich mich schnell heimisch. Es gibt sogar einen German Market, wo man beinahe alle Lebensmittel findet, die man aus dem täglichen Leben in Deutschland kennt.

Blick vom Marina Bay Sands bei Nacht
Da Singapur sehr nahe am Äquator liegt, gibt es keine großen Temperaturschwankungen über das Jahr hinweg und es sind konstant 30 Grad Celsius. Da ich tropische Temperaturen und den täglichen Sommer sehr liebe, war es gepaart mit der internationalen Vielfalt der perfekte Ort für meine Auslandserfahrung.
Nach dem langen Kampf, endlich nach Singapur zu kommen, fühlten sich die drei Monate für mich viel zu kurz an. Mein Partner und ich haben uns so in das Leben in Singapur verliebt, dass wir uns entschieden haben, nach meinem 1. Staatsexamen im Sommer 2022 für ein weiteres Jahr nach Singapur zu ziehen. Ich habe ein Angebot von der German European School Singapore erhalten und mein Partner seinen Auslandsvertrag bei seiner Firma um ein weiteres Jahr verlängert.
Abschließend ist zu sagen, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessern konnte und entdeckte, dass die deutsche Kultur selbst am anderen Ende der Welt gelebt wird. Des Weiteren habe ich mein Traumland Singapur realistischer einordnen können und auch angefangen, einige Tatsachen kritisch zu hinterfragen. Ich lernte Deutschland auf vielen Ebenen mehr zu schätzen. Die Auslandserfahrung hat mir vielfältige Möglichkeiten geboten, neue Perspektiven zu erlangen und in eine andere Kultur einzutauchen.
Ich freue mich sehr darauf, bald an diesen besonderen Ort zurückzukehren und weitere Erlebnisse und Erfahrungen sammeln zu können.

Jewel Waterfall, Changi Airport
Literaturliste:
- Amt, Auswärtiges. „Singapur: Reise- und Sicherheitshinweise (COVID-19-bedingte Reisewarnung)“. Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/singapursicherheit/225412. Zugegriffen 25. Februar 2022.
- Zwischenstaatlicher Ausschuss Immaterielles Kulturerbe | Deutsche UNESCO-Kommission. https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/ausschuss-2020. Zugegriffen 25. Februar 2022.
- 10 erstaunliche Dinge, die Sie nicht über Singapur wussten. https://www.visitsingapore.com/de_de/editorials/amazing-things-you-never-knew-about-singapore/. Zugegriffen 28. Februar 2022.
Lisa studiert Lehramt an Grundschulen und führte im Sommer 2021 ihr zweites Blockpraktikum an der Deutschen Internationalen Schule Kapstadt durch. In ihrem Video gibt sie unter anderem persönliche und spannende Einblicke in den Schulalltag und ihre Reiseerlebnisse während ihres elfwöchigen Aufenthalts.
Axel absolvierte in seinem Lehramtsstudium mehrere Auslandsaufenthalte. Die Planung seines Freiwilligendienstes in der Slowakei startete bereits vor dem Ausbruch der Pandemie, sein Aufenthalt fand dann aber unter pandemischen Bedingungen statt. Wie diese Axels Freiwilligendienst beeinflussten und welche Vergleiche er zu seinen vorherigen Aufenthalten zieht, können Sie in der nachfolgenden Präsentation erfahren.
Falls Sie sich für bestimmte Videoausschnitte bzw. Themen interessieren, sehen Sie hier eine Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte:
00:00 Begrüßung und Einleitung
01:27 Vorstellung und vorheriger Auslandsaufenthalt
04:00 Organisation des Freiwilligendienstes und Bewerbungsformalitäten
08:10 Ablauf des Freiwilligendienstes
12:31 Suche nach einer Unterkunft im Einsatzort
14:01 Finanzierung des Freiwilligendienstes
16:40 Aufgaben an der Schule
19:37 Freizeitaktivitäten
22:14 Persönliches Fazit und Abschluss
* Korrektur zum Video (20:49–20:52): Anstatt „halušky“, einer Art Ziegenkäse, handelt es sich um „bryndza“ (deutsch: Brimsen), eine Art Schafskäse.
Paul studiert Deutsch und Englisch für das Lehramt an Gymnasien an der TU Dresden und absolvierte ein Praktikum an einer Schule in Prag. Die Besonderheit dabei? Es fand digital statt! Wie es dazu kam, wie Paul sein Schulpraktikum erlebte und was er dabei über seine Schüler:innen und sich selbst lernte, beschreibt er in seinem Erfahrungsbericht.
Wer bin ich und wie kam es zu einem Praktikum in Prag?
Mein Name ist Paul-Robert Goß und ich studiere im neunten Semester Lehramt an Gymnasien in den Fächern Deutsch und Englisch an der TU Dresden. Für das Sommersemester 2021 hatte ich eigentlich ein ganz normales Blockpraktikum B im Fach Englisch angemeldet. Die Praktikumsschule war mir bereits zugesichert und kontaktiert und ich hatte mich schon mental auf die täglichen Zugfahrten gen Ostsachsen vorbereitet. Doch bald sollte der Anstieg der Infektionszahlen im Februar 2021 dem planmäßigen Schulpraktikum in Präsenz einen Strich durch die Rechnung machen. Kurz gesagt: Einen Tag vor dem geplanten Antritt wurde mir das Praktikum von der betreffenden Schule abgesagt mit der Begründung, es gebe keine Möglichkeit der digitalen Umsetzung. Ich wandte mich umgehend an meinen betreuenden Dozenten. Es dauerte nicht lange und ich wurde von seiner Antwort überrascht: Er verschaffte mir in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) an der TU Dresden die Möglichkeit, ein digitales Schulpraktikum an der ZŠ Mládí – einer Art Gesamtschule in Prag – zu absolvieren.
Erste Bedenken und Organisation
Zugegeben, ich war anfangs enttäuscht und wusste nicht wirklich, was ich von diesem Angebot halten sollte. Ich hatte mich natürlich sehr auf Präsenzunterricht gefreut. Was mich jedoch noch mehr verunsicherte, war die anstehende Organisation und vor allem: die Kommunikation mit den Beschäftigten der Schule. Würden wir uns gut darüber abstimmen können, wann ich in welche Klasse muss oder wie ich etwas beitragen und planen kann? Hätte ich im digitalen Umfeld oft genug die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eventuell sogar die Lehrenden und Lernenden ein bisschen kennenzulernen? Könnte es sprachliche Barrieren geben? Und nicht zuletzt: Würde ich eigene Unterrichtsstunden halten und virtuelles Classroom-Management meistern können?
Ich war also durchaus skeptisch, ob ich mich in diesem Praktikum selbstsicher und wohlfühlen würde. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich wenig technikaffin bin und daher Online-Unterricht noch nie zu meinen Traumvorstellungen gezählt hatte.
In der E-Mail gab es einen Link zur Schulhomepage. Ich verschaffte mir also einen Überblick über mein potenzielles Praktikumsumfeld. Dabei stachen für mich zwei Aspekte ganz besonders heraus: Erstens gab es vor einigen Jahren in der Tschechischen Republik eine Bildungsreform mit dem „Hauptziel des Bildungsprozesses in unserer Schule, nur das nützliche Wissen zu vermitteln, keine große Menge von Informationen. [Es geht nicht darum], dass unsere Schüler wandelnde Enzyklopädien werden, sondern harmonisierte Menschen, die fähig sind, in dieser modernen Welt zu leben, zu studieren und zu arbeiten.“ Diese progressive Direktive vermochte es tatsächlich, mein Interesse zu wecken, und ich wurde langsam neugierig. Zweitens verfolgte das ZŠ Mládí ein sprachliches Profil, was mir mit meiner Fächerkombination sehr gelegen kam. Ich erhoffte mir, dass dies die Kommunikation erleichtern und mir gleichzeitig die Möglichkeit geben würde, mich für alle Seiten bereichernd einzubringen. Hinzu kommt, dass ich die Chance auf eine komfortable Einbettung des Praktikums in meinen Studienalltag sah. Durch die Verschiebung war abzusehen, dass ich das Praktikum ohnehin mindestens teilweise parallel zu meinem regulären Semester im Home-Office absolvieren müsste und da kam mir Online-Unterricht geradezu gelegen. Auch nicht zu vernachlässigen: Die täglichen Zugfahrten um 5 Uhr morgens blieben mir erspart.
Ich fasste also den Entschluss, das Angebot anzunehmen. An dieser Stelle bin ich dem ZLSB einerseits für die einmalige Möglichkeit, andererseits für die zügige und unkomplizierte Abwicklung zu großem Dank verpflichtet, denn es ging dann alles sehr schnell. Es wurden ein paar Mails ausgetauscht und schon saß ich in einem Zoom-Call mit einem Professor der Prager Hochschule, welcher sich in seinem Zweitjob als lockerer und netter Französischlehrer der ZŠ Mládí herausstellte. Er war als Vermittler für die erste Kontaktaufnahme und die Organisation der Rahmenbedingungen zuständig. Hier merkte ich zum ersten Mal, dass eine gute Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil eines gelingenden Praktikums sein würde, denn unser erstes Gespräch hatte neben einem kurzen Kennenlernen auch etwas von Verhandlungscharakter. Es war ihm wichtig, dass wir uns in prägnanter Form unsere Vorstellungen und Möglichkeiten mitteilten. Ich erfuhr, dass ich der erste Studierende bin, der im Rahmen dieses Programms an der ZŠ Mládí praktizierte und dass die Schule noch nicht ganz wusste, wie sie mich einsetzen könnte. In vorheriger Absprache mit meinem betreuenden Dozenten aus der Englisch-Didaktik war ich natürlich bereit, für Modifikationen und Abweichungen zu einem normalen Blockpraktikum B in Sachsen (z. B. eine geringere Anzahl der selbst gehaltenen Unterrichtsstunden) offen zu sein. Ich betonte aber, dass ich neben dem Hospitieren und Assistieren mich durchaus über die Möglichkeit freuen würde, selbstständig Unterricht zu planen und Stunden zu halten, was für die tschechische Schule nicht selbstverständlich schien. Er meinte, er schaue mal, was sie machen können. Circa eine Woche später hatte ich meinen Zugang zur virtuellen Arbeitsumgebung (Microsoft Teams) und die Namen meiner späteren Mentor:innen, zu denen ich nun Kontakt aufnehmen sollte.
Der Praktikumsablauf und die digitalen Tools
Ich arbeitete natürlich hauptsächlich im Englischunterricht in einer siebten und einer neunten Klasse, anfangs lediglich hospitierend, später selbst unterrichtend. Da an der Schule jedoch auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wurde, kontaktierten mich bald auch Lehrkräfte aus diesem Fachbereich. In Absprache mit meinem TU-Dozenten ergänzte ich mein Englisch-Praktikum mit regelmäßigen Besuchen des Deutschunterrichts, in denen ich mich als Muttersprachler z. B. für Konversationsspiele zur Verfügung stellte. Jeder Kurs hatte auch eine Offline-Stunde in der Woche – eine Freiarbeitszeit für selbstständige Arbeit oder die Erledigung größerer Hausaufgaben. So gab es für mich circa sechs Stunden pro Woche vorzubereiten. Dadurch, dass ich das Praktikum parallel zu meinem regulären Semester absolvierte, war das Pensum etwas entzerrt. Ursprünglich war auch eine Zeit von ungefähr vier Wochen geplant. Die Zusammenarbeit funktionierte jedoch so gut, dass wir das Praktikum bis zum Ende des Online-Unterrichts in Tschechien verlängerten, wodurch am Ende fast zwei Monate Praktikumszeitraum entstanden.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine anfängliche Sorge, dass ich mich mit den digitalen Abläufen nicht so leicht zurechtfinden würde. Ich hatte mir schon holprige Planungsabsprachen per E-Mail ausgemalt, doch die ZŠ Mládí hatte eine bessere Lösung parat. Mit Microsoft Teams verwendete die Schule eine digitale Arbeitsplattform mit Gruppenräumen für jede einzelne Klasse und jeden Kurs, wo Mitteilungen getätigt, Arbeitsmaterialien und Lösungen gespeichert sowie Tests und Klausuren bereitgestellt werden konnten. Es gab auch eine mit einem Kalender verbundene Videokonferenzfunktion. Die Unterrichtsstunden fanden also als dreißig- bis vierzigminütige Videokonferenzen statt; Arbeitsmaterialien und wichtige Ankündigungen konnten über die Gruppen geteilt werden. Über eine Kommentarfunktion waren auch weitere Absprachen und Nachfragen möglich. Als besonders wertvoll stellte sich aber auch eine Chat-Funktion heraus. Diese war stets der Weg, auf dem ich meine Mentor:innen kontaktieren und Absprachen treffen konnte, was erstaunlich gut funktionierte. Die Lehrkräfte der Schule waren sehr hilfsbereit und offen und der Chat fungierte als unkomplizierte Möglichkeit, kurze Fragen loszuwerden. Für längere Planungen erstellten wir einfach eine kurze Videokonferenz. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, mit euren Schüler:innen zu chatten? Zuerst entdeckte ich dieses Novum für mich, als ich mir auf diesem Wege die Ergebnisse mancher Hausaufgaben zuschicken ließ, um im Gegenzug direktes persönliches Feedback zurückschicken zu können. Bald wurde dies aber auch der Kommunikationskanal für individuelle Fragen von Seiten der Lernenden. Zunehmend genoss ich es, meine Lehrertätigkeit etwas progressiver und flexibler zu denken. Ein fix geteiltes Foto von der Lösung statt eines umfangreichen Vergleiches im Unterricht, gemeinsame Dokumente statt kopierten Arbeitsblättern, Padlet statt Tafel. Besonders begeistert war ich tatsächlich auch von der digitalen Version des Lehrbuchs. Dieses war nämlich auch interaktiv gestaltet, sodass Lösungen von Lernenden selbst in Aufgaben eingetragen werden konnten. Zudem gab es viele eingebettete Sound- und Videodateien, was die Veranschaulichung mancher Aufgaben stark vereinfachte.
Natürlich gab es aber auch einige Aspekte der digitalen Unterrichtsumgebung, die mich immer wieder vor Herausforderungen stellten und sogar etwas traurig machten. Das erste, was mir auffiel, war, dass die älteren Schüler:innen, die ich hauptsächlich unterrichtete, partout ihre Kamera nicht anschalten wollten. Wir hatten viele interessante Unterrichtsgespräche und sogar die ein oder andere lustige Konversation vor den Stunden und so lernte ich nach und nach die Charaktere kennen, die sich hinter den mehr oder minder kreativen Avataren (viel zu oft war es „Kermit der Frosch“) versteckten. Ich bekam jedoch sehr selten ein Gesicht zur Stimme zu sehen. Die Schule hatte beschlossen, die Kamera nicht zur Verpflichtung zu bestimmen, und so konnten wir auch nicht konsequent kontrollieren, ob alle Lernenden anwesend sind. Dafür hatten einige wenige Schüler:innen konsequent technische Probleme, die sie leider bis zuletzt nicht beheben konnten oder vielleicht auch wollten. Ich begann zunehmend, Fragen und Aufgabentypen in meine Stunde einzubauen, die hauptsächlich den Zweck verfolgten, zu kontrollieren, dass möglichst alle Lernenden anwesend waren und mitarbeiteten.
Zudem merkte ich schnell, dass man das Zeitmanagement im Unterricht komplett neu denken musste. Es konnte dauern, bis sich die komplette Klasse zugeschaltet hatte, und jede Erklärung hinsichtlich der Benutzung einer neuen Methode, jeder zu klickende Link brauchte Zeit. Deutliche Kommunikation der Aufgabenstellungen, aber auch Geduld und Offenheit für immer wiederkehrende Fragen waren unerlässlich, aber auch nicht immer einfach aufzubringen. Es wurde demnach auch zur Übung, penibel darauf zu achten, dass die Aufgaben nicht zu umfangreich und komplex für die eng bemessenen Zeitfenster waren. So gab es zwar Break-out-Räume, jedoch überlegte ich es mir lieber zweimal, ob eine Gruppen- oder Partnerarbeit so wichtig war. Dreißig oder vierzig Minuten vergingen im digitalen Klassenzimmer immer wie im Flug.
Schöne Momente mit und ohne Kamera
Mein größter Lichtblick im Dunkel der ausgeschalteten Kameras: Digitaler Unterricht kann auch eine Menge Spaß machen! Diese Tatsache habe ich gänzlich der Offenheit der Lehrpersonen und vor allem aber auch der Lernenden zu verdanken. In jedem Kurs hatte ich einige, die stets zu interessanten oder teils auch witzigen Diskussionen beitrugen. Ich konnte mich eigentlich immer darauf verlassen, dass genug Lernende mit mir sprechen würden. Manchmal musste ich auch zwei besonders kommunikative Lernende im Fach Englisch bremsen, die allzu gern die gesamte Stunde lang im Beisein der gesamten Klasse zum Thema diskutiert hätten.
Besonders angetan war ich im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, in dem ich mich unverhofft sehr stark konzentrieren musste, um einen geduldigen, deutlichen und verständnisvollen Konversationspartner abzugeben. Die Klassen hatten noch nicht lange Deutschunterricht und so verlief die Kommunikation sehr schleppend. Ich war jedoch davon begeistert, wie viel Mühe sich alle gaben, um mir z. B. von ihren ebenso beeindruckenden Hobbys (wie Tiefseetauchen, Aquaristik oder 3-D-Drucken) zu berichten. In einem Kurs waren sogar beim ersten Mal fast alle Kameras eingeschaltet. Ich musste etwas schmunzeln, als ein Schüler sich sogar extra für den „Muttersprachler“ schick gemacht und einen Anzug angezogen hatte. Mein Lachen konnte ich dann nur schwer unterdrücken, als kurzzeitig seine Kamera ausging und er ein paar Minuten später im Pullover dasaß. Er fühlte sich dann vielleicht doch etwas unwohl – so allein im feinen Zwirn.
Bei so einer tollen Lehratmosphäre ist es wohl kaum verwunderlich, dass es für mich ein absolutes Highlight war, endlich direkt nach Prag zu reisen. Mit der Schulöffnung im Mai endete mein digitales Praktikum, doch ich war begeistert, dass mir eine Lehrerin vorschlug, die Schule bald mal live zu besuchen und obendrein anbot, mich in ihrem Haus aufzunehmen. So verbrachten wir einen sehr lustigen Abend mit ihren Freunden, bevor ich am nächsten Tag als Überraschung für die Lernenden fungierte. Es war die letzte Schulwoche und so wurden viele Spiele und sogar kleine Klassenzimmer-Partys gefeiert. Ich war aber vor allem von der Zugewandtheit überwältigt, welche mir entgegengebracht wurde. Ein junger Deutschlehrer, mit dem ich zuvor viel zusammengearbeitet hatte, kam an seinem freien Tag extra in die Schule, um mich kennenzulernen, und wir verbrachten zusammen den Schultag, da wir uns blendend verstanden. Auch die Lernenden waren sehr neugierig und einige ließen gar nicht mehr von mir ab. Ich war beeindruckt darüber, dass wir uns auf Englisch wunderbar unterhalten konnten.
Ein digitales Schulpraktikum – mein Fazit
Grundsätzlich wünsche ich allen Studierenden und auch den Schüler:innen, dass Ihre Stunden in Präsenz stattfinden können. Auch ich hätte dieses Praktikum allzu gern live absolviert. Der direkte Kontakt, die Möglichkeiten eines echten Klassenzimmers und eine direkte (leibhaftige) Rückmeldung durch die Lernenden kann ein virtueller Unterrichtsraum nicht bieten. Mein Besuch vor Ort konnte dies schließlich auch nur teilweise kompensieren.
Tatsache ist jedoch auch: Ohne Homeschooling hätte dieses Praktikum in Prag nie stattgefunden. Ich habe jede Menge nette Menschen kennengelernt, zu denen ich teilweise immer noch über WhatsApp Kontakt halte. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass die digitale Vernetzung den Grundstein unserer Zusammenarbeit legte. Zudem hatte ich definitiv die Möglichkeit, mich als angehende Lehrperson auszuprobieren und auch zu erleben, dass Homeschooling mit motivierten Lernenden auf jeden Fall möglich ist und man sogar von einigen digitalen Werkzeugen und Möglichkeiten profitieren kann. Ich möchte mir diese unbedingt in den „normalen“ Schulalltag mitnehmen und diese Erfahrung auf keinen Fall missen. Ein beruhigender Aha-Effekt war auch: Solange man sich gut abspricht und man auch im virtuellen Klassenzimmer offen und zugewandt kommuniziert, fühlt man sich auch am heimischen Schreibtisch nicht allein.
In diesem Video sprechen vier Lehramtsstudierende miteinander über die Vorbereitung ihrer Auslandsaufenthalte, Herausforderungen, die sie meistern mussten und auch ihre Learnings.
Falls Sie sich für bestimmte Videoausschnitte bzw. Themen interessieren, sehen Sie hier eine Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte:
0:00:00 Begrüßung und Vorstellung der teilnehmenden Studierenden
0:02:42 Vorbereitung und Organisation der Auslandsaufenthalte
0:12:12 Erwartungen, erste Eindrücke und Herausforderungen
0:19:45 Praktika während der Pandemie
0:59:25 Sprache, Kommunikation und Vernetzung
1:01:11 Chancen und Lessons Learned
1:06:03 Ausblick und Tipps
In diesem Video berichten die Lehramtsstudierenden Lilly, Ulrike, Axel und Paul von ihren im Jahr 2021 erlebten Auslandserfahrungen © ZLSB
Religion und Säkularität – Wüste und fruchtbares Land – Großstädte und ländliche Regionen: Schon seit ihrer Kindheit interessiert sich Amelie für Israel. Innerhalb ihres Grundschullehramtstudiums absolvierte sie 2022 über drei Monate ein freiwilliges und selbstorganisiertes Praktikum an der dortigen Partnerschule des ZLSB, der Tabeetha School Jaffa. In ihrer Präsentation gibt sie Einblicke in den Planungsprozess, die Zeit in Israel und schildert ihre Erfahrungen an einer Schule des britischen Bildungssystems.
Lisa-Marie absolvierte 2022 ein dreieinhalbmonatiges Praktikum in einem französischen Weinbaubetrieb im schönen Elsass. Warum sie sich für diese besondere Art eines Auslandsaufenthaltes entschied und wie ihr Praktikum zu ihrem Lehramtsstudium für die Fächer Französisch und Geographie an Gymnasien passt, hat sie in ihrem Bericht festgehalten.
Nancy plante schon länger einen Auslandsaufenthalt, musste diesen aufgrund der Pandemiesituation aber immer wieder verschieben. Letztendlich ergriff sie doch die Chance und absolvierte ihr letztes Blockpraktikum B an einer deutschsprachigen Schule in Panamá.
Podcast-Reihe „Going abroad – Lehramtsstudierende berichten von ihren Erfahrungen im Ausland“
In diesen Podcasts berichten Studierende im Lehramt der TU Dresden von ihren ganz persönlichen Erfahrungen, die sie während ihrer Studienzeit im Ausland gesammelt haben. Ob obligatorischer Aufenthalt oder freiwillig, ob selbstorganisiert oder mit einem strukturierten Programm, ob Japan oder Dänemark – in den Podcasts erfahren Sie Wissenswertes rund um die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, während des Studiums ins Ausland zu gehen und erhalten Tipps aus erster Hand für die Planung Ihres eigenen Aufenthalts!
Hinweis: Die Podcasts konnten coronabedingt nur telefonisch aufgezeichnet werden und haben daher zum Teil eine gemischte Tonqualität, die wir zu entschuldigen bitten. Alle Beiträge sind jedoch gut zu verstehen und zusätzlich mit einer Transkription versehen.
„Eigentlich hat mich bewegt, dass ich gerne nur mal eine Erfahrung für mich machen wollte und mir klar geworden ist, dass ich wahrscheinlich nie wieder so günstig und gut strukturiert gefördert ins Ausland komme wie im Studium.“
[Intro]
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Serie „Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Heute spreche ich mit Anja, die in Bologna (Italien) ein Semester studiert hat. Anja studiert Lehramt für berufsbildende Schulen mit den Fächern Gesundheit und Pflege sowie Gemeinschaftskunde, Recht und Wirtschaft. Im Ausland war sie von Februar bis Juli 2019 während ihres 5. Fachsemesters.
Frage: Hallo Anja! Stell dich doch nochmal bitte kurz vor.
Anja: Okay. Ich bin Anja, 29 Jahre alt und studiere aktuell Berufsschullehramt oder Lehramt für berufsbildende Schulen in den Fächern Gesundheit und Pflege und Gemeinschaftskunde, Recht und Wirtschaft. Jetzt im 9. Fachsemester, das heißt kurz vor Ende. Und ja, ich freue mich, hier dabei sein zu können.
Frage: Erzähl uns doch mal von deinem Auslandsaufenthalt. In welchem Land warst du? Und mit welchem Programm?
Anja: Ich war in Italien, in der Stadt Bologna. Hab das Ganze über das Erasmus-Programm gemacht.
Frage: Musstest du dafür Italienischkenntnisse vorweisen oder hast du das einfach so gemacht?
Anja: Ich musste zunächst kein Italienischvorkenntnisse vorweisen. Englisch war ausreichend, je nachdem, welche Kurse ich an der Gasthochschule belegt habe und da ich englischsprachige Kurse belegt hatte, war mein B1 Level, was ich mit dem Abschluss des Abiturzeugnis erreicht habe, ausreichend.
Frage: Über welchen Zeitraum warst du denn im Ausland?
Anja: Ich war vom Februar 2019 bis Juli 2019 in meinem 5. Fachsemester in Bologna und habe dort Politikwissenschaft studiert. Ich bin über mein Zweitfach reingegangen und genau hab dort Module für mein Zweitfach anrechnen lassen.
Frage: Was hat dich denn zu deinem Auslandsaufenthalt bewegt?
Anja: Ja, das war eigentlich eine recht spontane Sache. Also so spontan, wie so ein Auslandssemester sein kann in Bezug auf die langwierige Vorbereitung. Aber eigentlich hat mich bewegt, dass ich gerne nur mal eine Erfahrung für mich machen wollte und mir klar geworden ist, dass ich wahrscheinlich nie wieder so günstig und gut strukturiert gefördert ins Ausland komme wie in Zeiten vom Studium. Also sprich, später auf Arbeit wird mir das so leicht nicht mehr möglich sein. Und auch wenn ich zu dem Zeitpunkt für „normale“ Erasmus-Studierende vielleicht etwas älter war, was auch so meine Skepsis war, ob ich nicht schon zu alt bin mit – damals war ich 27, wurde dann 28. Ich hatte auch so ein Vorurteil oder so meine Vermutung zu Erasmus-Studierenden, dass sie halt so 21 sind, grad so mitten in der Party Phase sind. Deshalb war ich erst gar nicht so angetan.
Habe dann aber gemerkt, dass mein Partner, der auch älter war, selbst Erasmus gemacht hat ein Jahr zuvor, dass das eigentlich doch eine ziemlich coole Sache ist und man immer die Entscheidung darüber hat, was man draus macht. Und deswegen hab ich einfach die Vorurteile abgelegt und gesagt, ich möchte die Sprache lernen und ich will einfach mal auch im Studium kurz den Druck rausnehmen, nicht immer alles nach Plan absolvieren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt des Studium auch als recht stressig wahrgenommen und war dann einfach so: Ich mach es einfach.
Frage: Was waren denn deine Gründe für die Wahl des Landes und der Universität?
Anja: Als mir klar war, ich möchte irgendwie ins Ausland, hab ich erstmal gesucht, auch in meinem Erstfach, Gesundheit und Pflege, was es so für Partnerunis gibt, war auf den ganz gängigen Seiten über die Fakultät und Partneruniversitäten und hab dann erst einmal festgestellt, dass es für Gesundheit und Pflege, gerade Berufsschullehramt, was so in Deutschland auch relativ einzigartig ist, aber international nicht so vertreten ist, weil dieses Schulsystem Berufsschule in anderen Ländern ja gar nicht so ausgefallen existiert und dachte, ich guck einfach bei Gemeinschaftskunde, weil die Politikwissenschaft hat sicherlich ganz, ganz viele Partnerunis und so war es dann auch und dann war das mehr oder weniger einfach so eine intuitive Entscheidung, dass ich dann auf Bologna gestoßen bin und dachte so „hm, war ich noch nie“ und hab dann mal gegoogelt. Ehrlich gesagt, weil ich war zwar schon einige Male in Italien, aber noch nie in Bologna und dann liest man gleich so Sachen wie älteste Universität Europas und perfekte Stadt zum Studieren. Und dann hab ich mich einfach für Bologna entschieden.
Frage: Wie hast du denn gewohnt und wie hast du dir eine Unterkunft organisiert?
Anja: Also ich hab in einer WG gewohnt. Die Wohnungssuche war ganz schön schwierig dadurch, dass halt Bologna wie gesagt eine sehr, sehr große Uni hat, auch sehr bekannt ist. Für Erasmus gibt es dort unglaublich viele Seiten und Facebook-Gruppen, wo Zimmer zu unterschiedlichsten Preisen und Bedingungen und Zuständen vermietet werden. Teilweise schon mit leicht, also da muss man vorsichtig sein, vor Betrügern. Das wurde einem auch immer gesagt, dass viele Menschen sehr viel Geld verdienen wollen. Deshalb war ich in zwei oder drei verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich einfach dann als klar war, dass ich auch wirklich hingehe, immer mal wieder geschaut habe, dann ganz klassisch: Angeschrieben, angeschrieben, angeschrieben, die Leute. Dann war ich aber auch auf paar offiziellen Seiten sowie bei uns „WG-gesucht“. Hab dann Antworten bekommen manchmal, manchmal aber auch nicht. Dann war mein Italienisch zu dem Zeitpunkt eigentlich schlicht noch nicht vorhanden. Deshalb musste man teilweise sehr vorsichtig sein, wie die Zimmer beschrieben waren. Ich hab dann irgendwann auch rausgefunden, dass es ganz, ganz gängig ist, dass in Italien nicht Einzelzimmer vermietet werden, sondern einfach nur ein Bett. Das heißt, dass wenn man nicht genauer liest und teilweise waren auch keine Bilder vorhanden, dass es dann auch sein kann, dass du für 500 Euro nur dir das Bett gemietet hast und das noch mit jemand anderem teilst. Das ist eine ganz gängige Wohnsituation in Bologna. Ich hatte dann letztendlich das Glück, dass ich über Facebook jemanden angeschrieben habe. Wir haben daraufhin ein Skype-Treffen vereinbart. Ich habe mit demjenigen geskypt und ja, er hat sich tatsächlich für mich entschieden. Ich war erst ein bisschen ängstlich, weil viele echt auch vor Ort waren und sich die Wohnungen anschauen konnten. Und dann dachte ich, ich nur über Skype, da hab ich erst einmal weniger Chancen. Aber so hab ich die Wohnung gefunden und hatte auch ein Zimmer für mich alleine und war dann ganz glücklich.
Frage: Zu wie vielen habt ihr denn in der Wohngemeinschaft zusammen gewohnt?
Anja: Also die Wohnung, die ich dann gefunden habe, dort waren neben mir noch zwei weitere Studierende. Einer aus Kroatien, der auch Erasmus gemacht hat, und einer, der in Italien gewohnt hat, also ein Italiener.
Frage: Welche Fächer bzw. Module hast du an der Hochschule studiert?
Anja: Ich habe an der Hochschule oder an der Uni in Bologna Politikwissenschaft studiert, weil ich ja über mein Zweitfach Gemeinschaftskunde das Erasmus-Programm absolviert habe. Und dort habe ich insgesamt drei Module belegt, plus einen Sprachkurs. Den hab ich mir aber privat besorgt. Und ja, die Module haben so im Groben den Modulen entsprochen, die auch hier an der TU Dresden vorgesehen waren.
Da hab ich vorher drauf geachtet, dass ich mir da auch ein bisschen was anrechnen lassen kann. Und das waren dann Module in dem Bereich Internationale Beziehungen, politische Theorie und Verfassungsrecht.
Frage: Wie lange im Voraus hast du denn ein Auslandssemester geplant?
Anja: Ich hab angefangen mich zu bewerben ein Jahr vorher und war damit schon fast zu spät. Ich hab im März 2018 die Bewerbung mich beworben und dann auch relativ schnell im Nachrückverfahren fast die Zusage bekommen im April 2018. Also ziemlich genau auf dem Monat, ein Jahr.
Frage: Was gibt es denn deiner Meinung nach bei der Planung zu berücksichtigen?
Anja: Auf jeden Fall den Zeitpunkt. Wie gesagt, der ist sehr, sehr früh, also ein Jahr vorher. Also ein bis anderthalb Jahre vorher. Ich weiß zwar auch, dass es so Restplätze gibt, das ist halt auch noch die Möglichkeit gibt, es wirklich spontan zu machen. Aber die Regel ist wohl so anderthalb, ein Jahr vorher. Ich habe dann zunächst mein Erasmus-Beauftragten von der Fakultät hier an der TU Dresden kontaktiert. Der hat meine Bewerbung schon bekommen und er hat dann auch alles weitere in die Wege geleitet. Und das Akademische Auslandsamt der TU Dresden war bei mir immer ein Ansprechpartner und da konnte ich mich auch immer mit Fragen hinwenden. Und als dann klar war, dass ich genommen worden bin, hab ich auch den Kontakt zu meinem Erasmus-Koordinator in Bologna erhalten und konnte auch mit dem Kontakt aufnehmen. Ich hatte das Glück, dass dieser Deutsch konnte und echt immer sehr flink war im Antworten. Da wurde mein erstes Vorurteil über Italiener schon aufgebrochen. Also er war immer stets zuverlässig. Und dadurch, dass er Deutsch konnte, konnten wir sehr leicht miteinander kommunizieren, das war sehr gut. Ja, dann hab ich angefangen aufgrund der Förderung, die man ja bekommt, über das Erasmus-Programm, muss man so ein Learning Agreement erstellen. Das heißt, da sollen relativ zeitig die Kurse festgelegt werden, die man an der Partneruniversität studieren oder belegen möchte. Und daran wird dann halt so dein Studienplan für das Semester. Nun war aber ja noch ein Jahr Zeit. Das heißt, auf der Website der Universität in Bologna war natürlich noch kein aktueller Kursplan und man brauchte erstmal eine ganze Weile, um sich dort überhaupt erst mal zurechtzufinden. Wenn ich mir vorstelle, wie die TU-Seite und OPAL ist ja schon für heimische Studierende manchmal überfordernd. Das war eigentlich die größte Arbeit dort, sich in diesen Online-Kursangeboten zurechtzufinden.
Frage: Wie hast du dein Auslandssemester finanziert?
Anja: Durch die Erasmus-Förderung, die man bekommt. Das ist ja, man bekommt die zwei-gestaffelt. Den ersten Teil, 70 Prozent der Summe bekommt man vor dem Erasmus und 30 Prozent bekommt man, wenn man das Erasmus-Semester erfolgreich, also auch, dass man nachweisen kann, dass man ein paar Credit Points erreicht hat, danach ausgezahlt. Außerdem habe ich Auslands-Bafög beantragt. Da war ich mir auch relativ sicher, dass ich es bekomme, weil ich auch schon reguläres Bafög bekomme und ich schon oft gehört habe, dass das Auslands-Bafög sogar leichter zu bekommen ist als das heimische Bafög. Und so hatte ich halt die beiden Geldquellen und es war aber gut.
Frage: Wie gut schätzt du denn die finanzielle Unterstützung durch Erasmus+ ein?
Anja: Ich denke, die finanzielle Unterstützung ist ausreichend, da sie ja auch in diese Länder-Kategorien eingeteilt ist. Also es gibt ja diese drei Ländergruppen und je nachdem, ich denke, wie hoch der Lebensstandard in dem jeweiligen Land ist, werden die Länder dort eingruppiert und Italien empfinde ich als ein sehr teures Land in Bezug auf die Miete und Supermarktpreise und ist in der Gruppe 2. Also ich weiß es jetzt gar nicht aktuell, aber ich glaube, die rechnen mit einem monatlichen Verfügungsrahmen von 350 Euro. Ist auf jeden Fall viel Geld dafür, dass es einfach eine Förderung ist, die man bekommt und auch nicht zurückbezahlen muss. Es war erstmal so ein bisschen irritierend, weil man die Summe als Ganzes bekommen hat und auch Monate bevor das Erasmus-Semester losging. Eigentlich, das heißt, es war einem gar nicht so bewusst, dass man dieses Geld bekommen hat, weil wenn man das jetzt nicht auf einem separaten Konto und ich gebe das jetzt dann wirklich nur aus, sobald ich dann in Italien bin und nicht davor, war das jetzt gar nicht so bewusst, dass man da Geld bekommen hat. Aber auf den Monat gerechnet, fand ich es schon ausreichend und gut.
Frage: Wie unterscheidet sich denn das Studium an der Universität in Bologna gegenüber deinem Studium an der TU Dresden?
Anja: Es ist ja so, dass Bologna die älteste Universität Europas ist und das spürt man beim Betreten der Fakultät. Das ist wirklich der Wahnsinn für mich gewesen, in solchen sehr antiken Räumlichkeiten zu sein. Also die Seminarräume hatten eher Ähnlichkeit mit der Sixtinischen Kapelle als mit dem Weberbau bei uns in der Lehre. Obwohl der ja auch schon recht alt ist. Aber das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, also ganz allgemein so von den Räumlichkeiten, die Seminarräume, in denen ich jetzt war, also ich hab jetzt nicht die ganze Universität kennengelernt, weil diese sich auch total in das Stadtbild integriert. Es gibt nicht einen großen Campus, sondern je nachdem, in welcher Fakultät du studierst, bist du an unterschiedlichen Standorten in der ganzen Stadt. Aber den Standort, den ich jetzt kennenlernen durfte, da waren die Seminarräume erstaunlich klein und es gab so die ganz klassischen Stühle mit den ausklappbaren Tischen. Also nicht so Reihen, sondern es war teilweise eine ganz schön klapprige Angelegenheit. Es war viel kleiner, aber auch sehr, sehr antik, sehr schön, so von der Atmosphäre.
Der Unterricht bzw. die Seminare, Vorlesungen, didaktisch hab ich auch einen großen Unterschied wahrgenommen, weil ich empfand sie als sehr frontal. Es hat wenig Interaktion stattgefunden. Gut, jetzt war ich auch nicht in einem Lehramtsstudium, wo irgendwie Gruppenarbeiten und sehr viel so wie wir es von der TU Dresden jetzt im Lehramt kennen, sondern es war einfach Politikwissenschaft. Es hat während der Seminare wenig Interaktion zwischen dem Dozenten oder Dozentin stattgefunden und den Studierenden. Aber das Engagement und die Teilnahme vor allem ist mir aufgefallen, war während des Semesters eigentlich gleichbleibend, was man so von der TU Dresden, also von meinem Studium hier zu Hause, manchmal ja auch nicht kennt. Da wird es ja dann doch etwas weniger, oftmals gegen Ende des Semesters. Auch die Prüfungen, muss ich sagen, haben sich auch deutlich unterschieden.
Also nicht von dem, was angeboten wurde, von Hausarbeiten, Essays über schriftliche Klausuren, mündliche Prüfungen, das ist so das Gleiche. Aber z.B. bei den Klausuren gab's unglaublich viele Termine, die man auswählen konnte. Das war, fand ich sehr studierendenfreundlich und die mündlichen Prüfungen, davon hatte ich zwei, da war es so, dass alle in einem Raum waren und alle haben allen zugehört. Das war für meine Aufregung nicht gerade hilfreich, weil ich dachte im ersten Moment, dass ich kann mich gar nicht fokussieren, weil es dadurch auch ein anderer Geräuschpegel war und man hat die anderen schon gehört, bevor man selbst dran war. Also es war aber eine ganz andere Prüfungssituation, wie wir sie hier kennen.
Frage: Und fandest du es einfach, während deines Auslandssemester Kontakte zu knüpfen? Und wo hast du sie denn geknüpft?
Anja: Also Kontakte zu anderen Erasmus-Studierenden, aber auch zu Einheimischen, wenn man nicht ganz schüchtern ist, sind echt leicht zu knüpfen. Also klar an meinem ersten Tag, es gibt die klassischen Programme wie „ESN“ oder „ESEC“. Das sind so ihrer Erasmus-Programme vor Ort von jungen Menschen, die Lust haben, halt fremde Studierende irgendwie in die Stadt einzuführen und organisieren Ausflüge, aber auch z.B. Sprachkurse. Und da war ich gleich nachdem ich angekommen bin, war am gleichen Abend noch auf so einer Bologna „Free Walking Tour“, so das ganz klassische. Bin ich erst einmal hin. Da war natürlich die Erasmus-Bubble, hat sich vor mir aufgetan und ich bin mitten rein. So und dann war man natürlich erst mal am Connecten und Quatschen. Und tatsächlich sind diejenigen, die ich an dem ersten Abend dort auf dieser Free Walking Tour und anschließend noch in einer Bar kennengelernt habe, auch noch weiterhin meine Begleiter geblieben, so für die restliche Zeit. Also es sind auch immer wieder neue dazugekommen, aber ich würde sagen, der Kern hat sich tatsächlich fast am ersten Abend herausgebildet. Und dann hab ich aber, weil meine Hauptintention ja auch war, die Sprache zu lernen, mich über Facebook in einer Tandemgruppe angemeldet oder eingeschrieben und hab dort Italiener und Italienerinnen angeschrieben, ob sie mal Lust haben, sich zu treffen.
Ich biete Deutsch und suche Italienisch und ja, da habe ich eine junge Frau kennengelernt. Zum Glück relativ am Anfang. Ich glaub in meiner dritten Woche haben wir uns das erste Mal getroffen und es hat sehr, sehr gut gepasst. Und ich hab dadurch zum Glück auch einen guten Zugang in die einheimische Welt bekommen und wir haben immer noch Kontakt und es ist eine gute Freundschaft daraus entstanden.
Frage: Was hat dir denn am Studieren in Bologna gefallen und was weniger?
Anja: Dass ich deutlich weniger Module belegen musste, als ich es normalerweise in einem Semester hier an der TU Dresden mache. Weil man halt einfach so ich habe diese drei Module gehabt. Die waren zwar zeitaufwändiger als die Module, die wir hier haben, also die fanden zweimal die Woche à zwei Stunden statt. Also ich glaube, es entspricht ja hier zwei Semesterwochenstunden und in der Regel haben wir hier nur einmal die Woche ein Seminar oder eventuell noch eine Vorlesung. Aber dadurch konnte man sich auf die Sachen, die man hat, besser fokussieren. Also das hat mir besser gefallen. Mir ist natürlich klar, dass es hier im normalen Studienablauf zu Hause so nicht geht, weil dann würde man ja wahrscheinlich zehn Jahre studieren, bis man das Soll-Angebot voll hat, das ist jetzt eher ein Vorteil von Erasmus-Studierenden. Aber das hat mir sehr gut gefallen, dass ich einfach nur drei Module belegt habe.
Weniger gefallen hat mir beim Studieren schon so ein bisschen dieser frontale Unterricht, dass man einfach drin saß, mit seinem Laptop mitgeschrieben hat, mitgeschrieben hat und mitgeschrieben hat. Nach zwei Stunden Laptop zu – fertig. In den Modulen, die ich belegt habe, hätte ich mir bei manchen Themen, die diskussionswürdig waren meiner Meinung nach, gerne so ein bisschen auch vom Dozenten eine bessere Moderation gewünscht. Es wurde zwar immer klar Platz für Fragen gelassen, so „Gibt's noch Fragen?“, so die letzten zwei Minuten. Manchmal kam noch was, aber es waren dann mehr so Verständnisfragen. Man hatte dadurch nicht so viel Austausch oder Diskussionen während der Seminare. Das finde ich hier in Dresden deutlich angenehmer oder besser.
Frage: Wie verlief denn die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die du in Bologna absolviert hast?
Anja: Zuvor, also bevor ich gegangen bin nach Bologna, habe ich mit der zuständigen Mitarbeiterin aus der Fakultät, mich schon mal getroffen und ihr eine Liste gegeben mit den Modulen, die ich belegen möchte und deren Modulbeschreibungen auf Englisch, die ich dann dort auf der Internetseite gefunden habe. Und dann haben wir schon im Gespräch zuvor ausgemacht oder hat sie mir nochmal ein Feedback geben: Ja, ist es möglich oder nee, da glaubt sie das zu unterschiedlich vom Inhalt. Und das haben wir gemeinsam dann abgesprochen. Und sie hat mir dann am Ende ihr Okay gegeben, dass die Module, die ich ausgewählt habe, dass die auch anrechenbar sind für die, die und die Module hier in Dresden, d.h. da hatte ich auf jeden Fall Sicherheit. Und dann hab ich die Module belegt und hab da meine Prüfungen gemacht, die Credit Points bekommen. Und dann am Ende, also als ich wieder in Dresden war, bin ich dann mit meinem Learning Agreement wieder zu dem Beauftragten, der dafür zuständig ist, gegangen und dann war es innerhalb von 10 Minuten, paar Klicks, wurden mir dann die Noten dort eingetragen. Das war total unkompliziert. Ich muss aber sagen, was gut war, dass ich vor meinem Erasmus-Semester all diese Absprachen, die ich mit der Anrechenbarkeit per E-Mail geklärt habe, weil nach meinem Erasmus-Aufenthalt der Ansprechpartner gewechselt ist, sodass der jetzt überhaupt nichts wusste, was ich zuvor mit seiner Kollegin abgesprochen habe. Und dadurch, dass ich das alles schriftlich hatte, was sie mir bestätigt hat, dass ich das anrechnen lassen kann, war das für ihn halt auch total die große Hilfe.
Frage: Hat sich dein Studienablaufplan durch das Auslandsstudium verändert?
Anja: Ja, mein Studienablauf ist eigentlich dadurch gänzlich durcheinandergeraten, wobei durcheinander jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist. Ich habe einfach auch gemerkt, dass dieser Ablaufplan, der ja vorgegeben ist, auch letztendlich nur als eine Empfehlung ausgesprochen ist, die zwar sinnvoll ist, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, Module aus dem 8. Semester schon im 5. Semester zu machen.
Frage: Was nimmst du denn aus deinem Auslandssemester mit, was z.B. auch für deine zukünftige Tätigkeit wichtig sein könnte?
Anja: Ich habe ja in Bologna jetzt kein Lehramt studiert und daher kann ich sagen, dass ich so fachlich-inhaltlich nichts jetzt für mein späteres Lehrerinnen-Dasein mitgenommen habe. Aber menschlich und von meinen Erfahrungswerten habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und da ich denke, dass man als Lehrperson nicht nur, sag ich mal, die Marionette seines Faches ist, sondern halt auch menschlich für seine zukünftigen Schüler:innen da sein muss und Ansprechpartnerin ist, denke ich, habe ich sehr viel mitgenommen. Einfach in Bezug auf andere Kulturen, den Mut haben, deine Komfortzone zu verlassen, eventuell selbst so einmal diesen ganzen Prozess mitgemacht haben, fremd zu sein, sich organisieren zu müssen, neue Freundschaften schließen zu wollen, zu müssen, weil man sonst alleine ist, auf einer anderen Sprache zu studieren. Und ich glaube schon, dass das immer aktueller wird in der nachfolgenden Generation – Reisen, im Ausland leben und diesbezüglich glaube ich, kann ich auch als Lehrerin später noch davon profitieren.
Frage: Was würdest du anderen Lehramtsstudierenden raten, vielleicht auch genau aus dem Fach, wo du studiert hast, die ein Auslandsstudium planen?
Anja: Es auf jeden Fall zu machen! Das ist mein erster Rat. Gerade im Lehramt studiert man ja nahezu drei Fächer. Und wenn man jetzt denkt, dass gerade in den beruflichen Fachrichtungen das erste Fach häufig wahrscheinlich nicht in Frage kommt, weil es dazu keine internationalen Partneruniversitäten gibt, auf jeden Fall auch in seinem Zweitfach nachzugucken. Da das ist ja häufig allgemeinbildender und darin zu gucken, was es da für Kooperationen und Partnerunis gibt und sich früh zu bewerben und sich dann aber auch nicht stressen lassen. Denn vieles ergibt sich einfach erst später. Und muss man einfach erst einmal laufen lassen. Und dann bei diesen ganzen Fragen, die sich ergeben aufgrund von Semester fängt im Ausland früher an, teilweise steckt man dann hier noch in der Prüfungsphase. So war das bei mir z.B., dass das Semester in Bologna im Februar bereits angefangen hat, wo ja hier noch einmal Prüfungsphase ist. Dass ich teilweise dann den Kontakt zu den Dozenten gesucht habe und geguckt habe, ob man dort irgendwie Lösungen findet, wie man, sag ich mal, die Prüfung etwas nach vorne verschieben könnte. Und dort muss ich echt auch sagen, hab ich immer nur positive Unterstützung bekommen und ich wurde einfach nur bestärkt, indem das ich halt ins Ausland gehe und dort wirklich kein Dozent irgendeinen Stein in den Weg gelegt hat. Also ich würde raten, immer auf den Kontakt zu den Dozenten zu suchen, denn die haben dann für sowas einfach immer riesengroßes Verständnis.
Frage: Was war denn die spannendste bzw. wertvollste Erfahrung oder Erkenntnis, die du während deines Auslandsstudium gewinnen konntest?
Anja: Die Erkenntnis, dass ich es geschafft habe, auf Englisch zu studieren, wo ich ziemlichen Respekt vor hatte. Gerade Politikwissenschaft. Mein Englisch ist gut, dass ich mich auf der Straße mit Freunden unterhalten kann, aber Fachenglisch hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und dass ich während des Semesters daran gewachsen bin, weil ich irgendwie dann einfach ja, man hört sich dann auch rein. Aber vor den Prüfungen hab ich mir ganz oft mein Deutsch gewünscht, weil ich einfach so Angst hatte, dass ich das nicht richtig ausdrücken kann, was ich eigentlich meine, weil es auf einer anderen Sprache ist. Und das hab ich auch beim Lernen gemerkt, dass es auch auf jeden Fall deutlich länger dauert, das Englisch zu lernen, als das Ganze auf Deutsch zu lernen. Und es hat am Ende gut funktioniert und es hat mich stolz gemacht und daran bin ich vielleicht auch gewachsen oder selbstbewusster geworden, was mein Englisch anbelangt.
Frage: War das dein schönstes Erlebnis auch? Oder gab es da auch noch mal was anderes?
Anja: Also mein schönstes Erlebnis das war ein Abend am Ende der Prüfungszeit, die an sich auch total besonders war, weil man hat ja hier in Dresden schon einen eingefahrenen Ablauf, was Prüfungen anbelangt, so: SLUB, Mensa, SLUB, Mensa. Und das mit unterschiedlichsten Menschen in einem ganz anderem Land, in einer anderen Stadt mit einem anderen System durchzumachen. Diese ganze Phase war irgendwie sehr, sehr aufregend und sehr schön.
Dadurch, dass wir auch alle was anderes studiert haben und ganz am Ende der Prüfungszeit und auch am Ende des Semesters haben ich und meine Tandem-Partnerin, die zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Freundin von mir wurde, ein großes Picknick organisiert, wo ganz viele Italiener und Erasmus-Studierende – also sie hat ihren Teil mitgebracht und ich hab meinen Teil mitgebracht – und es wurde ein total schöner Abend mit allen Menschen auf einer Decke, die ich während der Zeit kennengelernt habe. Und das war so mit das schönste Erlebnis, was mir so hängengeblieben ist.
Frage: Würdest du sagen, dass sich ein Auslandssemester aufgrund deiner gesammelten Erfahrungen lohnt, auch wenn man zum Beispiel deswegen länger studieren muss?
Anja: Ja, länger studieren, das ist klar. Dort setzt man seine persönliche Priorität. Aber ich denke mir, man arbeitet noch lange genug und ich war ja in dem Sinne schon „alt“ und normale Erasmus-Studierende sind ja sogar noch viel jünger. Und dann finde ich, lohnt sich der Tritt auf die Bremse, um mal zu sagen: „Ich mach jetzt hier mal ein oder zwei Urlaubssemester.“ Ja, aufgrund meiner gesammelten Erfahrungen und ich denke wirklich noch jeden Tag an die Zeit. Also auch, wenn es nur so kleine Ausschnitte sind, die mir immer mal wieder hochkommen. Und die Freundschaften, die ich dort geschlossen habe, auch außerhalb Deutschlands, Finnland, Dänemark, nach Italien selbst, die bleiben ja für immer. Und dort ist dieses eine oder zwei Semester, die man deshalb länger studiert, stehen in keinem Verhältnis, meiner Meinung nach.
Frage: Denkst du, dass auch Lehramtsstudierende ins Ausland gehen sollten, die keine moderne Fremdsprache studieren?
Anja: Es ist ja primär eigentlich etwas für dich persönlich. Man steckt zwar gerade in diesem Studium, aber diese ganzen Erfahrungen, die man da macht, geplant oder ungeplant, die haben ja erst einmal oder müssen ja erstmal nichts mit deiner Karriere zu tun haben. Und daher finde ich, was ich zuvor auch schon mal meinte, als zukünftige Lehrperson geht es nicht immer nur darum, Meisterin seines Faches zu sein, sondern halt als Mensch mit einem gewissen Erfahrungsschatz der zukünftigen Generation irgendwie eine Inspiration zu sein. Und deshalb finde ich, egal welches Fach man studiert, ist ein Auslandsaufenthalt auf jeden Fall immer gewinnbringend.
Frage: Hast du noch einen abschließenden Rat für Lehramtsstudierende, wie man seinen Auslandsaufenthalt am besten angehen sollte? Also sowohl in der Vorbereitung als aber auch vielleicht in der innerlichen Vorbereitung, nicht nur formal gesehen.
Anja: Ja, also bevor man ins Ausland geht, würde ich jedem, jeder raten, sich vielleicht erst einmal selbst die Frage zu stellen: „Was kann ich gut? Was stört mich manchmal auch an mir selbst?“ Weil ich auch gemerkt habe, dass man außerhalb seiner Komfortzone, die man ja auf jeden Fall verlässt, wenn man alleine in ein fremdes Land geht, persönliche Barrieren viel leichter durchbrechen kann, weil man einfach gezwungen ist, aus sich herauszukommen und auf fremde Menschen zuzugehen und neue Freundschaften zu schließen, weshalb sich erst einmal vielleicht Fragen stellen „Ja, genau, was möchte ich eigentlich?“ Oder: „Wo möchte ich besser werden?“ Oder: „Was kann ich aber auch gut?“ Und um das eventuell noch zu verbessern oder zu verstärken – das könnte vielleicht eine leitende Frage sein, die man sich stellen kann, bevor man ins Ausland geht. Und ein weiterer Rat, den ich gebe, ist, weniger dieses Erasmus oder das Auslandsstudium, weniger karrierefokussiert zu betrachten, sondern mehr nach den persönlichen Interessen gucken. Also: „In welchem Land fühle ich mich wohl, weil ich da bereits schon mal war? Oder weil ich da positive Assoziationen zu habe? Welche Sprache kann ich vielleicht schon ein bisschen und möchte sie verbessern oder wollte ich schon immer mal lernen?“ Zum Beispiel bei mir Italienisch: Italienisch bringt einem gar nichts außerhalb Italiens, aber ich liebe es trotzdem so! Ich hätte auch nach Spanien gehen können. Das hätte mir wahrscheinlich international viel mehr gebracht, weil man es in viel mehr Ländern spricht. Aber ich wollte irgendwie einfach nach Italien. Und da einfach zu gucken, wo will man so vom Bauchgefühl, vom Herz her hin, weil man begibt sich in so viele Unsicherheiten, gegen die man nichts machen kann. Da sollte wenigstens so das Herz und das innere Bauchgefühl, ein gutes Gefühl geben, dass man sagen kann: Ich habe Bock auf das Land, ich habe Bock auf die Sprache und die Kultur, die ich damit verbinde.
[Outro]
„Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
„Ich war positiv überrascht, wie gut das gemeinsame Lernen geklappt hat und dass weniger die Unterschiede, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt standen. Somit konnte ich lernen, wie erfolgreiches interkulturelles Lernen funktionieren kann.“
[Intro]
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Serie „Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Heute spreche ich mit Axel Götze über sein Schulpraktikum in Südafrika.
Axel: Hallo, ich heiße Axel und ich studiere Lehramt an Gymnasien für Mathematik und Geografie. Aktuell bin ich im 9. Semester.
Frage: Erzähl uns von deinem Auslandsaufenthalt. In welchem Land warst du denn und mit welchem Programm?
Axel: Meinen Auslandsaufenthalt habe ich in Südafrika gemacht. Dort habe ich mein Blockpraktikum B für Mathematik an der Deutschen Internationalen Schule in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria absolviert. Das Praktikum habe ich mir selbst organisiert, sodass ich nicht mit einem bestimmten Programm unterwegs war.
Frage: Über welchen Zeitraum warst du im Ausland und in welchem Fachsemester warst du damals?
Axel: Das Blockpraktikum habe ich, wie Studienablaufplan vorgesehen, in meinem 6. Semester gemacht. Ich war insgesamt 10 Wochen in Südafrika. Losgeflogen bin ich am 31. Juli 2019 und am 10. Oktober 2019 bin ich dann wieder gut in Deutschland angekommen.
Frage: Was waren deine Gründe für die Wahl des Landes und der Universität bzw. der Schule in deinem Fall?
Axel: Eine Kommilitonin und Freundin war schon für ihr erstes Blockpraktikum B 2018 an der Schule in Südafrika und sie hat sehr davon geschwärmt, tolle Bilder gezeigt und Geschichten erzählt. Und sie wollte halt unbedingt auch ihr zweites Blockpraktikum B im Ausland machen. Da hab ich natürlich nicht lange überlegt und sofort zu ihr gesagt: „Du pass auf, ich komme mit“. Dann haben wir uns zusammen für 2019 beworben und auch schnell die Zusage bekommen. Anschließend konnten wir dann alles gemeinsam planen und vorbereiten. Und da sie ja schon einmal in Südafrika war, ging das auch recht unkompliziert.
Frage: Wie hast du dort gewohnt und wie hast du dir die Unterkunft organisiert?
Axel: Ja, wir hatten das große Glück, dass wir uns nicht selber eine Unterkunft organisieren mussten. Die Schule hat nämlich ein Praktikantenwohnheim direkt auf dem Schulgelände. Dort haben wir mit allen anderen Praktikanten und den Freiwilligen aus Deutschland gewohnt. Insgesamt waren wir da eine große WG von zwischenzeitlich 11 oder 12 Leuten. Ja, das war echt cool, denn wir haben auch viel gemeinsam gemacht, zusammen gekocht und gegrillt, Karten gespielt, Filme geschaut und Sport getrieben. Die Sportanlagen, die waren z.B. gleich neben dem Wohnheim. Es gab Tennisplätze, Volleyball-, Basketball-, Handballfeld und ein Schwimmbecken. Ja, natürlich haben wir auch zusammen Ausflüge gemacht. Nach dem Schulunterricht oder an den Wochenenden waren wir gemeinsam wandern, im Museum, auf Märkten, in Shopping-Malls oder in Restaurants. Also wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt und die Zeit intensiv genutzt.
Frage: Inwiefern unterscheidet sich denn ein Schulpraktikum im Ausland von einem in Sachsen?
Axel: An der Deutschen Auslandsschule, an der ich war, gab es einen deutschen Zweig und einen englischen Zweig. Im englischen Zweig wurde nach südafrikanischen Lehrplan unterrichtet. Die Unterrichtssprache war natürlich Englisch. Im deutschen Zweig wurde nach baden-württembergischen Lehrplan und natürlich auf Deutsch unterrichtet. Ja, die Klassen, die waren relativ klein und sehr heterogen, auch weil es z.B. keine Trennung zwischen gymnasialem Real- oder Hauptschulzweig gab. Sehr positiv war auf jeden Fall, dass die Lehrerinnen und Lehrer immer ein offenes Ohr hatten und sehr herzlich waren. Sie haben uns Praktikanten z.B. auch gerne Tipps für Aktivitäten oder gute Restaurants in der Umgebung gegeben und das Verhältnis insgesamt war damit viel persönlicher als z.B. in einer Schule in Deutschland.
Frage: Fiel es dir schwer, vom sächsischen Lehrplan ausgehend plötzlich auf einen von einem anderen Bundesland dich umzustellen? Oder war das für dich quasi das Gleiche, weil du den sächsischen Lehrplan selber gar nicht so gut kanntest bis dahin?
Axel: Ich kenne den sächsischen Lehrplan auf jeden Fall gut, weil ich hier auch selber zur Schule gegangen bin und wir den im Studium ausreichend behandelt haben. Aber der Wechsel zu einem anderen Lehrplan ist mir nicht schwergefallen, weil die Inhalte sehr ähnlich sind. Und speziell beim baden-württembergischen Lehrplan werden Kompetenzen beschrieben und so ist man relativ offener und freier bei der Planung des Unterrichts. Außerdem hat man natürlich auch ein Lehrbuch zur Hand und kann sich auch daran orientieren und Inspiration finden, wie man den Unterricht gestaltet.
Frage: Was waren deine hauptsächlichen Einsatzfelder an der Schule?
Axel: Ja, ich habe ja meinen Blockpraktikum B für mein erstes Fach an der Schule absolviert und deswegen lag der Fokus auch auf dem selbstständigen Vorbereiten, Durchführen und Reflektieren von Unterricht. Ich musste mindestens 30 Unterrichtsstunden hospitieren und mindestens 18 Stunden selber halten. Die vorgegebenen Stunden habe ich aber weit überschritten, da ich anstatt der vorgeschriebenen 4 Wochen insgesamt 7 Wochen Praktikum gemacht habe.
Frage: Wie selbstständig konntest bzw. durftest du den Unterricht dort gestalten?
Axel: Mein Mentor war auf jeden Fall sehr freundlich, aber auch anspruchsvoll. Er hat mir auf jeden Fall die Möglichkeiten eingeräumt, den Unterricht sehr selbstständig zu gestalten. Er hat zum Beispiel am Anfang des Praktikums mir die Materialien für den Mathematikunterricht gezeigt, die es an der Schule gibt. Und während des Praktikums hat er mir dann freigestellt, welche der Materialien ich verwende und wie ich generell meinen Unterricht gestalte. Im Rückblick finde ich das sehr angenehm, dass er mich halt auch so bestärkt hat, mich auszuprobieren und meinen eigenen Stil dadurch zu finden.
Frage: Kanntest du dir das Auslandspraktikum also auch als Blockpraktikum anrechnen lassen?
Axel: Ja, ich konnte mir das Auslandspraktikum als Blockpraktikum B anrechnen lassen. Das war auch gar nicht kompliziert. Ich habe nach der Zusage von der Schule direkt bei der Fachdidaktik Mathematik angefragt und meine Situation geschildert. Also, dass ich mein Praktikum an einer Deutschen Auslandsschulen absolvieren möchte. Die verantwortliche Dozentin meinte dann, dass ich mir das Praktikum auf jeden Fall anrechnen lassen kann, wenn ich den Mathematikunterricht auf Deutsch und nach einem deutschen Lehrplan halte. Es war also nicht gefordert, dass es der sächsische Lehrplan ist. Und mit ihrer Zusage dann, also mit der Zusage der Dozentin, habe ich dann das Praktikumsbüro des ZLSB informiert.
Frage: Hast du dir die Zusage auch schriftlich geben lassen oder nur mündlich?
Axel: Per Mail, also schriftlich. Und das war auch immer recht unkompliziert.
Frage: Konntest du dir noch weitere Studienleistungen anerkennen lassen?
Axel: Also, ich konnte mir persönlich keine weiteren Studienleistungen anerkennen lassen, aber das war auch nicht mein Ziel. Meine Motivation war es ja, mein Blockpraktikum zu absolvieren und das anerkennen zu lassen.
Frage: Was nimmst du aus deinem Schulpraktikum im Ausland für deine künftige Tätigkeit als Lehrer in Deutschland mit?
Axel: Die Klassen waren wie schon beschrieben relativ klein, aber auch heterogen. Und durch das Unterrichten habe ich auf jeden Fall gelernt, ausreichend zu differenzieren und unterschiedliches Lernmaterial anzubieten. Die Klassen, die waren aber auch nicht nur heterogen in Bezug auf die Leistungen, sondern auch in Bezug auf die soziale und geographische Herkunft. Ja, ich war positiv überrascht, wie gut das gemeinsame Lernen geklappt hat und dass weniger die Unterschiede, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt standen. Somit konnte ich lernen, wie erfolgreiches interkulturelles Lernen funktionieren kann.
Frage: Gibt es etwas vielleicht auch außerhalb der Schule, das du seit deinem Auslandspraktikum mit anderen Augen siehst?
Axel: Also ich bin auf jeden Fall dankbar, wie privilegiert wir hier in Deutschland leben und welche Freiheiten wir genießen. Das war mir auf jeden Fall vorher nicht bewusst. Und durch den Aufenthalt in Afrika bzw. genauer in Südafrika ist mir nochmal einmal mehr deutlich geworden, dass man das auf jeden Fall nicht einfach so hinnehmen sollte, dass man das als gegeben voraussetzen sollte, sondern dass man dafür auf jeden Fall einstehen muss und dass man das genießen sollte.
Frage: Worauf sollte man deiner Meinung nach bei der Wahl einer geeigneten Praktikumsschule im Ausland achten?
Axel: Die Praktikumsplätze an vielen Auslandsschulen sind auch begehrt und können deswegen schnell weg sein. Bei meiner Recherche habe ich z.B. gesehen, dass manche Schulen ganz bestimmte Erwartungen wie die Fremdsprachenkenntnisse an die Praktikanten haben. Manche haben außerdem Bewerbungsfristen. Das Maximum, was ich da gesehen habe, waren tatsächlich zwei Jahre. Aber ich denke, dass es eher Einzelfälle sind. Bei den meisten Schulen reicht es aus, wenn man sogar ein Jahr vorher seine vollständige Bewerbung hinschickt. Und es gibt auch zwei Webseiten, die ich empfehlen kann als erstes auslandsschulwesen.de und zweitens lehrer-weltweit.de. Auf den Seiten findet man unter anderem alle Deutschen Auslandsschulen aufgelistet und man findet Informationen für Praktikanten und auch direkte Links zu den Webseiten der Schulen. Was außerdem wirklich hilfreich sein kann, um eine wirklich passende Auslandsschule zu finden, sind Erfahrungsberichte ehemaliger Praktikanten. Manche Schulen veröffentlichen diese z.B. auf ihrer Website. Aber es gibt z.B. auch Websites verschiedener Unis wie Jena, Potsdam oder Frankfurt, auf denen wirklich Erfahrungsberichte und Tipps von ehemaligen Praktikanten hochgeladen sind.
Frage: Was würdest du anderen Lehramtsstudierenden raten, die ein Schulpraktikum im Ausland planen?
Axel: Sich nicht von der Idee abbringen zu lassen und sich auf jeden Fall rechtzeitig zu informieren und sich im persönlichen Umfeld umzuhören. Denn vielleicht kennt man ja jemanden, der schon mal im Ausland war und wertvolle Tipps geben kann. Oder man findet jemanden, mit dem man zusammen ins Ausland gehen kann. Dann kann man die ganze Vorbereitung gemeinsam wuppen und sich gegenseitig unterstützen. Ja und die vollständige Bewerbung sendet man direkt dann an die Auslandsschule. In meiner Bewerbung befand sich z.B. ein Anschreiben, ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und meine bisherigen Noten in der Uni. Und man sollte sich natürlich auf jeden Fall auch rechtzeitig Gedanken über die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes machen. Stichworte sind hier Auslands-Bafög oder normales Bafög, Ersparnisse und Nebenjob. Außerdem gibt es ein Stipendium vom DAAD, also dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, welches direkt auf Auslandspraktikum für Lehramtsstudierende ausgerichtet ist. Es heißt „Lehramt.International“ und mit dem Programm werden ein- bis sechsmonatige Praktika an Schulen im Ausland gefördert. Hier muss man natürlich auch bestimmte Bewerbungsfristen beachten, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe z.B. auch dieses Stipendium beantragt und auch bekommen und mit dem Geld konnte ich wirklich einen Großteil meines Auslandsaufenthaltes finanzieren. Ja, um es konkret zu machen Für meinen 7wöchiges Praktikum habe ich insgesamt über 3000 Euro bekommen. Die Summe setzte sich zusammen aus einer monatlichen Stipendienrate, einer einmaligen Reisekostenpauschale und auch Leistungen zur Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung.
Frage: Gibt es auch etwas, was du Leuten raten würdest, die speziell nach Südafrika gehen möchten, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung?
Axel: In Südafrika gibt es meines Wissens drei Deutsche Auslandsschulen, in Pretoria eine, in Johannesburg eine und in Kapstadt eine. Und was ich mitbekommen habe in meinem Praktikum, ist auf jeden Fall, dass die Qualität des Unterrichts und auch die ganze Schulgemeinschaft an allen drei Schulen wirklich hoch ist und die auch eng zusammen lebt bzw. arbeitet. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, sein Praktikum an einer Deutschen Auslandsschulen in Südafrika zu machen. Und die Lehrer und Lehrerinnen, die an den Schulen arbeiten, die sind auf jeden Fall sehr offen und hilfsbereit und unterstützen einen auf jeden Fall, wenn man sich rechtzeitig bewirbt und dann auch eine Zusage bekommt an den Schulen.
Frage: Gibt es eine besonders spannende oder wertvolle Lernerfahrung oder Erkenntnis, die du während deines Auslandspraktikum gewinnen konntest?
Axel: Ja, wertvoll und spannend für mich war auf jeden Fall das Leben in den großen Gemeinschaften, sei es in der WG mit den vielen anderen Praktikanten und Freiwilligen oder mit dem diversen Lehrerkollegium. Aber auch die Schulgemeinschaft insgesamt war eng und wurde intensiv gelebt. Das habe ich so in Schulen in Deutschland noch nicht erlebt. Jeden Montag zum Beispiel hat sich die gesamte Schülerschaft und Lehrerschaft in der Aula der Schule versammelt und hat gemeinsam auf die Vorwoche zurückgeblickt und unter anderem sportliche Erfolge von Schülern und Schülerinnen und Schulmannschaften gewürdigt. Außerdem wurde ein Ausblick auf die Höhepunkte der anstehenden Woche geworfen.
Frage: Gab es für dich auch so etwas wie ein schönstes Erlebnis?
Axel: Ein schönstes Erlebnis kann ich wahrscheinlich nicht nennen, denn ich muss ehrlich sagen, ich hatte sehr viele schöne Erlebnisse, an die ich mich gerne zurück erinnere. Zu den Highlights zählen auf jeden Fall die Safaris, die wir in Nationalparks gemacht haben und wo wir unter anderem Giraffen, Löwen, Elefanten von Nahem gesehen haben. Ja, aber auch die Wanderungen in den Drakensberge oder in Swasiland oder auf den Tafelberg in Kapstadt. Die waren einfach super. Und generell das Leben in der WG war wirklich intensiv. Wir sind gut zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen und haben viel gemeinsam gemacht. Man musste sich also nie allein fühlen und man hatte auch nie Langeweile.
Frage: War die Dauer des Aufenthalts für dich angemessen oder wärst du lieber etwas länger oder kürzer geblieben?
Axel: Angemessen, da ich zuerst mein Blockpraktikum machen und dann durch das Land reisen konnte. Und der Großteil der Praktikanten war auch wirklich nur für 5 bis 6 Wochen ungefähr da an der Schule. Wir sind gemeinsam ins Praktikum gestartet. Das war wirklich gut organisiert und so war es dann am Ende auch gut, dass wir relativ gleichzeitig wieder gegangen sind.
Frage: Was waren denn für dich die größten Herausforderungen deines Auslandsaufenthalt und wie bist du damit umgegangen?
Axel: Ja, also eine Umstellung für mich bzw. ungewohnt waren auf jeden Fall die Sicherheitsvorkehrungen, die wir getroffen haben bzw. treffen mussten. Wir konnten z.B. bzw. sollten wir nicht im öffentlichen Raum zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. So haben wir dann wirklich alle Wege eigentlich im Auto zurückgelegt. Das kennt man halt hier nicht aus Deutschland. Man hat also ein ganz anderes Sicherheitsgefühl bzw. musste halt wirklich mehr Sicherheitsvorkehrungen auch treffen und z.B. wirklich mehr und permanent auf seine Wertgegenstände auch aufpassen, wenn man außerhalb des Schulgeländes war.
Frage: Würdest du sagen, dass sich ein Auslandsstudium bzw. ein Praktikum in deinem Fall aufgrund der gesammelten Erfahrung lohnt, auch wenn es bedeuten könnte, dass man eventuell ein Semester länger studiert?
Axel: Auf jeden Fall. Man sammelt superviele Erfahrungen, die einem keiner nehmen kann und von denen man bestimmt sein ganzes Leben lang zehren wird. Und ob man jetzt ein Semester länger studiert, wäre mir z.B. persönlich nicht so wichtig. Aber für mich war es z.B. auch möglich, das Praktikum wirklich in die vorlesungsfreie Zeit zu schieben. Also ich hatte wirklich im Sommersemester 2019 Vorlesungen und konnte alle Prüfungen mitmachen. Dann bin ich ins Ausland geflogen, konnte dort das Praktikum absolvieren und war dann rechtzeitig zum Wintersemester wieder da. Also das hat für mich persönlich auch in die vorlesungsfreie Zeit gepasst.
Frage: Denkst du, dass auch Lehramtsstudierende ins Ausland gehen, sollten, die wie in deinem Fall keine moderne Fremdsprache studieren?
Axel: Auf jeden Fall. Ich studiere ja auch keine Fremdsprache und von den anderen Praktikanten, die ich kennengelernt habe, hat auch nicht mal die Hälfte eine Fremdsprache gemacht. Und wo wir dabei sind, es sollten auch nicht nur Lehramtsstudierende ins Ausland gehen, die gymnasiales Lehramt machen. Für alle Schulformen und Fächerkombination ist es auf jeden Fall reizvoll und empfehlenswert. Man erweitert seinen Horizont unglaublich und wird auf jeden Fall auch selbstständiger und offener. Ja und an einer Auslandsschule erhält man dann außerdem wertvolle Einblicke in das Auslandsschulwesen. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ja auch ein Grund, später für einige Jahre im Ausland zu leben und zu unterrichten.
Frage: Hast du noch einen abschließenden Rat für Lehramtsstudierende, wie man seinen Auslandsaufenthalt am besten angehen sollte?
Axel: Ja, als abschließenden Rat möchte ich auf jeden Fall alle Lehramtsstudierenden bestärken, offen mit ihrem Wunsch ins Ausland zu gehen, umzugehen und sich bei der Organisation auch Hilfe und Unterstützung einzuholen. Fragt im Umfeld oder fragt z.B. auch beim Team von IMPRESS an am ZLSB, das steht Studierenden zur Seite und beantwortet auch gerne Fragen oder stellt Kontakte zu Partnerschulen der TU Dresden her.
[Outro]
„Going abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
„Man hat sich immer diese Gemütlichkeit ins Klassenzimmer geholt, was ich in Deutschland ein bisschen vermisse. Und deshalb möchte ich auch meinen Unterricht stressfreier gestalten.“
[Intro]
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Serie „Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Heute spreche ich mit Jenny Neukirch über ihr Schulpraktikum in Dänemark. Jenny hat Lehramt für Grundschulen mit den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Ethik studiert und war von April bis Juni 2019 im achten Fachsemester im Ausland.
Jenny: Ich bin Jenny. Ich bin 24 Jahre alt und ich habe von 2015 bis 2020 Grundschullehramt hier an der TU Dresden studiert mit dem Kernfach Ethik und seit März 2020 befinde ich mich jetzt im Referendariat.
Frage: Erzähl uns von deinem Auslandsaufenthalt. In welchem Land warst du denn? Und über welches Programm?
Jenny: Ich war 2019, das war in meinem achten Semester in Dänemark, und zwar habe ich dort ein Schulpraktikum absolviert. Das Ganze lief über das Programm „Schulwärts!“. Das ist ein Programm vom Goethe-Institut. Und dort werden speziell an Lehramtsstudenten Schulpraktika vermittelt. Und das Besondere an dem Programm ist, dass die Praktika an „PASCH-Schulen“ stattfinden, das sind Schulen im Ausland, an denen Deutsch unterrichtet wird und man es dann sozusagen als Deutschlehrer und Deutschlehrerin im Deutschunterricht eingesetzt.
Frage: Was hat dich persönlich zu deinem Auslandsaufenthalt während deines Studiums bewogen?
Jenny: Also ich habe am Anfang des Studiums eigentlich gar nicht den Plan gehabt, ins Ausland zu gehen. Das kam dann erst später, als ich es auch von anderen Studenten erfahren habe und dachte: Ja, das ist ja echt eine coole Erfahrung. Und ich hab das dann auch gezielt in meinem letzten Semester eingeplant, da ich da nicht mehr viele Seminare hatte und somit auch Freiheit hatte, ein paar Wochen ins Ausland zu gehen. Und ich wollte speziell auch Berufserfahrung sammeln und deshalb habe ich nach Programmen gesucht, in denen man auch Schulpraktika machen kann. Und an diesem „Schulwärts!“-Programm hat mich vor allem interessiert, dass ich auf Deutsch unterrichten kann, weil ich hab es mir halt immer nicht zugetraut jetzt zum Beispiel an der Oberstufe auf Englisch zu unterrichten. Und das fand ich an diesem „Schulwärts!“-Programm so toll, dass ich Deutschunterricht geben kann und deshalb hab ich mich dann da beworben und es hat auch geklappt.
Frage: Was waren denn deine Gründe dafür, dass du Dänemark ausgewählt hast?
Jenny: Zu dem Zeitpunkt damals, das war 2018, als ich mich beworben hab, da hab ich mich sehr für skandinavische Länder, also eigentlich für Schweden auch interessiert. Also das war auch mein Erstwunsch damals. Ich hab auch an der Uni einen Schwedisch-Kurs gemacht und bei mir war dann aber das Problem, ich konnte nur von April bis Juni das Praktikum machen, weil ich sonst noch Uni-Seminare hatte und da gingen dann aber in Schweden schon die Sommerferien los und somit hätte ich diesen Zeitraum nicht absolvieren können. Also man musste mindestens acht Wochen Praktikum machen und das hätte dann nicht hingehauen mit den Ferien und deshalb wurde mir dann Dänemark angeboten. Und deshalb bin ich dann auch nach Dänemark gegangen.
Frage: Wie hast du denn vor Ort gewohnt? Und wie hast du dir eine Unterkunft organisiert?
Jenny: Ja, das Thema Unterkunft ist in Dänemark etwas schwierig, vor allem in Kopenhagen, weil es sehr wenige WG-Zimmer gibt. Und die, die es gibt, sind wirklich sehr teuer. Und deshalb hab ich mich schon, nachdem ich die Zusage bekommen hatte, direkt um eine Unterkunft gekümmert. Ich war in verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs, habe da nach WG-Zimmer geschaut, die sind aber sehr schnell weg. Also wenn ein Post 30 Minuten online war, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das Zimmer weg ist. Also da muss man möglichst sehr schnell sein. Deshalb hab ich mir zur Sicherheit für meine erste Woche ein Hostel gebucht, damit ich erstmal eine Unterkunft habe, wenn ich ankomme. Und ich war insgesamt 12 Wochen in Dänemark und hab mir dann immer verschiedene Airbnbs gesucht für ein paar Wochen. Bin dann immer mal gewechselt und im letzten Monat habe ich dann aber ein festes WG-Zimmer. Das hab ich auch über eine Facebook-Gruppe zum Glück gefunden.
Frage: Mit wem hast du da zusammen gewohnt?
Jenny: Die WG war in einem Mehrfamilienhaus. Es wurde von einer Familie untervermietet und in dem WG-Zimmer hat dann noch ein anderer Student sozusagen gewohnt. Also wir haben uns die Wohnung geteilt.
Frage: Hat dich die Schule in irgendeiner Weise unterstützen können?
Jenny: Die Schule war nicht direkt in Kopenhagen, sondern in Farum. Das ist eine Stadt, ungefähr 30-40 Minuten Zugfahrt entfernt von Kopenhagen. Und dort hatte ich eine Mentorin. Mit der hatte ich vor Beginn des Praktikums auch schon über E-Mail kommuniziert. Und sie hat mir auch angeboten, in Farum und in Kopenhagen sich umzuhören wegen Wohnungen. Aber ich hab mich dann doch selber gekümmert, weil es halt auch schwierig ist, noch über eine dritte Person da etwas zu finden. Deshalb hab ich mich dann direkt auch darum gekümmert.
Frage: Inwiefern unterscheidet sich denn ein Schulpraktikum im Ausland von einem Sachsen?
Jenny: In Dänemark hat man das Glück als Deutscher, dass einige Leute Deutsch sprechen bzw. Deutsch wenigstens verstehen. Und die meisten sprechen natürlich auch Englisch. Also ich hab mich in der Schule vorwiegend auf Englisch unterhalten können. Auch mit den Kollegen, das hat gut geklappt. Was aber ein großer Unterschied war zu Deutschland, sind die Unterrichtsmethoden und die Materialien. Also an der Schule, an der ich war, war alles digital. Ich hab in der Oberstufe unterrichtet und auch ab der siebten Klasse hat jeder Schüler einen Laptop. Alle Materialien, alle Texte, die gelesen werden, werden auch über E-Mail verschickt. Es gibt ein spezielles Netzwerk, auf dem Hausaufgaben gegeben und hochgeladen werden. Das war auf jeden Fall ein großer Unterschied und da musste ich mich auch erstmal ein bisschen zurechtfinden mit den ganzen technischen Sachen. Aber es hat auch seine Vorteile.
Frage: Fühlst du dich für die Digitalisierung der Schulen jetzt gut vorbereitet in Deutschland?
Jenny: Ja, ich konnte auf jeden Fall schon mehr Erfahrung sammeln als hier.
Frage: Erzähl noch ein wenig mehr von einem Praktikum. Wie hast du denn genau die Schule gefunden, an der du letztlich warst?
Jenny: Meine Schule wurde mir vom „Schulwärts!“-Programm, also vom Goethe-Institut vermittelt. Da gibt's eben diese „PASCH-Schulen“ zur Auswahl und davon wählt dann das Institut eine Schule aus. Deshalb hab ich mich nicht selber um meine Schule gekümmert. Genau, es wurde mehr vermittelt und ich wurde dann in der Schule vorwiegend im Deutschunterricht eingesetzt, in der Oberstufe. Das heißt Klasse 11 bis 13. Und dort habe ich einmal im Unterricht hospitiert. Aber ich hatte auch meinen eigenen Kurs, den ich selbstständig unterrichtet habe im Fach Deutsch. Das war schon eine schöne Erfahrung, weil ich bin ja kein Fremdsprachenlehrer. Also ich unterrichte zum Beispiel kein Englisch und konnte da aber auch mal Erfahrung in diesem Sprachunterrichtsbereich sammeln. Neben dem Unterricht habe ich die Schüler aber auch noch auf‘s Abitur vorbereitet. Also ich habe z.B. fürs schriftliche Abitur Übungen mit den Schülern gemacht. Wir haben uns auch mal einen Kurs mit meiner Mentorin genommen und haben mit denen sozusagen eine mündliche Prüfung geübt. Also das ging noch nicht auf Note, sondern wir haben einfach mal diesen Ablauf mit den Schülern geübt. Dann gab es an der Schule eine Deutsch-Bibliothek, die eingerichtet wurde. Da hab ich mitgeholfen die Bücher zu katalogisieren z.B. und da gab gab's auch noch vom Goethe-Institut einen Deutsch-Wettbewerb, der fand dann im Winter statt, also da war ich ja schon wieder in Deutschland. Aber ich hab trotzdem da mitgeholfen die Aufgaben zu entwickeln. Also es war ein sehr breites Aufgabenspektrum, was ich hatte.
Frage: Und wurde dort auch nach dem sächsischen Lehrplan unterrichtet? Oder musstest du dich in einen anderen Lehrplan einarbeiten?
Jenny: An der Schule wurde nach dänischem Lehrplan sozusagen unterrichtet. Also es ist keine deutsche Schule, sondern es ist einfach eine dänische Schule, die Deutschunterricht noch nebenbei anbietet. Deshalb hat mich aber meine Mentoren betreut und die haben gesagt welche Themen kommen jetzt dran, und dann konnte ich mich selber darauf vorbereiten.
Frage: War es für dich deswegen auch eine Herausforderung, das Abitur vorzubereiten oder war das gar kein so großer Unterschied?
Jenny: Also in Dänemark ist es so geregelt, das finde ich auch ziemlich seltsam, dass die Lehrer die Schüler eigentlich nicht aufs Abitur vorbereiten dürfen. Also in der Schule sollen keine Übungen speziell fürs Abitur durchgeführt wird. Und ich als Praktikant aus Deutschland war da halt so ein bisschen in der Gesetzeslücke und deshalb hab ich mir dann einfach den Kurs nachmittags genommen und hab mit denen einfach mal so ein paar Grammatikübungen über schriftliche Texte geschrieben. Hab das mit denen dann einfach so nach meinen Vorstellungen gemacht. Also die Schüler müssen halt im Abitur den Text analysieren und auch eigene Texte schreiben. Und da hab ich dann einfach selber was rausgesucht und mit den Schülern durchgearbeitet.
Frage: Haben viele Schülerinnen und Schüler Deutsch gelernt?
Jenny: Ich sag mal so 30 Prozent von jeder Jahrgangsstufe, das konnte man an sich wählen und es gab glaub ich noch Französisch zur Auswahl. Und ja, da haben dann viele auch Deutsch gewählt.
Frage: Warst du überrascht von der Resonanz des Deutschunterrichts?
Jenny: Ja, schon. Also es waren auch einige in der Oberstufe dabei, die den Plan hatten, nach dem Abitur in Deutschland zu studieren und die dann auch sehr motiviert waren, Deutsch zu lernen. Gab aber auch einige Schüler, denen fiel Deutsch sehr schwer und die waren dann auch froh, haben sie mir gesagt, dass es dann nach der Schule vorbei ist.
Aber ich glaube so die Nähe zu Deutschland als Nachbarland hat auch viele Schüler motiviert, Deutsch zu lernen.
Frage: Konntest du dir das Auslandspraktikum als Blockpraktikum anrechnen lassen?
Jenny: Ich hab ja mein Auslandspraktikum nicht anrechnen lassen, weil ich es einfach nicht mehr benötigt hab. Also ich war ja im letzten Semester, hatte alle Praktikumsstunden zusammen und deshalb hab ich's auch nicht versucht zu beantragen.
Frage: Würdest du Leuten empfehlen, das auf jeden Fall in ihrer Planung zu berücksichtigen? Oder sagst du, es ist eigentlich eher relevant, dass man vielleicht überhaupt geht?
Jenny: Ich würde empfehlen, seinen Auslandspraktikum richtig im Studienablauf zu planen, wenn man vorher abklärt, ob man sich das Praktikum beispielsweise anrechnen lassen kann, ist es natürlich toll, das gleich als Blockpraktikum zu nutzen. Wenn das nicht gehen sollte, würde ich es trotzdem auf jeden Fall empfehlen, weil es ja auch um die eigene persönliche Erfahrung geht und nicht speziell nur um die Praktikumsstunden, die man zusammen bekommt. Deshalb würde ich es auch empfehlen, wenn man es nicht anrechnen lassen kann.
Frage: Konntest du dir noch andere Studienleistungen anerkennen lassen aus diesem Praktikum heraus?
Jenny: Ich hab mir andere Studienleistungen auch nicht anrechnen lassen, weil ich einfach nicht mehr gebraucht habe.
Frage: Was nimmst du aus deinem Schulpraktikum im Ausland für deine künftige Tätigkeit, wie du sie jetzt auch im Referendariat schon quasi ausübst, mit?
Jenny: Einerseits dass ich mehr Mut habe, im Unterricht auch mal technische Geräte einzusetzen. Da hat man ja in Deutschland sonst nicht immer so die Möglichkeit oder sieht es auch selten im Praktikum. Aber ich möchte das jetzt auch in meinem Unterricht öfter einsetzen und ich nehme auch die Gelassenheit der Dänen oder der dänischen Lehrer mit. Also man kennt ja diese dänische „Hygge“ und das hab ich wirklich auch in der Schule stark erlebt, also bei jedem Treffen unter Kollegen, da wurde immer ein Kuchen mitgebracht oder man hat sich's irgendwie gemütlich gemacht. Das war wirklich toll! Oder auch mit den Schülern fanden nachmittags noch Filmabende statt, es wurde Pizza Mal bestellt und man hat sich wirklich immer ja diese Gemütlichkeit auch ins Klassenzimmer geholt, was ich in Deutschland so ein bisschen vermisse. Und deshalb möchte ich auch meinen Unterricht stressfreier gestalten.
Frage: Worauf sollte man denn deiner Meinung nach bei der Wahl einer geeigneten Praktikumsschule achten?
Jenny: Erstmal gucken, gibt es in dem Ort überhaupt Wohnmöglichkeiten? Wenn man wie ich, ich hab ja in Kopenhagen gewohnt und bin dann immer zur Schule gependelt, sollte man natürlich auch schauen: Ist der Wohnort, also ist die Schule vom Wohnort aus gut erreichbar? Ist da eine gute Anbindung vorhanden? Und dann ist es natürlich auch wichtig, was man für persönliche Präferenzen hat. Also möchte man beispielsweise unbedingt in einer Schulart unterrichten, dann sollte man sich die Schule gezielt auswählen. Oder ist es einem wichtig, auf Englisch unterrichten zu können oder auf Deutsch unterrichten zu können? Da bieten sich dann diese „PASCH-Schulen“ beispielsweise an, also man sollte da einfach auf seine persönlichen Präferenzen achten.
Frage: Was würdest du anderen Lehramtsstudierenden raten, die ein Praktikum im Ausland planen?
Jenny: Definitiv frühzeitig mit der Planung zu beginnen. Man sollte schauen, wann in meinem Studienverlauf kann ich das Praktikum einplanen? Kann ich mir vielleicht auch Leistungen anrechnen lassen? Dann ist die Finanzierung ja auch eine große Sache. Das Programm „Schulwärts!“ ist ein Programm speziell vom Goethe-Institut entwickelt und dort werden an Lehramtsstudenten Schulpraktika vermittelt. Diese Praktika finden speziell an „PASCH-Schulen“ statt, das sind Schulen im Ausland, die Deutschunterricht anbieten. Oder es gibt auch Deutsche Auslandsschulen, die komplett deutschsprachig sind. Die meisten Schulen sind aber normale Schulen, die einfach noch vielleicht einen Deutschkurs nebenbei als Fremdsprache anbieten, so wie es auch an meiner Schule der Fall war. Ich hatte mich damals, Ende 2018 beworben für ein Praktikum 2019. Deshalb kann ich jetzt auch nur von meinen Erfahrungen sprechen, wie es damals war. Ob es jetzt Änderungen gibt? Das weiß ich gar nicht. Aber bei mir war es so, dass es im Jahr drei Bewerbungsrunden gibt. Man bewirbt sich dann mit einem Motivationsschreiben und man muss verschiedene Projekte ausarbeiten. Da gibt es dann online ein Anforderungsprofil. Ich musste mir z.B. ein didaktisches Projekt für den Deutschunterricht überlegen, den ich mit meiner Klasse im Ausland durchführen könnte und diese Bewerbungsunterlagen werden dann gesichtet und anhand davon werden dann sozusagen die Praktikanten ausgewählt. Und bei der Bewerbung gibt man auch schon Wünsche an für Länder, also man kann keine Orte angeben, sondern nur die Länder. Bei mir war mein Erstwunsch Schweden und mein Zweitwunsch Dänemark und mein Zweitwunsch hat dann auch geklappt. Und dann setzen sich die Verantwortlichen mit dir in Verbindung und besprechen auch, an welche Schule es gehen könnte, in welchem Ort die Schule ist. Und dann kann man sich die auf der Homepage auch schon anschauen, damit man dann auch rechtzeitig mit der Planung und der Wohnungssuche beginnen kann. Und bevor es ins Praktikum geht, hat man noch ein Ausreiseseminar, so nennt sich das. Also das hat bei uns damals in München stattgefunden. Da wurden dann alle Praktikanten eingeladen, die im nächsten Jahr zum Praktikum gehen und da wurden wir dann auf verschiedene Dinge vorbereitet, also auf die Didaktik von Deutsch als Fremdsprache, was ist da wichtig? Auch kulturelle Sensibilität wurde angesprochen und man konnte auch nochmal organisatorische Fragen stellen. Dann geht zum Praktikum. Da hat man auch immer einen Betreuer vom Goethe-Institut vor Ort. Ich hatte das Glück, dass ja das Goethe-Institut direkt in Kopenhagen war. Das heißt, da hatte ich auch immer schnell eine Ansprechpartnerin, wenn es Probleme gab. Und nach dem Praktikum hat man dann nochmal ein Abschlussseminar, wo dann auch jeder Praktikant von seinen Erfahrungen berichtet und das Ganze wird dadurch abgeschlossen. Und während des Praktikums wird man mit einem Stipendium unterstützt. Also es gibt im Monat eine Stipendiensumme und auch schon vorab eine Summe, mit der man dann z.B. Anreise oder verschiedene Versicherungen begleichen kann. Aber bei mir war es zum Beispiel der Fall dadurch, dass in Dänemark die Lebenserhaltungskosten ziemlich hoch sind, war es trotzdem gut, dass ich noch einen Puffer hatte. Man sollte sich je nach Region auch nicht komplett auf dieses Stipendium verlassen, sondern vielleicht noch so einen finanziellen Puffer einplanen.
Frage: Hast du noch einen abschließenden Tipp oder Ratschlag für Lehramtsstudierende, wie sie ihren Auslandsaufenthalt am besten angehen sollten?
Jenny: Wer ein Praktikum im Ausland plant oder ein Studium im Ausland, sollte sich definitiv frühzeitig mit der Planung auseinandersetzen, um einfach sicherzugehen, dass man auch das passende Programm, die passende Schule findet und sich auch schon auf den Ort und die Schule einstellen kann, damit man dann auch einen guten Start hat ins Praktikum.
[Outro]
„Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
„So viele praktische, methodische und auch didaktische Erfahrungen wie als Fremdsprachenassistentin bekommt man glaube ich nirgendwo anders besser vermittelt!“
[Intro]
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Serie „Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Heute spreche ich mit Maria Buschmann über ihre Fremdsprachenassistenz in Frankreich. Maria studiert Lehramt für Gymnasien mit den Fächern französischen Geschichte und war von Oktober 2018 bis März 2019 sowie von Oktober 2019 bis März 2020 im fünften und siebten Fachsemester im Ausland.
Frage: Bitte stell dich kurz vor.
Maria: Ich heiße Maria Buschmann und war mit dem FSA-Programm in Frankreich. FSA bedeutet Fremdsprachenassistenzkraft. Das heißt, ich habe als Fremdsprachenassistentin an zwei Schulen in Charleville-Mézières, das ist im Norden von Frankreich, gearbeitet.
Frage: Und über welchen Zeitraum warst du dort?
Maria: Ich war zweimal für sechs Monate in Frankreich, also insgesamt ein Jahr.
Frage: Was hat dich denn dazu bewogen, dich für eine Fremdsprachenassistenz, die ja auch relativ lange ist, zu bewerben?
Maria: Ich wollte zum einen meine Fremdsprachenkenntnisse in Französisch verbessern und zum anderen gleichzeitig aber auch praktische Erfahrungen für später sammeln. Und dann wollte ich natürlich auch damit den obligatorischen Auslandsaufenthalt, der ja verpflichtend ist bei Französisch für das Staatsexamen, absolvieren.
Frage: Was waren denn die Gründe für die Wahl des Landes?
Maria: Zum einen, dass ich die französische Kultur, die Sprache und auch den Lebensalltag besser kennenlernen wollte. Und zum anderen habe ich Frankreich gewählt, da ich später gern als Französischlehrerin arbeiten möchte. Und ich glaube, man kann sich wirklich nur mit einer fremden Sprache richtig identifizieren, wenn man auch selbst für eine bestimmte Zeit mal in dem Land gelebt hat. Ich habe mich dabei bewusst für das FSA-Programm entschieden, da das für Lehramtsstudierende eine ideale Gelegenheit ist, verschiedene Unterrichtsmethoden und Aktivitäten einfach mal so ohne großen Druck ausprobieren zu können.
Frage: Inwiefern unterscheidet sich denn eine Fremdsprachenassistenz von einem Schulpraktikum in Sachsen?
Maria: Einerseits ist natürlich das Schulsystem und auch der Schulalltag komplett anders. Also in Frankreich z.B. war es so, dass der Schulalltag erst gegen 17 Uhr endet. Was für mich auch eine sehr spannende Erfahrung war. Andererseits konnte ich in den sechs Monaten auch viel tiefgründiger den Schulalltag kennenlernen, denn man begleitet die Klassen ja wirklich über sechs Monate hinweg und bekommt da einen tiefgründigeren Einblick, als es bei vier Wochen Praktikum der Fall ist.
Frage: Wie hast du denn die Schule gefunden, an der du das Praktikum absolviert hast?
Maria: Ich habe an zwei Schulen gearbeitet, also einmal an einem Collège. Da sind die Schülerinnen und Schüler so zwischen 11 und 15 Jahre alt. Und dann an einem Lycée, wo die Schüler so zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Und beide Schulen empfand ich als sehr super. Es war eine tolle Zusammenarbeit sowohl mit den Schülerinnen und Schülern als auch mit den Lehrkräften. Die Lehrkräfte haben mich immer super unterstützt und mir auch immer Feedback gegeben. Mir hat auch die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sehr viel Freude bereitet.
Frage: Konntest du dir die Fremdsprachenassistenz auch als Block-Praktikum anrechnen lassen?
Maria: Leider nicht. Aber im Moment wird gerade innerhalb des PAD, der ja die Organisation des FSA-Programms übernimmt, darüber diskutiert, inwieweit Studierende sich das in Zukunft anrechnen lassen können als Blockpraktikum. Also vielleicht gibt es schon bald die Möglichkeit einer vollen Anrechnung.
Frage: Und wird das quasi in Bezug auf Sachsen oder bundesweit gerade diskutiert?
Maria: Bundesweit, weil in anderen Bundesländern ist das schon möglich, dass man sich das anrechnen lassen kann. Nur in Sachsen eben noch nicht. Und das wird im Moment noch diskutiert.
Frage: Welche Voraussetzungen haben denn dafür gefehlt in deinem Fall?
Maria: Ja, in meinem Fall war das einfach so, dass ich nicht Deutsch studiere auf Lehramt. Ich glaube, da ist das etwas leichter. Das ist bei Französisch ein bisschen schwierig gewesen, weil ich ja vor allen Dingen auch im Deutschunterricht geholfen habe. Vielleicht hätte ich bei meinem Zweitfach nochmal schauen können, bei Geschichte. Aber auch dort war es nicht so einfach, weil es eben nicht dasselbe Schulsystem ist direkt wie hier.
Frage: Konntest du dir andere Studienleistungen anrechnen lassen?
Maria: Ja, zum einen habe ich die Voraussetzungen erfüllt, die für das Ablegen des Staatsexamens wichtig ist, also den obligatorischen Auslandsaufenthalt. Und zum anderen konnte ich mir auch Punkte im Ergänzungsbereich anrechnen lassen.
Frage: Was nimmst du denn aus deiner Fremdsprachenassistenz im Ausland für deine künftige Tätigkeit als Lehrerin in Deutschland mit?
Maria: Unheimlich viele methodische und didaktische Erfahrungen, aber auch viele selbst erstellte Materialien für den Unterricht, die man problemlos auch auf jedes andere Fach übertragen kann. Das Praktikum hat mich außerdem persönlich sehr viel weiterentwickelt. Ich habe neue internationale Freundschaften geknüpft und der wichtigste Punkt für mich: Ich konnte meine Fremdsprachenkenntnisse verbessern und erweitern, weil ich im Alltag fast eigentlich nur Französisch geredet habe und auch mit den Deutsch-Lehrerinnen und Lehrern immer auf Französisch gesprochen habe.
Frage: Was sollte man bei der Wahl einer geeigneten Schule im Ausland denn beachten deiner Meinung nach?
Maria: Dass man keinen direkten Einfluss auf die Wahl der Praktikumsstelle hat, sondern nur eine bestimmte Region in einem Land auswählen kann. Das ist aber letztlich überhaupt nicht schlimm, denn ich glaube, man kann überall neue und spannende Erfahrungen sammeln.
Frage: Was würdest du den anderen Lehramtsstudierenden raten, die ein FSA im Ausland planen?
Maria: Das FSA-Programm als eine Möglichkeit für einen Schulpraktikum in Erwägung zu ziehen. Denn es bietet wirklich eine ideale Gelegenheit, um einerseits sicherer im Umgang mit der Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden zu werden und um andererseits auch mal über einen längeren Zeitraum an einer Schule mitzuwirken, Unterricht selbst zu planen, einfach mal auszuprobieren und man erhält nützliches Feedback von den Mentorinnen und Mentoren an der Schule.
Frage: Wie hast du denn gewohnt und wie hast du dir die Unterkunft an den zwei Standorten organisiert?
Maria: Ich habe in einer WG gewohnt, zusammen mit einer anderen Assistentin, die aus Amerika bzw. England kam. Das war eine total spannende Erfahrung und ich konnte dadurch viele neue Leute kennenlernen, internationale Freundschaften knüpfen. Die Unterkunft wurde mir von den beiden Schulen, an denen ich gearbeitet habe, organisiert.
Frage: Hast du dich mit deinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern auch zu deinem Schulalltag austauschen können oder wart ihr einfach in zu unterschiedlichen Bereichen tätig?
Maria: Nein, wir haben uns sehr viel ausgetauscht, weil meine Mitbewohnerinnen haben auch beide als Fremdsprachenassistent für Englisch gearbeitet, weil sie eben aus Amerika kamen. Aber wir haben uns da sehr viel über Unterrichtsmaterialien ausgetauscht und auch über den Schulalltag.
Frage: Gab es irgendwelche Unterschiede, die dir besonders aufgefallen sind? Ihr konntet ja zum Beispiel eure Studienzeit wahrscheinlich ganz gut vergleichen?
Maria: Das war eigentlich gar nicht so ein Thema, weil die anderen Assistentinnen, die studieren gar nicht Lehramt, die haben das einfach so gemacht als Bereicherung, das FSA-Programm. Und die eine hat z.B. Journalismus studiert und war damit auch schon fertig und wollte dann einfach ihre Fremdsprachenkenntnisse im Ausland ein bisschen erweitern.
Frage: Was war denn die spannendste bzw. wertvollste Lernerfahrung oder Kenntnis, die du während deiner Fremdsprachenassistenz gewinnen konntest?
Maria: Dass ich ganz viel Unterricht mitgestalten konnte, selbstständig und auch ein neues Schulsystem kennenlernen konnte. Ich konnte an Schüleraustauschen und Klassenausfahrten teilnehmen und die auch mit organisieren und dann auch die Abitur-Vorbereitung von einigen Schülern der Klasse 12 übernehmen. Es waren ganz viele spannende Erfahrungen, die ich mir auf jeden Fall für später auch so mitnehme.
Frage: Gab es für dich ein schönstes Erlebnis?
Maria: Eine Schulausfahrt nach Trier, die ich zusammen mit der Deutschlehrerin am Collège organisiert habe. Wir sind also mit den Schülerinnen und Schülern einen Tag nach Trier gefahren, haben dort den Weihnachtsmarkt besucht und auch eine kleine Stadtrally gemacht. Das war total cool und auch erlebnisreich und man hat richtig gesehen, als wir dann am Abend wieder nach Hause gefahren sind, wie glücklich und zufrieden die Schülerinnen und Schüler dann waren.
Frage: Gab es für dich besonders große Herausforderungen während deiner Fremdsprachenassistenz und waren die z.B. bei deiner zweiten Assistenz anders?
Maria: Sicherlich aktuelle und unvorhersehbare Ereignisse in Frankreich. Das war 2018 bei meiner ersten Assistenz die Gelbwesten-Bewegung und beim zweiten Mal dann der Generalstreik in Frankreich, wo das komplette Zugnetz lahmgelegt wurde und ich hatte dann Mühe, über Weihnachten nach Deutschland zurückzukommen. Aber prinzipiell muss ich sagen, dass ich immer versucht habe, gelassen und ruhig zu bleiben und es gab immer irgendwie eine Lösung. Und die Mentorinnen und Mentoren an meinen beiden Schulen haben mich dabei auch hervorragend unterstützt und ich konnte sie jederzeit bei Problemen und Fragen fragen.
Frage: Wie hast du denn Bekanntschaften geknüpft?
Maria: Ich habe viele Bekanntschaften im Ausland durch ein dreitägiges Auftaktseminar geknüpft, was zu Beginn meines oder meiner beiden Auslandsaufenthalte mit allen FSA aus meiner Region stattfand. Ich hatte dort sowohl die Gelegenheit, andere FSA aus Deutschland zu treffen, aber auch Assistenten aus anderen Nationen wie Mexiko, England oder der USA kennenzulernen. Und wir haben dann eben unsere Nummern ausgetauscht und haben uns während des Auslandsaufenthaltes dann eben paar Mal getroffen und auch was zusammen unternommen.
Frage: Würdest du sagen, dass sich eine Fremdsprachenassistenz aufgrund der Erfahrungen, die du gesammelt hast, lohnt? Auch wenn es bedeutet, dass man durchaus länger studieren könnte?
Maria: Auf jeden Fall! Aufgrund der vielen Erfahrungen, die man sammelt. Das bedeutet zwar, dass man eventuell ein Semester länger studiert, aber so viele praktische, methodische und auch didaktische Erfahrungen wie als FSA bekommt man glaub ich nirgendwo anders besser vermittelt.
Frage: Denkst du, dass auch Lehramtsstudierende ins Ausland gehen sollten, die keine Fremdsprache studieren?
Maria: Man kann wirklich so viele praktische Erfahrungen für später sammeln und hat die Chance, sich auch mal auszuprobieren in Bezug auf Unterrichtsmethoden und auch einfach mal seine eigene Lehrerpersönlichkeit über einen längeren Zeitraum kennenzulernen. Und man kann natürlich auch den Unterricht in anderen Ländern oder in einem anderen Land kennenlernen, was ja auch seinen späteren Unterricht super bereichern kann.
Frage: Welchen zeitlichen Vorlauf sollte man denn so einplanen, wenn man eine Fremdsprachenassistenz plant?
Maria: Man sollte schon ein Jahr vorher so ziemlich einplanen, da das Bewerbungsverfahren ziemlich aufwändig ist. Und ja, wenn man das machen möchte, vielleicht so ein bis anderthalb Jahre vorher kann man so eine Info-Veranstaltung besuchen. Und da stelle ich auch das Bewerbungsverfahren immer vor.
Frage: Du meintest gerade, dass das Bewerbungsverfahren relativ aufwändig ist. Kannst du kurz näher darauf eingehen?
Maria: Man muss ein Motivationsschreiben in seiner Muttersprache schreiben, also in Deutsch oder was man hat als Muttersprache hat. Dann noch in der Sprache des Ziellandes, also wo man hingehen möchte. Und dann muss man einen Lebenslauf sowohl in seiner Muttersprache als auch in der anderen Sprache – des Landes, wo man hingehen möchte – schreiben. Und dann braucht man noch einen Hochschulgutachten von einem Dozenten. Ja, das ist so das Wichtigste erstmal. Man sollte schon ein bisschen Zeit davor einplanen, um das auch gewissenhaft erledigen zu können.
Frage: Hattest du das Gefühl, dass während der Formulierung deiner Motivationsschreiben, dass dir dabei auch nochmal klarer geworden ist, warum du das genau machen möchtest? Oder hat dir das dabei gar nicht geholfen?
Maria: Doch auf jeden Fall hat mir das geholfen, denn ich hab auch dann bin auch auf die Aufgaben, die man als FSA hat, eingegangen im Motivationsschreiben. Und das hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen, weil ich mir dann auch nochmal klarer geworden bin, warum ich eigentlich mich bewerbe und welche Erfahrungen ich auch gerne sammeln möchte.
Frage: Hast du das Gefühl, dass du durch deine inzwischen einjährige Tätigkeit im Ausland als Lehrkraft bzw. Fremdsprachenassistentin auch nochmal eine Art Vorsprung hast, wenn du z.B. ins Referendariat gehen solltest?
Maria: Ja, auf jeden Fall. Ich hab das jetzt im Blockpraktikum bemerkt, was ich in Französisch gemacht habe. Da konnte ich unheimlich viele Materialien, die ich als Fremdsprachenassistentin schon benutzt habe bzw. erstellt habe, wiederverwenden und hab die einfach vom Deutschen ins Französische übertragen. Das hat also super funktioniert und auch so fühle ich mich viel sicherer im Unterrichten, als das vor der Assistenz der Fall war.
Frage: Da du ja jetzt Erfahrungen quasi vor einer Klasse in Frankreich und auch in Sachsen sammeln konntest: Gibt es Unterschiede, die dir besonders aufgefallen sind?
Maria: Dass die Schüler in Frankreich viel verspielter sind und auch der Schulalltag ein ganz anderer ist. Die Schule endet meistens erst gegen 17 Uhr. Das heißt, es ist ein sehr langer Schultag. Zwar mit einer Mittagspause, die zwei Stunden geht, anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Aber die Schüler, wenn man dann Nachmittagsunterricht hat, dann sind die schon sehr kaputt. Und hier endet der Schulalltag einfach früher, was schon erhebliche Unterschiede erkennen lässt.
Frage: Ja, war das auch für dich irgendwie hart? Solange quasi immer in der Schule sein zu müssen? Oder war es für dich so, dass danach auch dein Programm erst einmal zu Ende war und du zum Beispiel während der Pause noch Vorbereitungen treffen konntest? Oder hat sich dadurch der Tag für dich auch verlängert?
Maria: Also für mich war das früh immer ganz in Ordnung so. Und dann kam die Mittagspause und danach hatte ich immer so ein Tief. Was heißt Tief? Da war es schwieriger für mich, wieder reinzukommen, weil es ging dann meistens gegen 14 Uhr weiter und bis 17 Uhr. Und das war dann schon ermüdend, wenn man grade auch die Zwölftklässler an dem Lycée – die haben noch länger Unterricht am Lycée – sogar bis 18 Uhr manchmal. Und da hatte ich montags z.B. eine Stunde von 17 Uhr bis 18 Uhr und das war dann schon ziemlich anstrengend, weil die Schüler kaputt waren. Und ich war selbst auch nicht mehr so topfit. Es war schon…
Frage: Welches System gefällt dir persönlich besser oder kannst du irgendwie in beidem relativ ausgewogen Vor- und Nachteile erkennen?
Maria: Ich kann nicht so direkt sagen, welches ich es jetzt besser finde. Ich finde, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Was ich Frankreich jetzt nicht so toll fand, war wirklich der lange Schulalltag. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, welches mir besser gefällt, welches System.
Frage: Hast du noch einen abschließenden Rat für Lehramtsstudierende, wie man seinen Auslandsaufenthalt am besten angehen sollte?
Maria: Dass man sich erst einmal über mögliche Programme und verschiedene Möglichkeiten an der Uni informiert. Ich organisiere zum Beispiel jedes Semester Infoveranstaltungen zum FSA-Programm, in denen ich von meinen Erfahrungen berichte, das Programm vorstelle und auch immer andere ehemalige FSA dazu einlade. Man kann sich also bei Interesse am FSA-Programm jederzeit gerne an mich per E-Mail an dresden@ fsa-pad.de wenden.
Es gibt an jeder Uni sogenannte Campus Botschafter. Das bin ich jetzt für die Uni Dresden und unsere Aufgabe ist es, dass wir verschiedene Infoveranstaltungen zum FSA-Programm leiten, das FSA-Programm vorstellen und dann auch von unseren eigenen Erfahrungen berichten.
[Outro]
„Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
„In vielen anderen Studiengängen ist das mittlerweile Usus. Und so dachte ich eben, warum nicht auch im Lehramt, auch wenn man keine moderne Fremdsprache studiert?“
[Intro]
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast Serie „Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Heute spreche ich mit Niklas über sein Schulpraktikum in Japan. An der TU Dresden studiert er Lehramt für Gymnasien mit den Fächern Mathematik und Chemie und war von September 2019 bis März 2020 im achten Fachsemester im Ausland.
Niklas: Ja, mein Name ist Niklas Marzin. Ich war von September 2019 bis März 2020 in Japan im Rahmen des DAAD Stipendien Programms „Lehramt International“.
Frage: Was hat dich zu einem Auslandsaufenthalt während des Lehramtsstudium bewogen?
Niklas: Also zum einen habe ich gesehen, dass viele Kommilitonen, die nicht Lehramt studieren, ein Auslandssemester absolviert haben. In vielen anderen Studiengängen ist das mittlerweile Usus. Und so dachte ich eben, warum nicht auch im Lehramt, auch wenn man keine moderne Fremdsprache studiert.
Frage: Was waren denn deine Gründe für die Wahl des Landes bzw. der Schule?
Niklas: Schon in der Schulzeit hat sich bei mir ein großes Interesse an Ostasien ergeben und ich habe in den ersten Semestern an der TU einen Japanischkurs besucht und da hat sich mein Interesse speziell an Japan immer mehr gesteigert. Und so habe ich dann die Idee bekommen, warum nicht ein Auslandssemester in Japan zu absolvieren. Und so habe ich mich im Internet informiert, welche Deutsche Auslandsschulen es eben gibt. Da gibt es die Website vom sogenannten „PASCH-Netzwerk“. Dort sind all die deutschen Auslandsschulen aufgelistet. Dort habe ich mich dann informiert und gesehen, dass es zwei deutsche Auslandsschulen in Japan gibt, von denen aber nur eine vollwertig bis zum Abitur führt. Und deswegen habe ich mich dann für die Deutsche Schule Tokyo Yokohama entschieden.
Frage: Wie hast du dann gewohnt und wie hast du dir die Unterkunft organisiert?
Niklas: Ich habe zuerst überlegt, im Studentenwohnheim zu leben, was den Vorteil hat, viele Gleichaltrige kennenzulernen. Auf der anderen Seite dachte ich, wäre vielleicht sehr schön, bei einer Gastfamilie zu leben, deren Kinder eben an die deutschen Auslandsschulen gehen. Und so dachte ich, mir über einen Aushang an der Schule könnte ich eine Gastfamilie gewinnen. Und ich hab dann eben einen solchen Aushang gestaltet und der wurde dann in der Schule am schwarzen Brett aufgehängt. Und dann hat sich auch eine Familie gemeldet, bei der ich dann während meines Auslandsaufenthaltes leben durfte.
Frage: Inwiefern unterscheidet sich denn ein Schulpraktikum im Ausland von einem in Sachsen?
Niklas: Ein großer Unterschied ist z.B. die Zusammensetzung des Kollegiums und der Schülerschaft. Das Kollegium an einer Auslandsschule ist sehr bunt und vielfältig. Es sind Lehrer aus allen deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, daraus wieder die unterschiedlichen Bundesländer vertreten, aber eben auch Lehrer aus Österreich und der Schweiz. Aber auch Lehrer, die die Muttersprache des jeweiligen Landes unterrichten. In meinem Fall gab es auch Japanerinnen und Japaner, die an der Schule Japanisch unterrichtet haben.
Ein weiterer großer Unterschied ist, dass in den Deutschen Auslandsschulen auch Kindergarten, Grundschule und Sekundarstufe integriert sind. Das heißt, im Rahmen eines Praktikums ist es durchaus möglich, die unterschiedlichen Bildungsbereiche kennen zu lernen z.B. durch Hospitationen. Eine weitere Besonderheit der Deutschen Auslandsschulen ist, dass sie in der Regel Privatschulen sind, d. h. sie erheben auch Schulgelder und über diese Schulgelder kann auch eine entsprechend gute Ausstattung gewährleistet werden. So gab es an meiner Praktikumsschule in jedem Klassenraum, ein Smart Board und auch mehrere Klassensätze an iPads. Außerdem waren z.B. die Sportanlagen sehr großzügig. Die Schule hatte sogar ein eigenes Schwimmbad.
Natürlich ergibt sich durch die Vielfalt im Kollegium in der Schülerschaft ein etwas anderes Arbeiten, als man das vielleicht hier bisher in den Praktika kennengelernt hat. In Bezug auf das Kollegium merkt man eben, dass jeder aus einem anderen Bundesland oder deutschsprachigen Land kommt und sozusagen sehr unterschiedliche Berufserfahrung aufweist. Aber ich finde, dass es war ein großer Vorteil, weil man viele Perspektiven der anderen Lehrerinnen und Lehrer mitbekommt und von ihren Erfahrungen profitieren kann. Bezogen auf die Schüler ist es natürlich auch sehr unterschiedlich im Vergleich zu hier. Zum Beispiel musste ich, was ich bisher noch nicht gewohnt war, in den Praktika sehr auf die deutsche Sprache achten. Also das Prinzip Deutsch im Fachunterricht „DFU“, weil die meisten Schüler in den Klassen bilingual aufwachsen und deswegen eben speziell außerhalb des Deutschunterrichts, also bei mir Mathematik und Chemieunterricht, besonders auf die deutsche Sprache achten muss.
Frage: Was waren denn die größten Herausforderungen während deines Auslandsaufenthaltes, oder was war einfach sehr ungewohnt für dich?
Niklas: Ja, ich war das eben noch nicht gewohnt, mit so einer bilingualen Klasse zu arbeiten. Also wo so ein hoher Anteil an Schülerinnen und Schüler vorhanden ist, die bilingual aufgewachsen sind. Das war für mich am Anfang etwas sehr Neues und vielleicht auch etwas überfordernd, weil ich mich da noch nicht so richtig auskannte. Aber ich konnte viel von den Kolleginnen lernen, die da schon sehr bewandert waren. Und ich hatte auch durch geeignete Fachliteratur mir entsprechendes Wissen sozusagen auch learning by doing angeeignet und konnte dann im Laufe der Zeit entsprechend besser meinen Unterricht an die Schülerinnen und Schüler anpassen.
Frage: Was waren deine hauptsächlichen Einsatzfelder an der Schule und wie selbstständig konntest bzw. durftest du dort den Unterricht gestalten?
Niklas: Zu meinen Haupteinsatzgebieten gehörten zum einen das Hospitieren in der Sekundarstufe. Ich habe eigentlich in jeder Klasse von Klassenstufe 5 bis 12 mindestens einmal hospitiert, sowohl bei meinen Mentoren, also in Mathematik und Chemie, als auch fachfremd. Gleichzeitig durfte ich eigenen Unterricht, natürlich unter Begleitung des Mentors, halten. Als Studenten haben wir natürlich Vorgaben von den Fachdidaktiken, also einen bestimmten Umfang an Hospitation und begleiteten Unterricht. Aufgrund der Länge meines Praktikums konnte ich natürlich wesentlich mehr hospitieren und unterrichten. Also z.B. konnte ich im Chemieunterricht Klasse 10 einen ganzen Lernbereich über 30 Stunden selber durchführen. Am Ende in Zusammenarbeit mit meiner Mentorin eine Klausur umsetzen. Auf Grund dessen, dass in den deutschen Auslandsschulen eben neben der Sekundarstufe auch die Grundschule und der Kindergarten integriert waren, konnte ich Einblicke in die anderen Bereiche, insbesondere im Grundschulbereich erhalten, indem ich eben bei netten Kollegen hospitieren durfte. Außerdem, aber das ist eine Besonderheit von der Schule in Yokohama, gibt es an der Deutschen Auslandsschule dort eine integrierte Fachoberschule, die Schülerinnen und Schüler in der 11. und 12. Klasse alternativ zum allgemeinen Abitur besuchen dürfen und dort konnte ich eben auch hospitieren und sogar unterrichten. Und das war auch eine sehr neue Erfahrung. Da natürlich die Lehrpläne innerhalb der Fachoberschule anders gestaltet sind als die vom regulären Gymnasium und entsprechend muss man dann diesbezüglich auch den eigenen Unterricht anpassen. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, an Exkursionen außerhalb des regulären Unterrichts teilzunehmen. So bin ich mit Klassen z.B. auf Exkursion gegangen zur Universität der Vereinten Nationen nach Tokyo.
Frage: Konntest du dir das Auslandspraktikum als Blockpraktikum anrechnen lassen? Und was waren die Voraussetzungen bei dir dafür?
Niklas: Ich konnte mir das Praktikum anrechnen lassen. Ich hatte von vornherein eigentlich damit kalkuliert. Beide Praktika B darin zu integrieren, weil ein Blockpraktikum B ist jeweils vier Wochen lang. Und eigentlich müssten wir die der vorlesungsfreien Zeit absolvieren. Und da ich die diese Blockpraktika zum Zeitpunkt meiner Bewerbung noch nicht absolviert hatte, dachte ich mir, es wäre doch vorteilhaft beide sozusagen zusammenzufassen. Und dann eben zu einem Semester auszudehnen.
Frage: Was würdest du anderen Lehramtsstudierenden raten, die ein Schulpraktikum im Ausland planen?
Niklas: Wichtig ist eben zuvor mit den entsprechenden Zuständigen der Fachdidaktik das abzusprechen, dass das für die auch in Ordnung geht, dass man die Praktika an einer Deutschen Auslandsschule absolviert. Und man muss von der Praktikumskoordination und ZLSB sich das Praktikum auch bestätigen lassen.
Frage: Konntest du dir denn noch weitere Studienleistungen anrechnen lassen?
Niklas: Nein, ich konnte mir keine weiteren Studienleistungen anerkennen lassen. Also sind es eigentlich wirklich nur diese zwei Blockpraktika, die ich in der Zeit gemacht habe.
Frage: Was nimmst du aus deinem Schulpraktikum im Ausland für deine zukünftige Tätigkeit als Lehrer in Deutschland mit?
Niklas: Eine erweiterte Methodenvielfalt und eine erhöhte Sensibilität für die Binnendifferenzierung im Unterricht. Denn an der Deutschen Auslandsschule muss man mindestens in drei verschiedenen Aspekten differenzieren. Zum einen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, wachsen die meisten der Schülerinnen und Schüler multilingual auf. Deswegen muss man im Fachunterricht besonders auf die deutsche Sprache achten und entsprechende Methoden anwenden, um diese eben zu trainieren.
Frage: Worauf sollte man bei der Wahl einer geeigneten Praktikumsschule denn deiner Meinung nach achten?
Niklas: Dass nicht alle Auslandsschulen alle Lehrämtler sozusagen für ein Praktikum nehmen. An der Auslandsschule in Japan war es eben so, weil die meisten Schülerinnen und Schüler auf gymnasialem Niveau eingestuft sind und die Schülerinnen und Schüler auf Oberschul- bzw. Hauptschul-Niveau in die gymnasialen Klassen gewissermaßen integriert sind, nimmt die Auslandsschule in Japan eigentlich nur Praktikanten für den gymnasialen Bereich auf oder eben für den Primarbereich, also die Grundschule. Des Weiteren ist darauf zu achten, ob die entsprechende Schule ein Gehalt, eine Bezahlung anbietet oder eben nicht. Beispielsweise bei meinem Praktikum habe ich keine Bezahlung erhalten. Jedoch gibt es auch, wie ich erfahren habe, Auslandsschulen, die ein gutes Gehalt anbieten. Des Weiteren sollte man damit rechnen, dass die Deutschen Auslandsschulen je nach Land sich sehr hoher Beliebtheit erfreuen, also z.B. bei einer Deutschen Auslandsschule in New York sind die Bewerberzahlen dementsprechend hoch. Außerdem ist wichtig, darauf zu achten, dass manche Fächer an manchen Deutschen Auslandsschulen auch bilingual unterrichtet werden oder rein auf Englisch.
Frage: Was war denn dein allerschönstes Erlebnis?
Niklas: Ein allerschönstes Erlebnis kann ich eigentlich gar nicht benennen, denn ich habe viele schöne Dinge in meiner Zeit in Japan erlebt. Ich bin jeden Tag wirklich sehr gern in die Praktikumsschule gegangen. Zum anderen habe ich die Zeit mit meiner Gastfamilie sehr genossen. Ich fand es sehr interessant, einen tiefen Einblick in das Alltagsleben in Japan zu bekommen. Außerdem hat es mir viel Spaß gemacht, mit Freunden, die ich dort kennengelernt habe, Japan zu erkunden, also das japanische Essen, die Kultur und die Traditionen.
Frage: Wärst du dann gerne länger oder kürzer geblieben?
Niklas: Für mich persönlich war der Zeitraum von einem halben Jahr sehr gut, denn in dieser Zeit oder die Zeit war ausreichend lang um viel zu lernen und zu sehen. Die meisten Praktikanten machen meiner Erfahrung nach nur ein Praktikum von 4 bis 6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit. Das ist meiner Meinung nach eigentlich zu kurz. Das fühlt sich dann eher nur wie eine Art verlängerter Urlaub an. Aber bei einem Semester kann man durchaus einen tiefen Einblick in die Praktikumsschule bekommen. An dieser Stelle ist auch zu beachten, dass es durchaus Schulen gibt, die eine feste Praktikumszeit verlangen, z.B. von einem halben Jahr. Für mich persönlich wäre aber eine längere Zeit als ein halbes Jahr nicht in Frage gekommen, da ich nicht wollte, dass sich mein Studium noch mehr verlängert.
Frage: Gab es Dinge, die dir vielleicht schwer fielen oder dir als besonders herausfordernd vorkamen?
Niklas: Sicherlich gab es hier und da im Alltag Verständigungsprobleme aufgrund der Sprachbarriere, insbesondere am Anfang meines Aufenthalts in Japan, aber das hat sich mit der Zeit dann auch gebessert.
Frage: Hast du noch einen abschließenden Rat für Lehramtsstudierende, wie man seinen Auslandsaufenthalt am besten angehen sollte?
Niklas: Das Wichtigste ist meiner Meinung nach die rechtzeitige Planung. In meiner Situation war es so, dass ich mich im Sommer 2017 für das Praktikum beworben hatte. Ich hatte auch recht schnell eine Rückmeldung bekommen, jedoch mit einer Absage, weil ich mich vorerst für den Praktikumszeitraum 2018 auf 2019 beworben hatte. Und für diesen Zeitraum es schon einen Praktikanten gab in meiner Fächerkombination. Und so habe ich dann angefragt, ob ein Jahr später, also der entsprechende Zeitraum ein Jahr später, möglich wäre. Für diesen Zeitraum gab es dann noch keinen Praktikanten in meiner Fächerkombination, sodass ich dann genommen worden bin. Aber letztendlich ergab sich dadurch eine Vorbereitungszeit von insgesamt zwei Jahren. Ich würde jedem Lehramtsstudierenden, der sich für ein Auslandspraktikum interessiert, raten, mindestens ein Jahr vorneweg mit der Planung bzw. mit der Bewerbung anzufangen. Im besten Fall eigentlich anderthalb Jahre.
[Outro]
„Going Abroad“ - Lehramtsstudierende der TU Dresden berichten von ihren Auslandserfahrungen.
Erfahrungsberichte und Studierenden-Blogs
-
Erfahrungsberichte von Studierenden der TU Dresden im Mobilitätsportal MoveOn (Erfahrungsberichte finden Sie unter Einträgen der jeweiligen Hochschulen)
- Erfahrungsberichte von Studierenden der TU Dresden beim Akademischen Auslandsamt
- Studieren weltweit – Erlebe es!: große Sammlung von Blogs, Erfahrungsberichten und Hinweisen deutscher (Lehramts-) Studierender im Ausland
- Erfahrungsberichte von Stipendiat:innen im SCHULWÄRTS!-Programm (Schulpraktika im Ausland)
Beiträge gesucht!
Sie möchten Ihre Erfahrungen im Ausland gern mit anderen teilen? Sie haben einen Blog, ein Projekt oder eine tolle Idee? Wir freuen uns über Ihre Nachricht:
 © IMPRESS
© IMPRESS
Projekt IMPRESS
Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).
Besuchsadresse:
Seminargebäude II, Raum 23a Zellescher Weg 20
01217 Dresden
Postadresse:
Technische Universität Dresden Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB)
01069 Dresden